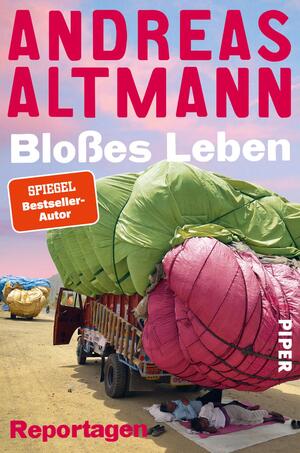
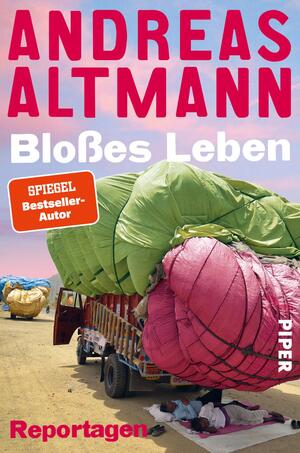
Bloßes Leben Bloßes Leben - eBook-Ausgabe
Reportagen
„Eine Art Best-of. Gar ein Vermächtnis? Eines jedenfalls haben die Texte gemein: Altmanns schonungslos unverblümten, oft humorvollen Stil.“ - Süddeutsche Zeitung
Bloßes Leben — Inhalt
Der große Reiseautor wieder in Bestform
Besondere Begegnungen, ungestüme Landschaften, wertvolle Erkenntnisse – das Reisen erweitert nicht nur unseren Horizont, sondern lehrt uns zu leben. Und wer kann uns dieses Leben in seiner rohen, manchmal erschreckenden und meist überwältigenden Vielfalt besser nahebringen als der begnadete Reporter Andreas Altmann? In dieser Auswahl seiner gefeierten Reportagen lässt er uns an seinen Begegnungen in aller Welt teilhaben, erzählt von den unterschiedlichsten Menschen und ihren Schicksalen und nimmt uns mit nach Lappland und in den Sudan, nach Mumbai und Chicago, zu Kamelrennen und Himalajawallfahrten. Das immerwährende Interesse an anderen Menschen und ihren Umständen treibt ihn vorwärts. Bloßes Leben in einem Band.
Leseprobe zu „Bloßes Leben“
ISLAND
Nicht sterben dürfen, ohne hier gewesen zu sein
„Das war zu viel für ihn“, meinte der Doktor und blickte besorgt auf Monsieur Stendhal, der bewusstlos vor ihm lag. Der französische Schriftsteller war durch Florenz geschlendert und umgekippt. Besinnungslos.
Dieser Tag – über 200 Jahre liegt er nun zurück – ging in die Geschichte der Medizin ein. Wem heute die Sinne schwinden beim Anblick von zu viel Schönheit, der leidet unter dem „Stendhal-Syndrom“. Durchaus heilbar. Bettruhe wird verordnet, und – noch wichtiger – für einige Zeit soll jede visuelle [...]
ISLAND
Nicht sterben dürfen, ohne hier gewesen zu sein
„Das war zu viel für ihn“, meinte der Doktor und blickte besorgt auf Monsieur Stendhal, der bewusstlos vor ihm lag. Der französische Schriftsteller war durch Florenz geschlendert und umgekippt. Besinnungslos.
Dieser Tag – über 200 Jahre liegt er nun zurück – ging in die Geschichte der Medizin ein. Wem heute die Sinne schwinden beim Anblick von zu viel Schönheit, der leidet unter dem „Stendhal-Syndrom“. Durchaus heilbar. Bettruhe wird verordnet, und – noch wichtiger – für einige Zeit soll jede visuelle Provokation vermieden werden. Für den Meister galt: vorübergehend keine Aussichten auf blühende Italienerinnen und den betäubenden Glanz italienischer Architektur.
Gut, dass der Mann nie in Island war. Der Schwächling wäre schon beim Anflug in die Knie gegangen. Hier hat nicht Michelangelo gearbeitet, sondern der Teufel. Das trotzige Ende der Welt, behaupten die Wikinger. Ein muskulöser Erdteil mit eisig glühenden Gegensätzen: dunkle Tage und helle Nächte, blaustählerne Himmel und höllenschwarze Wolken. Und nie ein Übergang, immer vehement und plötzlich, immer fordernd und anstrengend. Luft und Erde und Feuer und Wasser für starke Typen. Die Insel ist kein Kurort, hier kämpfen sie noch gegen eine brachiale Natur. Das Land peitscht, bohrt ins Gemüt, überwältigt die gierigen, neugierigen Augen. Aber wer wüsste zu sagen, was heftiger begeistert: die 100 000 Quadratkilometer kleine Insel oder ihre seltsam widerständigen, eher scheuen und großzügigen Frauen und Männer.
Reykjavík, brave, saubere Hauptstadt, nicht schön, nicht hässlich, gar nichts. Bemerkenswert jedoch, dass sie hier einen Fremden anlächeln, dass alle sechs Jahre ein Mord passiert und noch nach 23 Uhr die Kinder im Sommerlicht der Mitternachtssonne Fußball spielen.
Auf seiner Farm, zwei Autostunden Richtung Norden, treffe ich Sveinbjörn Beinteinsson. Sein Haus eine Hütte aus Stein, in den Boden gerammt, niedrig, auf dem Dach wächst Gras. Daneben eine Scheune, ein Schleifstein, ein Wasserloch, im Hinterhof ein Gletscher. Der Wind rast durch das Tal, der Blick fällt auf schneebedeckte Berge, auf einen See, einen Fluss, die Schafe. Der Alte ist Bauer, Poet und „Godi“, ein Hohepriester des germanischen Hauptgottes Thor. Lange hat der heute 58-Jährige gekämpft, dann wurde seine Religion wieder zugelassen. Wir sitzen in der Küche, der Ofen brennt, Bücherkisten stehen herum, die Schreibmaschine, das nie gemachte Bett.
Kein Volk ist so literaturnärrisch wie die Isländer. Sprache als Grundnahrungsmittel, um die elf Jahrhunderte schonungslosen Existenzkampfs auszuhalten: mit Hungersnöten, Fremdherrschaft, Piratengier, christlicher Vergewaltigung und dunklen, ewigen Winternächten.
Eine solche Sprachlust, eine solche Finsternis und eine so gewalttätige, heroische Landschaft mit so viel Nebel, Wind und Feuer speiender Erde verführt zum Fantasieren, liefert tausend Rechtfertigungen für Geistergeschichten, Heldensagen und Götterlegenden.
Sveinbjörn ist ein fröhlicher Kerl. Seine hellblauen, schnellen Augen, der weiße Vollbart, die zerzausten Haare, die Pfeife, die Hosenträger über dem abgetragenen Hemd. Ein paar Hundert Meter von seinem Hof entfernt steht in einer Felswand die Statue von Thor. Dort treffen sich seine rund achtzig Anhänger, viermal pro Jahr. Singen alte Lieder, lesen aus der Edda, essen und trinken, lachen. Seine Landsleute respektieren den Kauz, kaufen seine Gedichte, hören im Radio seine sanften und zornigen Gedanken über die Dummheit der Menschen.
Sveinbjörn ist ganz irdisch. Er erzählt von organisierten Happenings gegen die Apartheidpolitik in Südafrika und meint zum Abschied: „Hoffentlich gewinnen die Asen (das hiesige Göttergeschlecht!) in Deutschland an Einfluss. Dann wird alles gut mit der Wiedervereinigung.“ Er winkt mir nach, grinst selig, sein Gesicht strahlt.
Manche lieben die Wüste mehr als alle anderen Landschaften. Solche Zeitgenossen sind begabt für Island.
Ich fahre weiter nach Norden, entlang des äußersten Rands der Snæfellsnes-Halbinsel. Das Autoradio ist kaputt, gut so. Nichts lenkt ab. Hier, sagen sie, redet nur der Wind. Und der singt mit hundert Stimmen. Die Schotterstraße führt durch ein Terrain für Bibelfilme. Ein Lavafeld, moosbedeckt, eine Ruine steht da, die Holztür schleudert auf und zu. Vier Stunden lang kein Gegenverkehr. Blick hinauf zum olympisch weiß schimmernden Snæfellsnesjökull, von dem Jules Verne einmal schrieb, er sei der Eingang zur Welt. Es ist 22.15 Uhr, und die Sonne blendet so stark, dass ich nur im Schritttempo vorwärtskomme. Die absurden Formen der gefrorenen Lava blitzen im Gegenlicht. Alles könnten sie sein. Götterburgen, ein achtfüßiges Pferd, zwei Drachenohren, der Speer eines zornigen Kriegers. In der Edda findet sich ein Gedicht über die Ur-Erschaffung, dort heißt es: „Und aus des Riesen Fleisch ward die Erde geschaffen/Aus seinem Schweiße das Meer/Aus dem Gebein die Berge/Und aus seiner Hirnschale der Himmel.“ Das ist mit dem Presslufthammer geschrieben. Und nur der kann es so hinschreiben, der eine solche Vision gesehen hat.
Am nächsten Tag führt die Strecke an den sechzehn Fjorden der Westküste entlang. Viele Kilometer wurden erst vor Kurzem geöffnet, endlich lässt der Winter nach. Einspurig, kurvig, abschüssig, Rollkies, Steinschlag, keine Seitenbande, scharfe Steigung, die mit Schmelzwasser gefüllten, bis zu vier Quadratmeter großen Schlaglöcher, wieder die Sonne, wieder der Wind, wieder die Hunde, die zu einem abgelegenen Berghof gehören und kläffend hinter dem Wagen herjagen. Mein russischer Lada, „siberiaproof“ und Vierradantrieb, verkrustet unter einer soliden Schmutzschicht.
Oben auf der Passhöhe stehen bescheidene Notunterkünfte, alles liegt sauber verpackt bereit: Socken und Mützen, ein Gaskocher, ein Funkgerät, Schokoladenkekse und Maggi-Spargelcremesuppen.
Oft bin ich allein auf dieser Reise. Und nie fühle ich mich einsam, gar klein und winzig. Im Gegenteil, ich empfinde Selbstvertrauen und Starksein. Hier bin ich noch einmalig und vorhanden, nicht unsichtbar und ausgelöscht in der Masse. Zudem weiß man sich von der Fürsorge der Isländer beschützt. Ich frage einen Mann, der einen umgestürzten Telefonmast repariert.
● Wo gibt es in der Gegend Benzin?
● Sechs Kilometer weiter. Klopf an die Tür und erkundige dich nach Einar von der Zapfsäule. Klappt es nicht, komm wieder, und mir fällt bestimmt etwas ein, um dir zu helfen.
Ich muss nicht zurück, Einar ist da und tankt voll. Um neun Uhr abends erreiche ich Isafjördur, ganz im Nordwesten des Landes. Ein Fischerdorf mit knapp 3000 Einwohnern. Die 700 Meter hohen Felsen schützen den Naturhafen und verhindern im Winter jeden Sonnenstrahl. Drei Monate lang ist es kalt, sturmverweht, schneeversunken und düster. Zieht endlich die Sonne über die Berge, dann heulen manche vor Freude, und alle trinken ihren „Sonnenkaffee“. Kein Wunder, dass ich zum dritten Mal in wenigen Stunden den hiesigen Tophit, den Reggae-Song aus Jamaika, höre: „Oh Kingston Town/The place I long to be …“ Noch eine Überraschung: Ich sehe einen Trabant. Die sozialistischen Rauchkerzen verkaufen sich gut auf der Insel. Autos sind teuer, mit ebendieser Ausnahme, jenen vierrädrigen Rußkesseln, die in immerhin 45 Sekunden auf volle 60 km/h jagen.
Als ich am nächsten Morgen Isafjördur verlasse, hebt gerade der Postbote ab. Hier fliegt der Briefträger, viele Dörfer haben ihre eigene platt gewalzte Wiese, die Landebahn. Neben mir sitzt Jon, ein junger Bursche, Autostopper. Gestern ging das Schuljahr zu Ende, und heute beginnt sein Ferienjob, drei Monate lang. Mit 16 ist jeder für sich verantwortlich, die Unterstützung der Eltern hört auf. Die Kids sind nicht wehleidig, packen an, über tausend Jahre Überleben macht stark. Der Halbwüchsige sagt den erstaunlichen Satz: „Immer heißt es, alles soll Spaß sein, easy, no problem. Aber das funktioniert nicht. Wir Isländer nehmen das Leben, wie es kommt. Ohne zu maulen.“
Am dritten Abend bin ich in Brekuækur, einem Bauernhof, der ein paar einfache Zimmer vermietet. Und Pferde. Ich entscheide mich für Lettir, einen windfarbenen Hengst. Ponys treibt ein zähes Verlangen nach Freiheit an. Und als eigensinnig, lebensfroh und zuverlässig gelten sie. Bis ins frühe 20. Jahrhundert schleppten sie Schwangere zur Hebamme, trugen Kranke zum Arzt, zogen Tote ins Grab. Sie bleiben rein wie die isländische Sprache. Kein fremder Gaul darf auf die Insel. Und wer einmal das Land verlassen hat, kann nicht mehr zurück.
Fünf Gangarten beherrschen die Tiere. Und die fünfte gibt es nur hier: den Tölt. Spötter nennen ihn den Säufergalopp, weil Isländer gerne blau werden und jeder Tölt-Schritt sacht auftritt und nie die Sauflust behindert. Abi, der Bauer, und ich reiten durch den Midfjördur, einen Lachsfluss. In der Nähe steht ein flacher Holzbau, das „Lachshotel“, zu dem im Hochsommer Herzchirurgen aus New York und französische Champagner-Magnate jetten, um für 750 Euro pro Tag fischen zu dürfen.
Mitternacht ist vorbei, schwere Wolken hängen, im Gegenwind galoppieren wir (verhalten) über die vom Frost geblähten Beulenwiesen. Ein weißer Gerfalke kreuzt, wir erreichen das Grab von Grettir. Unter dem Stein soll sein Kopf liegen. Nichts ist erwiesen, und doch rührt keiner den uralten Felsbrocken an. Nebel raunen, ein Fluch geistert an diesem Ort, Isländer sind hochbegabte Dramatiker. Grettir ist der Held einer blutgetränkten Familiensaga. Ein ruheloser, unglücklicher Mensch, der bereits als 13-Jähriger als Totschläger auftrat, später lange Jahre als Vogelfreier durch die Einöden Skandinaviens trieb und zuletzt nicht der Rache seiner Feinde entging: Enthauptung.
Wir reiten zurück, halb zwei ist es inzwischen, die hellen Nächte verschieben jedes Zeitgefühl. Abi verspricht für morgen ein herrliches Frühstück mit in heißer Erde gebackenem Braunbrot, Cornflakes, Kaffee und Lysi, dem pissgelben Nationalgetränk, einem kerngesunden, grässlichen Lebertran.
Island garantiert spektakuläre Gefühle. In Akureyri, der größten Stadt im Norden, miete ich eine einmotorige Piper Tomahawk, samt Thorstein, dem Piloten. Der Mann ist Fluglehrer und erkennt Feiglinge schon beim Einsteigen. Mein rechter Handballen schwitzt, tropft auf den Notizblock. Lächerliche 112 PS hat die Zündholzschachtel, unvorstellbar, wie das Ding in schwindelerregender Höhe bleiben soll. Aber ich habe keine Wahl. Von Reykjavík aus umkreise ich per Auto die Insel, doch viele Straßen, die nach innen führen, sind noch immer gesperrt. Also fliegen.
Thorstein entscheidet sich für eine Schocktherapie. Als einer der ersten „dirty winds“ uns nach unten wirbelt, erzählt er von den Abstürzen der letzten Jahre. Er übertreibt monströs, lügt mich herztot: „Da vorn, schau, der Felsvorsprung, das war im Januar. Drei Tote. Ach ja, da hinten – siehst du das Schneefeld? – versuchte man eine Notlandung. Leider daneben! Und ein paar Kilometer weiter drüben, ich zeig dir dann den Punkt, brach ein Feuer in der Kabine aus. Erst kürzlich, alle sieben Passagiere ab in den nächsten Krater, Sturzflug.“ Jetzt entkommt mir ein hysterischer Lacher, was Thorstein veranlasst, einen Motorschaden zu simulieren, ja, er will unbedingt beweisen, dass die Maschine auch ohne Triebwerk weiterfliegt und durchaus einige Minuten Zeit hat, einen Landeplatz zu finden.
Ach, woher soll einer die Sprache nehmen, um es mit Dutzenden von Weltwundern aufzunehmen? Blick auf den 1700 Meter hohen, schneeglitzernden Herdubreid, den Berg der Götter. Blick auf Odadahraun, die größte Lavawüste auf Erden, einst erbarmungsloses Ziel von Missetätern, einst Trainingsfeld für amerikanische Mondastronauten, Blick auf den 8500 Quadratkilometer riesigen Gletscher Vatnajökull, Blick in den vom Himmelsblau bestrahlten Öskjuvatn, einen kalten, eisglatten Kratersee, der die Sonne, die Wolken und das Flugzeug widerspiegelt.
Hier ist die Welt noch nicht fertig, ja, man starrt auf die wilde, unfassbar grandiose Rohfassung. Ach, Stendhal wäre längst gestorben.
Ich schlafe schlecht in dieser Nacht. Das ist mein persönlicher Rekord: 64,5 Zentimeter breit ist die Matratze. Eine Liegestatt für Leute im Hungerstreik. In Island haben sie keine Betten, nur Kojen. Erinnerung wohl an ihre Seefahrervorfahren, die Wikinger.
Für die Marter werde ich am nächsten Tag belohnt. Hundert Kilometer weiter im Osten liegt der Myvatn-See. Mückenhölle, Vogelparadies. Hier gibt es eine Erdspalte, in der dampfend warmes Wasser verwöhnt. Mit einem Seil lässt man sich hinunter, es hallt, es ist still, das Eintauchen beruhigt.
Das wird ein seltsamer Tag. Nach dem Vergnügen blockiert – mitten auf der Strecke – der Leihwagen. Automatische Vollbremsung. Ohne Grund, kein Wildwechsel, nirgends ein Lebewesen. Ich entkupple, lege den ersten Gang ein, gebe Gas, der Motor jault: Und keinen halben Millimeter bewegen sich die Reifen. Viele Versuche. Pause, ich warte, wieder versuchen. Irgendwann hält ein Sattelschlepper. Der Fahrer probiert das Gleiche wie ich, doch nichts rührt sich. Er nimmt mich mit zum nahen Dorf, ich rufe den Autoverleiher an. Zwei Stunden später kommt Kristjan, der Mechaniker.
Ein peinlicher Augenblick. Der Chef setzt sich hinein und – fährt los. Er checkt hinten und vorn, bockt hoch, findet keine Spur für die Blockade. Ich fahre weiter. Kristjan meinte noch zum Abschied, ich solle unbedingt mit den „Huldufolk“ sprechen, den „hidden people“, die als Geister den Menschen bisweilen in die Quere kämen. Vielleicht wollte er mir helfen, nicht das Gesicht zu verlieren, aber in seinen Worten lag nicht die geringste Ironie. Isländer glauben an tausendundeins Gespenster, Wiedergänger, Trolle, Elfen, Astralwesen, Traumgesichter und eben – versteckt in allen Ecken und Enden des Landes – an das Huldufolk. Ich rede dann auch mit ihnen, von wegen Freundschaft und Völkerverständigung.
Der Hokuspokus hilft nicht. Eine Stunde später biege ich von der Ringstraße links ab, Richtung Dettifoss, dem gewaltigsten Wasserfall Europas. Die Straße ist für jeden Autoverkehr gesperrt, ich versuche es trotzdem. Ein Amazonaspfad nach der Regenzeit. Metertiefe Risse erfordern Umwege, Querfeldeinfahrten, langwierige Suche – zu Fuß – nach der geeigneten Spur. Bis ich in einem Flussbett, voll mit Schmelzwasser, badewannentief versinke. Huldufolk oder Torheit, ich will es nicht wissen. Nach langem Marsch erreiche ich einen Hof, jetzt passiert etwas typisch Isländisches. Der Bauer fängt an, ich antworte:
● Hello!
● I got stuck with my car.
● I can help you.
Wir nehmen den großen Traktor, das große Seil, den großen Hund. Zwanzig Minuten später – Sverrir fährt einfach in die Badewannen hinein – sind wir am Tatort. Der Retter kann sich ein Lächeln nicht versagen – also doch Blödheit – und zieht mich heraus. Als hätte ich heute nicht schon genug Fehler hinter mir, biete ich ihm Geld an. Sverrir schüttelt den Kopf.
Die Nacht verbringe ich auf Husey, ganz im Nordosten der Insel. Den 40 Hektar riesigen Bauernhof mit Schafen, Pferden, Robben und einem Gänserich führt Örn, der Lehrer, Farmer, Fischer und Geschichtenerzähler. Sein Hausgeist heißt Mori. Nicht blutrünstig, aber lästig, sagen sie.
Bis nach Mitternacht bin ich im Stall. Zicklein kommen zur Welt, der Bauer als Geburtshelfer, die Mütter schlecken ihre zitternden Jungen ab. Als ich endlich in der Koje liege, warte ich umsonst. Mori kommt nicht und die hübsche Anna, Örns Tochter, auch nicht. Okay, der Tag war gut, man darf nicht alles verlangen.
Die Ostküste entlang, über Seydisfjördur, weiter über Djupinvogur, bis runter nach Höfn. Ich denke an Laure in Paris. Letztes Jahr war sie Gast bei Örn, zum Abschied schrieb sie in sein „Gestabok“: „J’aime Husey, j’aime l’Islande, j’aime la vie.“ Oh, Laure, wie recht du hast.
Sensationelles Island. Fahren und staunen. Durch das Seitenfenster die Wildgänse beobachten, die ganz nah ein Stück mitfliegen. Geduldig doofen Schafen ausweichen. Zehntausend Stockfische riechen, die klappernd im Wind trocknen. Pferden nachblicken, die schön sind wie schöne Frauen. Einen toten (kleinen) Vulkan besteigen. Mit dem Schiff zu den Westmänner-Inseln tuckern und, ohne zu zögern – satter Seegang –, die gerade verdauten Käsebrote ins Meer prusten. Einen Leuchtturm besuchen und mit dem Leuchtturmmann reden. Neben einem Fluss sitzen, einmal den Mund halten und dem Geräusch des Wassers zuhören. An einem Heimatmuseum vorbeikommen und über 200 Jahre alte Präservative kichern. Blonden Mädchen zurücklächeln, die tonnenweise Mist ausfahren.
Wie sprachbehindert fühlt sich der Reisende. Man müsste ununterbrochen mit Superlativen um sich werfen, um vom Zauberland Island zu berichten. Beschreibe einer den Jökulsarlon, einen Gletschersee, in dem bizarrblaue Eisberge schwimmen. Eine eisige Orgie aus Schönheit und Wunder. Jedes Wort zerfällt zu Asche, kein Satz kann die Wahrheit erzählen.
Zurück zur Hauptstadt, mit einem kleinen Umweg. Eine knappe Autostunde entfernt liegt die „Blue Lagoon“. Schon von Weitem sieht man die weiß fauchenden Schlote, völlig gefahrlos, reiner Dampf. Die ganze Region wimmelt von kochend heißen, unterirdischen Quellen. Das Kraftwerk nutzt das, speist damit die Heizungen der Umgebung. Was übrig bleibt, wird täglich frisch in die Lagune gepumpt: eine Badeanstalt mitten im Lavafeld. Eine Pharaonenwonne. Den müden Leib ins milchblaue, hautwarme Wasser tauchen. Ihn liegen lassen und tot sein. Ich bin so lange tot, bis ich zwei sich küssen höre, ihre Schemen wahrnehme. Reflexartig kommen mir die wundersamsten Gedanken. Der weiche Boden, die Schwaden, die Körperwärme, die minimale Sichtweite, nicht auszudenken.
Letzter Abend in Reykjavík. Als ich vor drei Jahren zum ersten Mal auf Island war, traf ich Hilda. Unsere Freundschaft hat gehalten. Noch ein Pluspunkt in diesem Land: Die bürgerliche Moral liegt darnieder. Viele uneheliche Kinder, viele öffentliche Verhältnisse ohne Trauschein.
Hilda hat alles vorbereitet, der Koch im „Thrir Frakkar“ ist ein alter Freund von ihr, und ich bin bereit für den schweren Gang. Heute gibt es – ausnahmsweise für mich, da unzeitgemäß – „Thorrablot“, eine Art Dankessen für Thor, den Chefgott.
Einmal alle zwölf Monate, Ende Januar, bringen die Isländer es hinter sich. Um sich daran zu erinnern, wie gut es ihnen heute geht und wie mutig und radikal sich ihre oft hungerschmachtenden Vorfahren ernährten.
Es fängt an mit frischem Haifischfleisch. Eine Stinkbombe, penetrant wie ein Kübel Ammoniak, fürsorglich wird sofort „Brennivin“, der einheimische Lieblingsschnaps – Zweitname: „Svarta daudi“, Schwarzer Tod – mitserviert. Zwei Schafsköpfe folgen, einer hundert Tage in Molke eingelagert und hellhäutig, der andere dunkelschwarz abgesengt und gargekocht. Die Augen gelten als Delikatesse. Eine Blutwurst kommt noch, eine gebackene Schafsleber auch noch und – man würgt schon beim Zuhören – leicht angeräucherter Hammelhoden. Der Koch klopft mir freudestrahlend auf die Schulter, Hilda lächelt mitfühlend, ich denke an den berühmtesten Schriftsteller hierzulande, an Halldor Laxness’ Wahlspruch: „Ich schaff’s oder ich sterbe.“ Ich schaff’s.
Der zweite Teil des Abendessens gilt als Wiedergutmachung, isländische Küche als Glückseligkeit: Garnelen, Lachs, roher Walfisch, Eis mit Kiwi, Kaffee und hauchdünne Pfannkuchen.
Hinterher fahren Hilda und ich hinunter zum Hafen, Mitternachtssonne bewundern. Irgendwann will sie wissen, was mir in ihrem Land am besten gefallen hat. Ich muss nicht nachdenken, denn seit einer Woche weiß ich die Antwort. Es war kurz hinter Isafjördur, und Jon, der Autostopper, saß neben mir. Fast zwei Stunden redeten wir, und es war unüberhörbar, dass der 17-Jährige heftig an die jungen Isländerinnen dachte. „Und“, fragte ich, „wie soll sie aussehen, deine Lieblingsfrau?“ Und Jon antwortet, ohne zu zögern, als wäre alles längst beschlossene Sache: „Sie müsste eine Lederjacke tragen und lachen, wenn der Wind geht.“
„Interessant und durchaus unterhaltsam“
„Ich kann dieses Buch sehr empfehlen. Viele gesammelte, wirklich wunderschöne Reportagen.“
„›Bloßes Leben‹ ist ein Buch, das man nicht leicht aus der Hand legt, das man nicht ›nebenbei‹ liest, das man nicht, ohne berührt, ohne bewegt zu sein, ›konsumiert‹.“
„Das immerwährende Interesse an anderen Menschen und ihren Lebensumständen treibt Andreas Altmann vorwärts. Und uns beim Lesen.“
„Eine Art Best-of. Gar ein Vermächtnis? Eines jedenfalls haben die Texte gemein: Altmanns schonungslos unverblümten, oft humorvollen Stil.“
„Altmann versteht es wie nur wenige, Lesende teilhaben zu lassen an seinen Abenteuern, sie unmittelbar mit seinen Erlebnissen zu konfrontieren.“
„Es handelt sich um große Literatur, da immer existenzielle Fragen aufgeworfen werden. Zum Beispiel die nach dem wahren Leben. Sehr originell.“
„Das Buch ›Bloßes Leben‹ ist was es sein will; der Spiegel vieler im Leben oder einfach des Lebens. Mal ungeputzt, mal voller Kristallglanz. Immer aber von, mit und für Menschen.“
„Altmann gelingt es in seinen Reportagen, die Geschichte einzelner Menschen zu erzählen und dabei ein politisches oder soziologisches Panorama aufzufächern, er beschreibt ohne Pathos und dennoch berührend, die Geschichten sind spannend und voller Formulierungen, die nachwirken.“








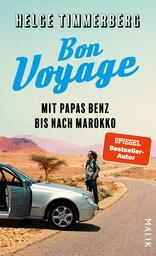


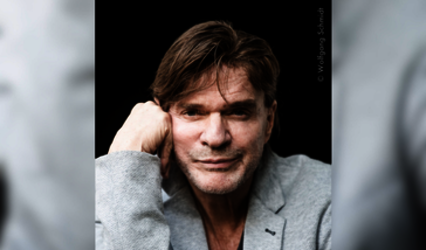



DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.