Produktbilder zum Buch
Working Class
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
„Ihr werdet es einmal schlechter haben!“
Die Generation nach den Babyboomern ist die erste nach dem Zweiten Weltkrieg, die ihre Eltern mehrheitlich nicht wirtschaftlich übertreffen wird. Obwohl die Wirtschaft ein Jahrzehnt lang wuchs, besitzt die Mehrheit in diesem Land kaum Kapital, kein Vermögen. Doch sich Wohlstand aus eigener Kraft zu erarbeiten ist schwieriger geworden, insbesondere für die, die heute unter 45 sind. Die Hälfte von ihnen fürchtet, im Alter arm zu sein. Was sind die Ursachen für diesen großen gesellschaftlichen Umbruch, wann fing es an?
»Die Geschichten berühren und sind…
„Ihr werdet es einmal schlechter haben!“
Die Generation nach den Babyboomern ist die erste nach dem Zweiten Weltkrieg, die ihre Eltern mehrheitlich nicht wirtschaftlich übertreffen wird. Obwohl die Wirtschaft ein Jahrzehnt lang wuchs, besitzt die Mehrheit in diesem Land kaum Kapital, kein Vermögen. Doch sich Wohlstand aus eigener Kraft zu erarbeiten ist schwieriger geworden, insbesondere für die, die heute unter 45 sind. Die Hälfte von ihnen fürchtet, im Alter arm zu sein. Was sind die Ursachen für diesen großen gesellschaftlichen Umbruch, wann fing es an?
„Die Geschichten berühren und sind aufrüttelnd erzählt.“ Berliner Zeitung
Julia Friedrichs spricht mit Wissenschaftlern, Experten und Politikern. Vor allem aber begleitet sie Menschen, die dachten, dass Arbeit sie durchs Leben trägt, die reinigen, unterrichten, Tag für Tag ins Büro gehen und merken, dass es doch nicht reicht. Sie sind die ungehörte Hälfte des Landes. Dieses Buch erzählt ihre Geschichte.
„Friedrichs analysiert präzise, nah an den Menschen dran, frei von Polemik oder Sozialkitsch.“ 3sat „Kulturzeit“
„Ein Buch, das aufrüttelt und das endlich die in den Mittelpunkt stellt, die zum Reichtum des Landes zwar beitragen, davon aber kaum profitieren.“ MDR Kultur
Über Julia Friedrichs
Aus „Working Class“
Prolog
Schon vor der Pandemie gab es Tage, an denen ich mir sicher war, den Knall überhört zu haben. Den Knall, den man hört, wenn ein Band reißt, das alles zusammenhält. Wer ständig Fußball schaut wie ich, wird immer wieder Zeuge dieses Knalls. Vor zwei Jahren zum Beispiel, als bei einem Auswärtsspiel meines Teams Werder Bremen in Dortmund unser Flügelspieler Fin Bartels in der 33. Minute nach einem harmlosen Zweikampf zu Boden ging: ein unabsichtlicher Tritt in die Hacke, ein Sturz, ein Knall, hin war die Achillessehne, die Fuß an Bein bindet und ohne die kein [...]














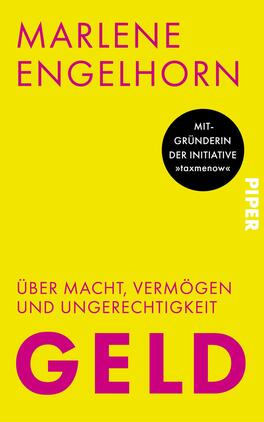
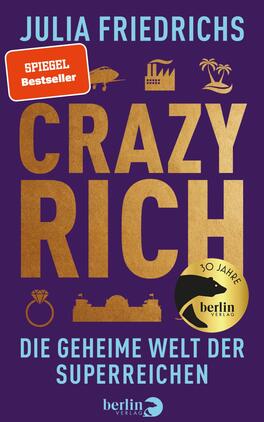
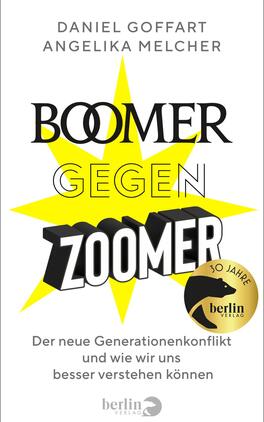

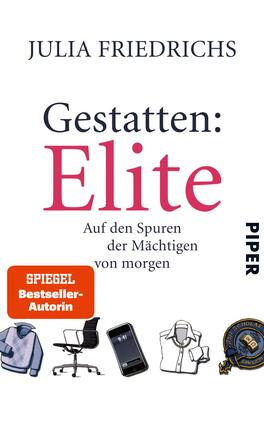
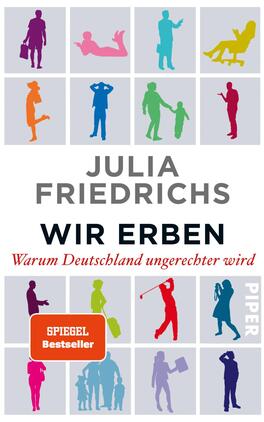

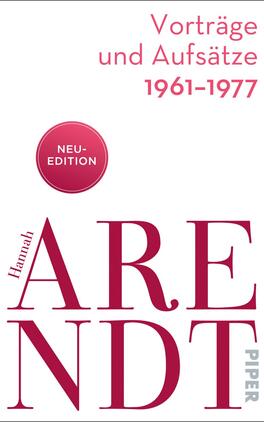







Die erste Bewertung schreiben