Produktbilder zum Buch
Vom Glück, mit dem Wind zu leben
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Was für eine Liebeserklärung schreibt Renske Jonkman doch über den Wind.“
Revue der WocheBeschreibung
Renske Jonkman lebt hinterm Deich, auf dem flachen Land, wo der Wind freies Spiel hat. Mitreißend schreibt sie über ihre Verbundenheit mit dem aufbrausenden Element. Über ihre Kindheit in den westfriesischen Poldern, die heranrollenden Wolken beim Surfen mit ihrem Bruder und die Freude ihrer Kinder beim Fahrradfahren im Gegenwind.
Denn für die Niederländer gibt es nichts Erfrischenderes als uitwaaien: vorgebeugt gegen den Sturm anzulaufen und sich den Kopf freipusten zu lassen – um Kraft und Inspiration zu finden oder auch den Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen zu überwinden.
»Ver…
Renske Jonkman lebt hinterm Deich, auf dem flachen Land, wo der Wind freies Spiel hat. Mitreißend schreibt sie über ihre Verbundenheit mit dem aufbrausenden Element. Über ihre Kindheit in den westfriesischen Poldern, die heranrollenden Wolken beim Surfen mit ihrem Bruder und die Freude ihrer Kinder beim Fahrradfahren im Gegenwind.
Denn für die Niederländer gibt es nichts Erfrischenderes als uitwaaien: vorgebeugt gegen den Sturm anzulaufen und sich den Kopf freipusten zu lassen – um Kraft und Inspiration zu finden oder auch den Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen zu überwinden.
„Vergesst ›Hygge‹, es ist Zeit für ›Uitwaaien‹!“ Washington Post
Poetisch und inspirierend zeigt uns dieses sehr persönliche Buch auf, wie beruhigend und heilend die Natur sein kann. Ein Plädoyer fürs Draußensein und Durchatmen.
„Dieses Buch ist ein Plädoyer dafür, sich den Naturkräften auszusetzen, sich zu spüren: den Rhythmus der Schritte bei einem Spaziergang, den Herzschlag, das Blut in den Adern. Es zeigt uns, was wir finden, wenn wir uns von den Nachrichten auf unserem Bildschirm verabschieden. Dieses Buch bringt uns nicht nur in Bewegung, es bringt uns vor die Tür.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung
Über Renske Jonkman
Aus „Vom Glück, mit dem Wind zu leben“
Vorwort
Ich hatte vergessen, wie heftig der Wind hier weht.
Im Winter 2015 luden wir unseren Hausrat in den Viehtransporter meiner Schwiegereltern, verließen Amsterdam und zogen mit der Familie aufs flache Land Nordhollands, in einen alten Bauernhof, mit einem Zwischenmietvertrag über ein Jahr. Acht Jahre später wohnen wir immer noch hier.
Das ländliche Holland und insbesondere das zwischen Nordsee und Ijsselmeer gelegene Westfriesland, wo ich aufgewachsen und wohin ich nach zehn Jahren wieder zurückgekehrt bin, liegt mehrere Meter unter dem Meeresspiegel und ist so [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Dieses Buch ist ein Plädoyer dafür, sich den Naturkräften auszusetzen, sich zu spüren (…) Dieses Buch bringt uns nicht nur in Bewegung, es bringt uns vor die Tür.“
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung„Da bekommt man Lust darauf, selbst auch bei Regen und Kälte nach draußen zu gehen.“
(A) Ursache/Wirkung„Was für eine Liebeserklärung schreibt Renske Jonkman doch über den Wind.“
Revue der WocheVorwort
Erster Teil
Wenn der Wind aufkommt
Flachländerbeine
Kumuluswolken
Gleichgewicht
Windsurfen
Müller
Aufgedreht
En plein air
Stille Stunden
Weißes Rauschen
Zweiter Teil
Sturm
Himmel
Wild
Abschlussdeich
Nase im Wind
Etersheim
Der Fliegende Holländer
Dreifachsturm
Tessel
Nase im Wind
Ich war ihr Haus
Dritter Teil
Abflauen
Kontrolle
Brachland
Heißluftballon
Holländische Frösche
Fallen
Auf, in die Welt hinaus
Anmerkung
Bibliografie
























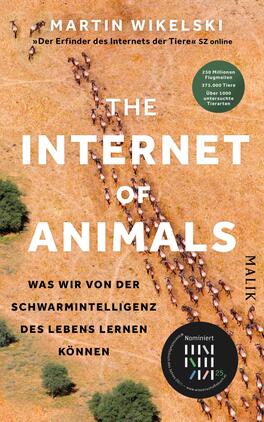


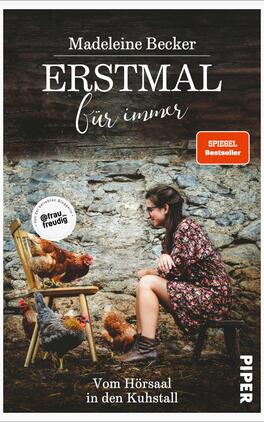







Die erste Bewertung schreiben