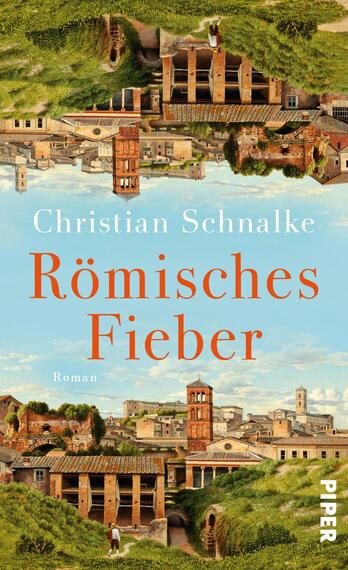
Römisches Fieber - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Christian Schnalke hat die Biografien der Rom- Reisenden des 19. Jahrhunderts aufwendig recherchiert, lässt den Dichter Friedrich Rückert, den Maler Carl Fohr oder die wunderbare Caroline von Humboldt wieder lebendig werden. Die Biografien dieser realen Personen verbindet er in seinem actionreichen Roman mit denen erfundener Figuren und zeichnet das Lebensgefühl im damaligen Rom sehr anschaulich.“
Nürnberger NachrichtenBeschreibung
1818. Franz Wercker, dessen Traum es immer war, Schriftsteller zu sein, flieht vor einer unseligen Familiengeschichte. Als ihn am Gardasee die Kräfte verlassen, will er seinem Leben ein Ende setzen. Die zufällige Begegnung mit dem jungen Dichter Cornelius Lohwaldt, der mit einem Stipendium des bayerischen Königs auf dem Weg nach Rom ist, ändert alles: Franz nimmt seine Identität an. In Rom taucht er ein in die Gemeinschaft deutscher Künstler - junger, begeisterter Enthusiasten, die fern der Heimat hart arbeiten und glücklich leben. Franz findet Freunde, erlebt amouröse Abenteuer - und verliebt…
1818. Franz Wercker, dessen Traum es immer war, Schriftsteller zu sein, flieht vor einer unseligen Familiengeschichte. Als ihn am Gardasee die Kräfte verlassen, will er seinem Leben ein Ende setzen. Die zufällige Begegnung mit dem jungen Dichter Cornelius Lohwaldt, der mit einem Stipendium des bayerischen Königs auf dem Weg nach Rom ist, ändert alles: Franz nimmt seine Identität an. In Rom taucht er ein in die Gemeinschaft deutscher Künstler - junger, begeisterter Enthusiasten, die fern der Heimat hart arbeiten und glücklich leben. Franz findet Freunde, erlebt amouröse Abenteuer - und verliebt sich in eine junge Malerin. Doch als sich Lohwaldts Schwester Isolde auf den Weg nach Rom macht, um ihren Bruder zu suchen, droht das mühsam errichtete Lügenkonstrukt einzustürzen. Als ein Mord geschieht, zieht sich die Schlinge um Franz zusammen...
„Liebevoll, gleichwohl mit trockenem, manchmal bösem Humor und einer feinen Ironie erzählt — mein Freund Christian Schnalke hat einen grandiosen Roman geschrieben.“ Volker Kutscher
Über Christian Schnalke
Aus „Römisches Fieber“
Franz Wercker schleppte sich die letzten Schritte bis zum Ufer. Seine Beine zitterten, sein Magen verkrampfte sich, Hände und Knie waren aufgerissen vom Rennen, vom Stürzen, vom Klettern, vom Kriechen. Die Streifen seines schwarzen Mantels, die er nach und nach abgerissen hatte, um damit die Fetzen seiner zerlumpten Schuhe zusammenzuknoten, ringelten sich um seine schmerzenden Füße, als ob sich das Schlangengezücht seiner Vergangenheit in seine Fersen verbissen hätte. Vor ihm glitzerte im Licht des spitzen und scharfkantigen Mondes der fantastische See, zu beiden [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Schnalke liebt das pralle Erzählen, in dem die Farben kräftig leuchten. Die bildmächtigen Schilderungen und die Tempowechsel mögen Hinweise darauf sein, was Schnalke als erfolgreicher Verfasser von Drehbüchern gelernt hat.“
Kölner Stadt-Anzeiger„(Eine) anregende, spannungsvolle, aber auch bildungssatte Lektüre.“
Badische Neueste Nachrichten„Christian Schnalke legt seine Protagonisten vielschichtig an und nutzt den schnellen Tempuswechsel, um die Spannung hochzuhalten. Das Schicksal Werckers lässt den Leser von der ersten Zeile an nicht mehr los. (…) Fast ganz nebenbei hält Schnalke eine kulturhistorische Geschichtsstunde ab.“
Aachener Zeitung„Der Roman (…) ist fantasievoll, träumerisch, manchmal märchenhaft, manchmal abenteuerlich, doch zeigt er auch die zerstörerischen Kräfte des Menschseins. Er ist in einer beeindruckenden Sprache geschrieben.“
buntegespinste.wordpress.com„In ›Römisches Fieber‹ gelingt es Christian Schnalke, auf sehr authentische Weise die Sprache der deutschen Klassik zu sprechen, sein umfangreiches Personal emotional und facettenreich zu präsentieren, seelische Stimmungen und landschaftlich-städtische Atmosphären quicklebendig darzustellen. Man meint fast, im Rom des ganz frühen 19. Jahrhunderts unterwegs zu sein (…).“
Wuppertaler Rundschau„Christian Schnalke verbindet in seinem lockeren Sommerroman geschickt Klassikerhistorie und Krimi, Schauerromantik und Italien-Flair.“
Nordsee-Zeitung„Christian Schnalke hat die Biografien der Rom- Reisenden des 19. Jahrhunderts aufwendig recherchiert, lässt den Dichter Friedrich Rückert, den Maler Carl Fohr oder die wunderbare Caroline von Humboldt wieder lebendig werden. Die Biografien dieser realen Personen verbindet er in seinem actionreichen Roman mit denen erfundener Figuren und zeichnet das Lebensgefühl im damaligen Rom sehr anschaulich.“
Nürnberger NachrichtenChristian Schnalke, Ihr Roman „Römisches Fieber“ spielt 1818 in der deutschen Künstlerkolonie in Rom. Was hat Sie an diesem Schauplatz, an dieser Zeit gereizt?
Ich habe mich erst nur aus Neugier für dieses erstaunliche Rom-Phänomen interessiert: All die Künstler, die ein Jahr nach Rom gegangen sind - was haben die da genau gemacht? Wie muss ich mir ihre Tage vorstellen? Als ich anfing, ihre Lebenserinnerungen zu lesen, war ich vom ersten Moment an gefesselt - bis sich mein Büchertisch unter antiquarischen Büchern und Katalogen gebogen hat.
Die Hauptfigur Franz Wercker alias Cornelius Lohwaldt hat es nicht wirklich gegeben. Was im Roman ist Wahrheit, was ist erfunden?
Im Zentrum steht für mich das Wiedererleben dieser vergangenen Welt. Sämtliche Nebenfiguren erzählen ihre eigene wahre Geschichte, und bis in Details sind die Lebenserinnerungen der damaligen Künstler eingewoben. Weil es aber ein spannender Roman sein soll, habe ich ins Zentrum eine fiktive dramatische Handlung gestellt, die mir alle erzählerischen Freiheiten gibt - und die natürlich ihrerseits in Lebensläufen und Literatur des 19.Jhdt wurzelt. Als drittes stecken überall persönliche Erinnerungen. Sowohl die Verzweiflung als auch das Glück über einer Zeichnung sind erlebt. Obwohl historisch, ist dies die persönlichste Geschichte, die ich je geschrieben habe. Und auf beglückende Weise haben sich diese Elemente wie von selbst zu einem dramatischen Bogen gefügt.
Es tauchen also einige der von Carl Fohr im Caffè Greco skizzierten, realen Künstler in ihrem Roman auf. Welche?
Es sind so viele, die mir im Laufe der Arbeit lebendig geworden sind: Louise Seidler, die im Roman allerdings Clara Seidler heißt, weil sie sich etwas verselbständigt hat, natürlich Carl Fohr mit seinem Hund Grimsel, Rudolf Schadow, der unter seinem berühmten Vater leidet, Wilhelm Schadow, der im Bewusstsein seiner zukünftigen Bedeutung lebt, Kronprinz Ludwig von Bayern, Julius Schnorr von Carolsfeld, Peter Cornelius, die Nazarener um Friedrich Overbeck oder der Dichter Friedrich Rückert.
Wer ist Ihnen besonders ans Herz gewachsen?
Unsterblich verliebt habe ich mich in Caroline von Humboldt, die ich bei jeder Begegnung mehr bewundert habe. Aber der einzelne war mir nicht so wichtig. Was mich gepackt hat, war das Phänomen: Sich ein Jahr aus dem Leben ausklinken und sich selber finden. Seine Ideale nähren. Zugleich genießen und hart arbeiten. Im höchsten Maße Mensch sein.
Was ich dort in Rom gefunden habe, ist sehr modern: Dasselbe, das viele junge Leute erleben, die ein freiwilliges Jahr im Ausland machen oder Work and Travel. Und ich habe mein eigenes Lebensgefühl beschrieben, als ich mit meiner Frau zwei Jahre in Tokio gelebt und gearbeitet habe. Eine unbeschwerte, inspirierende und prägende Zeit.
Das Lebensgefühl, das den Roman durchdringt, ist also selber erfahren?
Ich liebe es, unterwegs zu sein - vielleicht schon seit ich als Kind im Internat war. Ich habe ein großes Heimweh nach fremden Städten. Ich schreibe auch am liebsten unterwegs: im Grünen, im Café, im Zug, in einem Park in Prag, mit dem Fahrrad irgendwo in Tokio, mit dem Mountainbike im Bergischen. Und vielleicht ist es gerade dieses Miteinander von Arbeit und Leben, das mich den Deutschrömern so nahe bringt.
Aber die Sehnsucht nach Rom war etwas Einmaliges, weil es ein längst vergangenes Rom ist, ein vergessener Flecken Land mit bedeutsamen Ruinen im Grünen. Eine wundersame Welt außerhalb der Zeit, die sich die damaligen Künstler selbst erfinden konnten. - Die schlafende Königin am Tiberstrande...
Ein wichtiges Motiv im Roman ist der Widerstreit zwischen Lüge und Wahrheit, am deutlichsten sichtbar an Franz‘ Zerrissenheit zwischen seinem wahren Ich und seiner falschen Identität…
Lüge und Wahrheit ist das Thema des Romans. Identität und Maske. Und damit zusammenhängend eben auch die künstlerische Selbstfindung. Kann ich Wahres schaffen, wenn ich in der Lüge lebe? Was ist mein wahres Wesen - das nach außen wirkende, oder das innere? - Daher übrigens auch das janusköpfige Motiv des Buchumschlags: die richtigen Verhältnisse und die verkehrten. Rom als wirkliche Stadt und Rom als Ideal. Identität und Maske. Wahrheit und Lüge. - Ein Thema, das mich immer wieder umtreibt, weil es wehtut, wenn man hier bohrt. Hier gelangt man an die Wurzeln. Und wir kämpfen ja täglich damit: Angefangen vom Bild, das wir im Berufsleben von uns aufbauen, über den Mut zur Wahrheit in persönlichen Beziehungen bis hin zu sozialen Medien und Fake-News.
„Die deutschen Künstler in Rom – das darf man ohne Weiteres behaupten – sind vielleicht das glücklichste Völkchen unter der Sonne. Inmitten dieser unvergleichlichen Umgebung, voll von Plänen, Hoffnungen und Entwürfen…“ (E. Eckstein)
Ihren Schlüsselloch-Blick auf spannende historische Momente kennt man bereits aus einigen ihrer bekanntesten TV-Drehbücher. Sie arbeiten gerne in der Vergangenheit?
Es zieht mich immer wieder. Denn die Sache mit der Zeit ist ja noch viel vertrackter: Wir haben nicht nur die aktuelle Zeitebene des Schreibens und Lesens und die von 1818, die wir betrachten. Der Reiz Roms lag ja damals im Erspüren einer untergegangenen Welt. Sogar die Renaissance, die die Ruinen der Antike bereits so reizvoll vereinnahmt hatte, war längst Vergangenheit. Darüber hinaus weiß ich, was mit einigen der beschriebenen Charaktere später passiert ist. Ich kenne ihre damalige Zukunft - was ich beim Dramatisieren der damaligen Gegenwart habe einfließen lassen.
Wie unterscheidet sich für Sie das Schreiben für einen Film und an einem Roman?
Auch bei meiner Fernseharbeit habe ich immer schon besondere Geschichten auf meine Art schreiben können. Wie erzählt man Krupp? Wie erzählt man Luther? Wie erzählt man den Ersten Weltkrieg in Deutsch-Ostafrika? Diese Fragen habe ich auf eine sehr persönliche Weise selber beantworten müssen und dürfen. In jeder dieser Geschichten steckt viel von mir selbst. Der Unterschied zum Roman liegt vor allem in der Arbeitsweise. Wenn ich die Menschen verstanden habe, wenn ich ein Gefühl für die Welt habe, dann konstruiere ich einen Film aus der Dramaturgie heraus. Das ist disziplinierte Arbeit.
Und den Roman zu schreiben, war keine Arbeit?
„Römisches Fieber“ zu schreiben, war reine Lust. Durch den Fluss der Sprache hat sich morgens ein magisches Tor geöffnet, und ich war 1818 in Rom. Wenn ich mit Franz und Georg im Schatten einer Hecke saß und ihre Unterhaltung mitgeschrieben habe, musste ich irgendwann die Füße einziehen, weil die Sonne gewandert ist, also habe ich das aufgeschrieben. Ich saß in der Campagna und habe den Wind gefühlt, an warmen Abenden am Trevibrunnen das Brot geschmeckt. Wenn ich nachmittags das Tor nach Rom wieder geschlossen habe und in die (viel unwirklichere) Welt 2018 zurückkehren musste, habe ich mit Herzklopfen und Sehnsucht auf den nächsten Morgen gewartet.
Hätte „Römisches Fieber“ auch ein Drehbuch werden können?
Es ist durch und durch ein Roman: Das Schwebende, Ideale und Sehnsuchtsvolle dieser Welt kann nur mit Sprache erfasst werden. Mit Metaphern und Sprachbildern. Jeder Stein und jeder Weg, die Freundschaften und natürlich die künstlerische Arbeit sind aufgeladen mit Bedeutung, mit Mehrdeutigkeit, mit Emotionen und Sehnsüchten. Es spielt im Grunde keine Rolle, die Bilder, die damals gemalt wurden, zu sehen, ich wollte ihre Bedeutung beschreiben, die Umstände, unter denen sie entstanden sind. Und die setzen sich aus so vielem zusammen: Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken - ich schreibe nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem ganzen Körper. Und ich hoffe, dass der Leser RÖMISCHES FIEBER auch mit dem ganzen Körper liest.




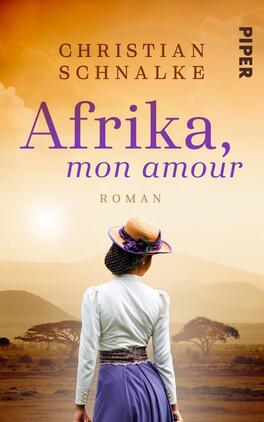





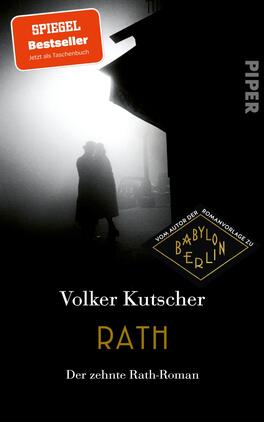
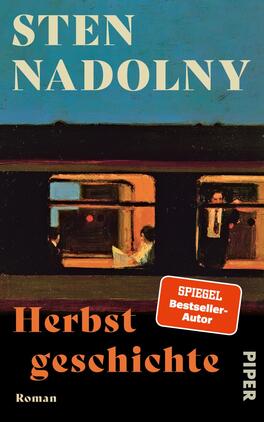


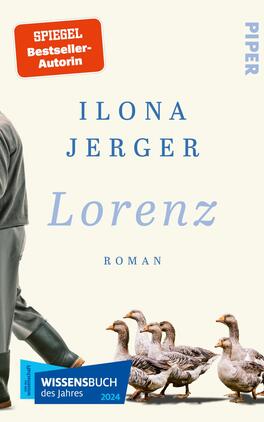
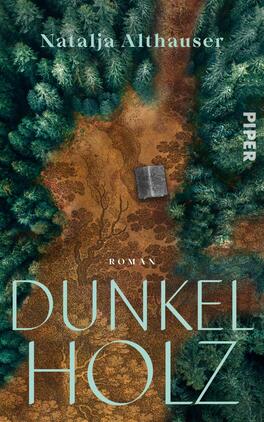



Die erste Bewertung schreiben