
Nach Seepferdchen tauchen
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Ein Buch voller Denkanstöße.“
myselfBeschreibung
Die Neuropsychologin Ylva Østby und ihre Schwester, die Autorin Hilde Østby, begeben sich auf eine Reise in die Welt der Erinnerungen und des Gedächtnisses. Ebenso unterhaltsam wie kompetent zeigen sie, wie Erinnerungen unser Leben lenken, wie sie sich beeinflussen lassen und unsere Identität prägen. Sie erzählen aus der Wissenschaftsgeschichte und sprechen mit weltweit führenden Experten der Gedächtnisforschung. Vor allem aber beleuchten sie die persönlichen Geschichten von Menschen, die deutlich machen, wie das Erinnerungsvermögen unser Leben bestimmt: Wind, der sich an nichts vor jenem Tag…
Die Neuropsychologin Ylva Østby und ihre Schwester, die Autorin Hilde Østby, begeben sich auf eine Reise in die Welt der Erinnerungen und des Gedächtnisses. Ebenso unterhaltsam wie kompetent zeigen sie, wie Erinnerungen unser Leben lenken, wie sie sich beeinflussen lassen und unsere Identität prägen. Sie erzählen aus der Wissenschaftsgeschichte und sprechen mit weltweit führenden Experten der Gedächtnisforschung. Vor allem aber beleuchten sie die persönlichen Geschichten von Menschen, die deutlich machen, wie das Erinnerungsvermögen unser Leben bestimmt: Wind, der sich an nichts vor jenem Tag in seinem 27. Lebensjahr erinnert, an dem er in einem Zug in China „aufwachte“; Adrian, der als Überlebender des Terrorangriffs auf Utøya lernen musste, wie man traumatische Erinnerungen bezähmt; Judy, die sich als Taxifahrerin mühelos im Labyrinth der Straßen Londons zurechtfindet; oder Asbjørn Rachlew, der als Kriminalbeamter die Psychologie des Erinnerns studierte und die Rechtsprechung eines ganzen Landes gerechter machte. Für ein Experiment schicken sie zehn Taucher auf den Grund des Oslofjords, und sie versuchen sich sogar daran, gezielt falsche Erinnerungen zu erzeugen. Am Ende des Buches geht es um unsere Zukunft – denn auf sie Einfluss zu nehmen, ist der eigentliche Grund, warum wir ein Gedächtnis haben.
„Ein faszinierendes Leseabenteuer, das einem wahrlich die Augen öffnet!“ Maja Lunde, Autorin des Bestsellers „Die Geschichte der Bienen“
Über Hilde Østby
Über Ylva Østby
Aus „Nach Seepferdchen tauchen“
Kapitel 1
Das Seeungeheuer
Oder: Die Entdeckung des Hippocampus
Das Gedächtnis ist etwas Schreckliches; der Mensch vergisst – es vergisst nie. Es sortiert die Dinge und legt sie ab. Es bewahrt sie für einen auf, oder es verdeckt sie vor einem – und ruft sie einem wieder in Erinnerung, ganz wie es ihm passt. Man denkt, man besitzt ein Gedächtnis, doch das Gedächtnis besitzt den Menschen!
John Irving, Owen Meany
Tief unten auf dem Meeresgrund, den Schwanz um das Seegras geschlungen, schaukelt er in der Strömung gleichmäßig hin und her. Dort hält er Wache, der [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Eine Wissenschaftsgeschichte, die klug erklärt, warum wir für die Gestaltung unserer Zukunft auf unser Gedächtnis angewiesen sind.“
RBB zibb„Sehr anschaulich und klug aufgeschrieben.“
P.M. Magazin„Das Buch entwickelt (…) große, geradezu existenzielle Intensität.“
NZZ Bücher am Sonntag (CH)„Unterhaltsam und verständlich zeigen sie, wie Erinnerungen konstruiert werden.“
Hannoversche Allgemeine Zeitung„Ein faszinierendes Buch über das Gehirn.“
Zeit für Mich„Ein Buch voller Denkanstöße.“
myselfInhalt
Kapitel 1
Das Seeungeheuer
Oder: Die Entdeckung des Hippocampus
Kapitel 2
Nach Seepferdchen tauchen im Februar
Oder: Wo findet das Denken im Gehirn statt?
Kapitel 3
Die letzten Gedanken einer Fallschirmspringerin vor dem Sprung
Oder: Was versteht man unter autobiografischen Erinnerungen?
Kapitel 4
Das Kuckuckskind
Oder: Wie sich falsche Erinnerungen in das Gedächtnis schleichen
Kapitel 5
Das große Taxi-Experiment und eine ungewöhnliche Schachpartie
Oder: Wie gut lässt sich das Gedächtnis trainieren?
Kapitel 6
Der Elefantenfriedhof
Oder: Das Vergessen
Kapitel 7
Das Saatgut-Depot auf Spitzbergen
Oder: Eine Reise in die Zukunft
Rezeptur für schöne Erinnerungen
Oder: Ein Dank an alle Beteiligten
Anmerkungen







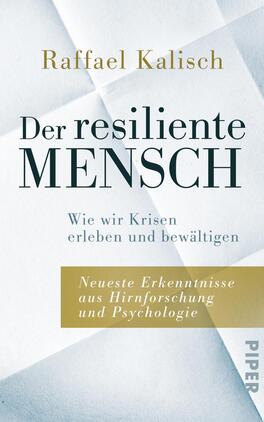


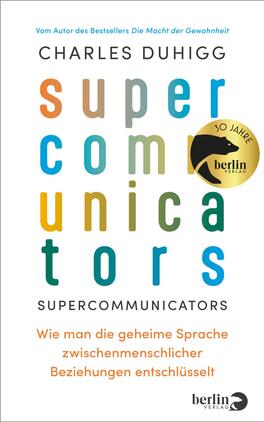



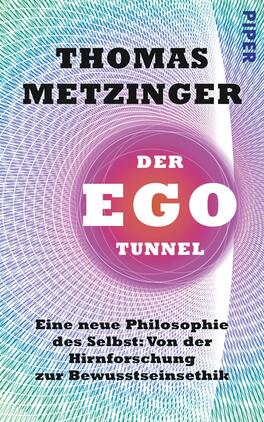


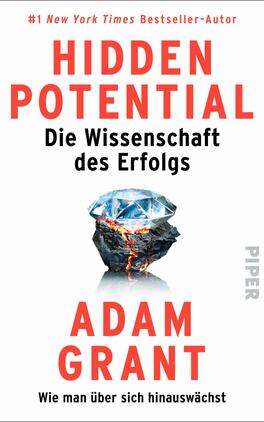



Die erste Bewertung schreiben