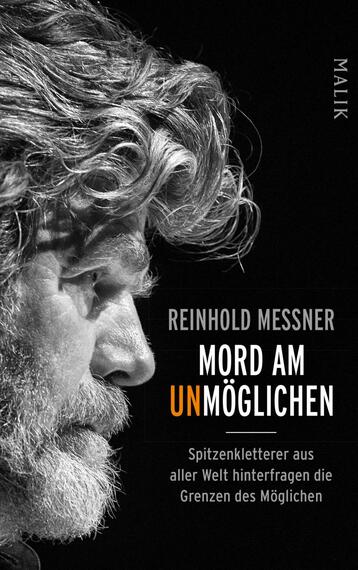
Mord am Unmöglichen
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Auch wenn die wenigsten Leser Kletterer sein werden, für alle Bergfreunde ist das Buch ein ebenso spannender wie aufschlussreicher Überblick über die Tendenzen in der heutigen Kletter-Szene und ihre möglichen Folgen.“
Neue WestfälischeBeschreibung
1968, im Jahr der Studentenrevolution, vollzieht sich auch beim Felsklettern eine bemerkenswerte Veränderung: Reinhold Messner gelingt am Heiligkreuzkofel in den Dolomiten seine schwierigste Erstbegehung; im Yosemite Valley ruft Royal Robbins das „clean climbing“ aus. Erst zehn Jahre zuvor waren das technische Klettern in Mode gekommen und die Direttissima an der Nordwand der Großen Zinne und die Nose am El Capitan als Nonplusultra gefeiert worden.
Mit seinem Aufsatz „Mord am Unmöglichen“ lanciert der 23-jährige Messner 1968 einen glühenden Appell zum Verzicht auf technische Hilfsmittel,…
1968, im Jahr der Studentenrevolution, vollzieht sich auch beim Felsklettern eine bemerkenswerte Veränderung: Reinhold Messner gelingt am Heiligkreuzkofel in den Dolomiten seine schwierigste Erstbegehung; im Yosemite Valley ruft Royal Robbins das „clean climbing“ aus. Erst zehn Jahre zuvor waren das technische Klettern in Mode gekommen und die Direttissima an der Nordwand der Großen Zinne und die Nose am El Capitan als Nonplusultra gefeiert worden.
Mit seinem Aufsatz „Mord am Unmöglichen“ lanciert der 23-jährige Messner 1968 einen glühenden Appell zum Verzicht auf technische Hilfsmittel, andere folgen ihm. So entwickelt sich das Freiklettern fort, das sich später, nach der Öffnung der Schwierigkeitsskala, unaufhaltsam steigert.
Heute, fünf Jahrzehnte später, hinterfragen die besten Kletterstars in persönlichen Berichten Messners Thesen und erzählen die Kunst, schwierigste Berge und Felswände zu meistern, weiter. Und geben Messners Plädoyer eine zeitlose Dimension.
Mit über 40 Originalbeiträgen von:
Bernd Arnold - Hansjörg Auer – Hervé Barmasse – Tommy Caldwell – Yvon Chouinard – Matteo Della Bordella – Hazel Findlay – Mick Fowler – Maurizio Giordani - Alessandro Gogna – Yannick Graziani – Alex Honnold – Leo Houlding – Thomas Huber – Jost Kobusch – Igor Koller – Maryna Kopteva – Jurij Košelenko – David Lama – Jacopo Larcher – Heinz Mariacher – Pierre Mazeaud – Simone Moro – Adam Ondra – Fabio Palma – Franco Perlotto – Boyan Petrov – Marko Prezelj – Paul Pritchard – Markus Pucher – Ivo Rabanser – Marek Raganowicz – Angelika Rainer – Tom Randall – Ermanno Salvaterra – Stephan Siegrist – Marcin Tomaszewski – Nicola Tondini – Christian Trommsdorff – Simon Yates – Barbara Zangerl – Maurizio „Manolo“ Zanolla
Über Reinhold Messner
Aus „Mord am Unmöglichen“
Mord am Unmöglichen
1968 – 2018
Vor 50 Jahren – im Jahr 1968 – vollzieht sich in den Werten des Felskletterns ein Wandel, eine bemerkenswerte Veränderung: Reinhold Messner gelingt am Heiligkreuzkofel in den Dolomiten seine schwierigste Erstbegehung, während Royal Robbins im Yosemite Valley das „clean climbing“ ausruft.
1958, zehn Jahre zuvor, waren die Direttissima an der Nordwand der Großen Zinne und die Nose am El Capitan als Nonplusultra gefeiert worden und das technische Klettern in Mode gekommen: »Für uns sind Haken ein vollwertiger, hervorragender Ersatz für [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„› Mord am Unmöglichen‹ ist ein spannender Lesestoff über das Überwinden von Grenzen und das, was der Mensch schaffen kann.“
Heilbronner Stimme„Spannend, auch ohne eine Affinität zu Bergen.“
(A) Vorarlberger Nachrichten„Ein wertvolles und lesenswertes Buch der modernen Alpinliteratur.“
bergbuch.info„Auch wenn die wenigsten Leser Kletterer sein werden, für alle Bergfreunde ist das Buch ein ebenso spannender wie aufschlussreicher Überblick über die Tendenzen in der heutigen Kletter-Szene und ihre möglichen Folgen.“
Neue WestfälischeMord am Unmöglichen 1968 – 2018
Vorwort von Luca Calvi und Sandro Filippini
Einleitung
Direttissima oder Mord am Unmöglichen
ERSTER TEIL
1 Die ideale Linie von Vinatzer
– Interview mit Giuani Batista Vinatzer de Val von Egon Stuflesser und Adam Holzknecht
Die losen Blätter eines Buches
2 Stevia-Nordwandriss
Preuß, mein Kompass
3 Die Regeln des sportlichen Bergsteigens
Schülerspiele
4 Delagoturm-Nordwestwand
Das Nonplusultra
5 Direttissima in dieSackgasse
Im Geist der „ Achtundsechziger“
6 Mord am Unmöglichen
Identifikation mit dem Fels
7 Der Heiligkreuzkofel-Mittelpfeiler : Meine schwierigste Kletterei
– Nur vier Meter
– Die Untersuchung
Der Verzicht als Garant für die Zukunft
8 Extremer Fels in den Piccole Dolomiti
Winterbesteigungen und Solobegehungen
9 Alleinbegehung der Burél-Südwand
Totale Fokussierung
10 Sicherheit statt Sicherung
Die Unternehmung von Vinatzer und Carlesso
11 Rückkehr zum klassischen Alpinismus
Ein ganz eigenes Leben
12 An einem Tag über den Frêney-Zentralpfeiler
Die erste große Achttausender-Wand
13 Der siebte Grad
Eine Frage von Glück ?
14 Alles hatte mit einem Spiel begonnen
Die Mariacher-Variante
ZWEITER TEIL
Und nach 50 Jahren … kommt die Zukunft zu Wort
Bernd Arnold
Der lange Weg des Weges
Hansjörg Auer
Retten wir die Bergkultur
Hervé Barmasse
Weglassen, um zu bekommen
Tommy Caldwell
Vertrauen wir auf die Kreativität
Yvon Chouinard
Ein extrem aktueller Appell Matteo Della Bordella
Heutzutage geht es dem Drachen gut, doch …
Hazel Findlay
Die größten Herausforderungen werden immer in uns selbst liegen …
Mick Fowler
Die Bohrhaken sind der wunde Punkt
Maurizio Giordani
Der Wert des Unbekannten
Alessandro Gogna
Mord an der Fantasie
Yannick Graziani
Die Zeit vergeht, nichts jedoch ändert sich
Alex Honnold
Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum reduzieren
Leo Houlding
Die Zukunft liegt im Stil
Thomas Huber
Absteigen zu wissen, um aufsteigen zu können
Jost Kobusch
Es wird immer Neues zu entdecken geben
Igor Koller
Der Stil als Faktor der Unsterblichkeit
Maryna Kopteva
Die Schönheit sehen
Jurij Košelenko
Die erhöhte Entropie des Alpinismus
David Lama
Ein Traum, der vielleicht immer ein Traum bleiben wird
Jacopo Larcher
Zu viele Zahlen, zu wenig Abenteuer
Heinz Mariacher
Vom Mittelpfeiler bis zur Rückkehr der Bohrhaken
Pierre Mazeaud
Das Unmögliche – ein wundersames Mysterium
Simone Moro
Erforschung, die nährende Flamme der Evolution
Adam Ondra
Das Unmögliche ist – dem Frei klettern sei Dank – am Leben
Fabio Palma
Schluss mit den Klagen, ein Ja zu provisorischen Sternchen
Franco Perlotto
Die verheerende Wirkung der Sicherheit
Boyan Petrov ( 1973 – 2018 )
Unberührte Gebiete für die kommenden Generationen
Marko Prezelj
Töten wir das Ego
Paul Pritchard
Siegfried ist wieder in Diensten
Markus Pucher
Die Berge werden immer größer sein als wir
Ivo Rabanser
Die Welt der Neuzeit
Marek Raganowicz
Die Spreu vom Weizen trennen
Angelika Rainer
Viele Disziplinen, viele Arten des „ Unmöglichen “
Tom Randall
Der Mut, einen Schritt weiterzugehen
Ermanno Salvaterra
Patagonien – eine Festung unglaublicher Begehungen
Stephan Siegrist
Mord an der Passion durch die sozialen Medien
Marcin „ Yeti “ Tomaszewski
Der innere Konflikt desjenigen, der die Wand „ durchlöchert “
Nicola Tondini
Den Zweifel bestehen lassen, um den Drachen zu retten
Christian Trommsdorff
Das Unmögliche lebt, doch es kommen neue Gefahren
Simon Yates
Die Propheten des mehr als Möglichen
Barbara Zangerl
Den Schwierigkeitsgrad vergessen und sich langsam herantasten
Maurizio „ Manolo “ Zanolla
Die Unmöglichkeit, die eigenen Grenzen zu kennen
Bergsteigen und Physik
Schlusswort : Der Rest vom Unmöglichen






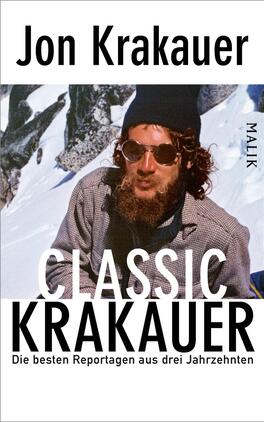


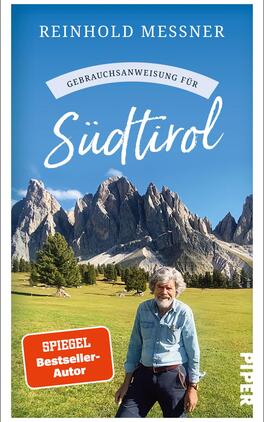





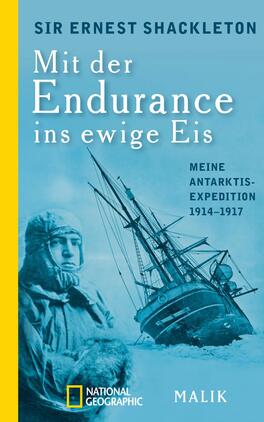




Die erste Bewertung schreiben