
Masel tov - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Sechs Jahre lang begleitet Margot Vanderstraeten die Kinder der jüdisch-orthodoxen Familie Schneider: Sie gibt Nachhilfestunden und Radfahrunterricht und tröstet in Krisensituationen. Besonders durch den engen Kontakt zu Tochter Elzira und Sohn Jakov bekommt Margot so immer tiefere Einblicke in eine verschlossene Welt, deren strengen Gebote und jahrhundertealte Traditionen die Studentin faszinieren und befremden. Auch als die Kinder das Elternhaus verlassen, bleibt Margot der Familie tief verbunden. In diesem Buch erzählt sie die Geschichte dieser besonderen und manchmal auch schwierigen…
Sechs Jahre lang begleitet Margot Vanderstraeten die Kinder der jüdisch-orthodoxen Familie Schneider: Sie gibt Nachhilfestunden und Radfahrunterricht und tröstet in Krisensituationen. Besonders durch den engen Kontakt zu Tochter Elzira und Sohn Jakov bekommt Margot so immer tiefere Einblicke in eine verschlossene Welt, deren strengen Gebote und jahrhundertealte Traditionen die Studentin faszinieren und befremden. Auch als die Kinder das Elternhaus verlassen, bleibt Margot der Familie tief verbunden. In diesem Buch erzählt sie die Geschichte dieser besonderen und manchmal auch schwierigen Verbindung – und liefert so ein Plädoyer für Offenheit und Toleranz, das in Zeiten von zunehmendem Antisemitismus und Fremdenhass wichtiger ist denn je.
Über J. S. Margot
Aus „Masel tov“
Teil I: 1987–1993
Eins
Es dürfte am Monatsanfang gewesen sein. Das neue Studienjahr hatte noch nicht begonnen, und ich kam gerade erleichtert von der Wiederholungsprüfung in spanischer Grammatik. Ich lief durchs Foyer des Universitätsgebäudes, ging an den Wandbänken vorbei, auf denen unzählige Studenten saßen, die quatschten und rauchten, und steuerte die Mensa an. Der Flur zur Mensa war spannender als viele Seminare. Überall an den Wänden Schwarze Bretter mit verlockenden Aushängen: „Wer tauscht seinen Vermieter gegen meinen?“, »Kommt jemand mit nach Barcelona? Ein [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Teil I
1987–1993
Teil II
1994–2000
Teil III
2001 – heute





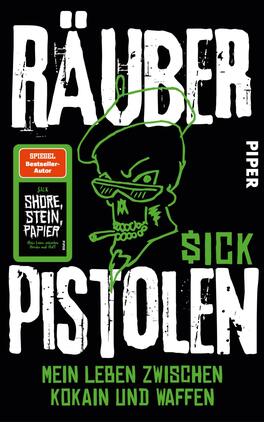
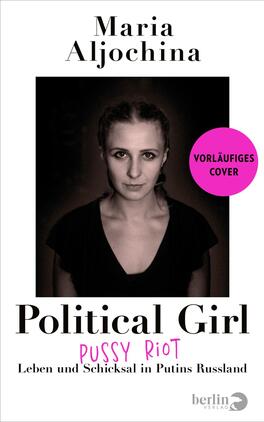
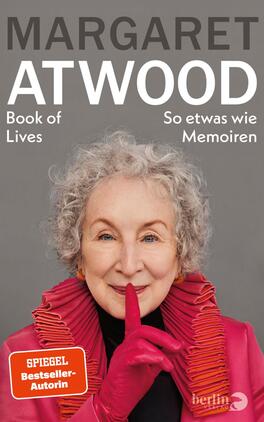


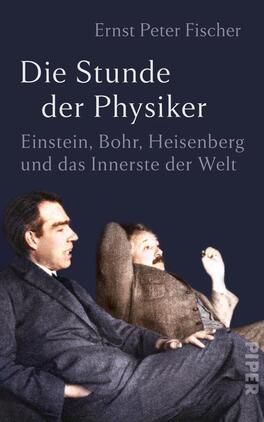




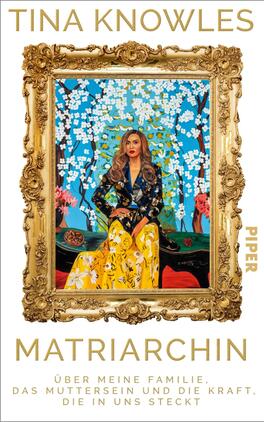

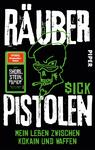

Die erste Bewertung schreiben