

Made in Germany Made in Germany - eBook-Ausgabe
Mein Leben für die Musik
— Biografie„›Made in Germany‹ macht eben auch unmissverständlich bewusst: das hier ist nicht Amerika, nicht die South Side, Harlem oder East St. Louis. Und der das schreibt, hat ganz andere Storys zu erzählen als solche, wie sie aus vielen Selbstdarstellungen, vor allem afroamerikanischer Künstler, nur so hervorsprudeln.“ - Frankfurter Allgemeine Zeitung
Made in Germany — Inhalt
Der berühmteste deutsche Jazz-Musiker
Klaus Doldinger ist der berühmteste deutsche Jazz-Musiker. Nachdem er als Kind über eine Gruppe amerikanischer GIs sein musikalisches Erweckungserlebnis hatte, gelang dem meisterhaften Saxofonisten, Komponisten und Produzenten eine seit über sieben Dekaden andauernde Weltkarriere. Doldinger nahm unzählige Alben auf und tourte um die ganze Welt. Er komponierte Filmmusik, legendäre Werbejingles und die Tatort-Melodie. Nun erzählt Klaus Doldinger erstmals seine gesamte Geschichte, von der Kindheit im Nationalsozialismus bis zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, von Passport bis Das Boot.
Leseprobe zu „Made in Germany“
1 schon früh auf tour
Wenige Wochen vor der Jazz-Epiphanie von Schrobenhausen war meine unbeschwerte Kindheit zu Ende gegangen. Zwar war es auch bis dahin nicht unbedingt eine Kindheit gewesen, die man nach heutigen Maßstäben als behütet bezeichnen würde, immerhin war Krieg. Aber mein kleiner Bruder und ich waren sehr glücklich gewesen, und bis heute habe ich nur die besten Erinnerungen an meine ganz frühen Jahre. Schrobenhausen war bereits unsere vierte Station. Geboren wurde ich am 12. Mai 1936 in Berlin. Mein Vater, Erich Doldinger, war dort als [...]
1 schon früh auf tour
Wenige Wochen vor der Jazz-Epiphanie von Schrobenhausen war meine unbeschwerte Kindheit zu Ende gegangen. Zwar war es auch bis dahin nicht unbedingt eine Kindheit gewesen, die man nach heutigen Maßstäben als behütet bezeichnen würde, immerhin war Krieg. Aber mein kleiner Bruder und ich waren sehr glücklich gewesen, und bis heute habe ich nur die besten Erinnerungen an meine ganz frühen Jahre. Schrobenhausen war bereits unsere vierte Station. Geboren wurde ich am 12. Mai 1936 in Berlin. Mein Vater, Erich Doldinger, war dort als Diplom-Ingenieur bei der damaligen Reichspost beschäftigt und kümmerte sich während der Olympischen Sommerspiele um die Kommunikationstechnik. Danach wurde er nach Köln versetzt. Ich kann mich kaum an den Kölner Dom erinnern, aber wenn ich heute in der Stadt bin, kommen mir immer noch manche Stellen am Rheinufer bekannt vor, an denen ich als Kind herumgestromert bin. Eigentlich begann mein bewusstes Leben aber erst in Wien.
Auch hierhin war mein Vater eine Weile später versetzt worden. Ich war gerade einmal vier Jahre alt und hatte schon in drei Städten gewohnt. Später habe ich einmal darüber nachgedacht, warum Tourneen mir immer relativ leichtgefallen sind, was längst nicht bei allen Kollegen der Fall ist. Meine Konzerte in über fünfzig Ländern der Welt habe ich stets geliebt, auch wenn ich danach ebenso gerne nach Hause zurückgekehrt bin. Das Reisen hat mir keinerlei Mühe bereitet, was – neben meiner Neugierde und der Liebe zur Musik – eventuell auch daran liegen könnte, dass ich bereits als Kind so viel herumgekommen bin.
Ich hatte also unbewusst schon einiges gesehen, als wir 1940 in der österreichischen Hauptstadt landeten. Wir lebten dort in einem fünfstöckigen Haus auf der Hohen Warte, mit Blick über die gesamte Stadt. Heute ist es schwer vorstellbar, aber die unmittelbare Umgebung dort war zu dieser Zeit noch überwiegend landwirtschaftlich geprägt, es gab Weinstöcke und grüne Hänge, ein Paradies für Kinder. Ohnehin fand ich Wien auf Anhieb enorm beeindruckend: das Riesenrad, die Donau, das Schloss Schönbrunn, die vielen Menschen überall – die Stadt war für mich und meinen 1941 geborenen Bruder Wolf-Dieter wie ein riesiger Abenteuerspielplatz. Das galt erst recht, nachdem mein Vater abermals versetzt wurde, diesmal an die Ostfront. Ich weiß bis heute nicht genau, was er dort gemacht hat. Er war wohl in einer technischen Sondereinheit in der Ukraine, deren Aufgabe es war, im Hinterland die Telefonleitungen intakt zu halten, um die Weitergabe von Frontinformationen zu gewährleisten. Wir haben meinen Vater während des Krieges jedenfalls kaum gesehen.
Damals etablierte sich ein Bild, das meine gesamte Kindheit und Jugend über Bestand haben sollte: Mein Vater war in erster Linie auf seine Karriere bedacht und permanent in geschäftlichen Dingen unterwegs, für die Familie blieb er ein Fremder. Mir kam seine Abwesenheit allerdings entgegen, denn Erich Doldinger erzog uns Kinder mit preußischer Strenge und führte ein eisernes Regiment. Meine Mutter, Ingeborg Doldinger, geborene Mann, hingegen war eine sehr positiv eingestellte Frau, ein fürsorglicher Mensch und eine gute Mutter. Sie stammte aus einem deutlich kultivierteren Umfeld als mein Vater. Durch die Tätigkeit meines Großvaters als Bürgermeister verkehrte ihre Familie nur in den höchsten Kreisen, während Erich Doldinger der Sohn eines einfachen Postbeamten aus Freiburg im Breisgau war.
Mein Großvater mütterlicherseits, Dr. Bruno Mann, stammte aus Frankfurt an der Oder und hatte in den stürmischen Zeiten im Nachgang der Novemberrevolution das Oberbürgermeisteramt der Stadt Erfurt übernommen, nachdem er zuvor bereits Zweiter Bürgermeister des damals noch nicht zu Berlin gehörenden Neukölln gewesen war. Während der Goldenen Zwanziger hatte er Erfurt zu wirtschaftlichem Aufschwung geführt, und nach allem, was ich weiß, war er von 1919 bis 1933 ein hervorragender Oberbürgermeister gewesen. Als dann mit der Weltwirtschaftskrise die ersten Wahlerfolge der NSDAP auch in Erfurt kamen, lieferte sich mein Großvater bis zu deren Machtübernahme manche Auseinandersetzung mit den Nazis. So wurde sich in meiner Familie erzählt, er habe Hermann Göring bei einer offiziellen Gelegenheit den Handschlag verweigert. Ich muss sagen, dass mir diese Geschichte unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt ausnehmend gut gefällt. Als gesichert gilt jedenfalls, dass Dr. Bruno Mann bald als unerwünschte Person eingestuft und von den Nazis in den Ruhestand gedrängt wurde. Er musste Erfurt verlassen und starb 1938 gramgebeugt im Alter von 64 Jahren in Eisenach, während seine Frau Selma ihn viele Jahre überlebte und nach dem Krieg als feine Dame der Gesellschaft vom früheren Status ihres Mannes profitierte.
Es ist nun eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet meine Mutter sich den Nazis als junge Frau zunächst zugewandt fühlte, vermutlich war das ihre Art von Protest gegen ihren Vater, sie empfand das wohl als eine Art avantgardistische Opposition. Kennengelernt hatten meine Eltern sich in Erfurt, wo mein Vater zu dieser Zeit beruflich zu tun hatte. Meine Mutter war von seiner Beweglichkeit beeindruckt, wie sie später erzählte. Er war in frühen Jahren ein sehr sportlicher Typ und Skifahrer gewesen, ein strebsamer, gut funktionierender Reichspostmitarbeiter, der zwar tendenziell eher rechts stand, ansonsten aber weitgehend unpolitisch war. Im Grunde war mein Vater ein Opportunist, dessen Handeln sich stets zuerst nach seiner Karriere richtete. Er war eine Weile in der Partei gewesen, aber bald wieder ausgetreten, weil er dem Führerkult der Nazis nicht viel abgewinnen konnte. Beruflich hat es ihm nicht geschadet, so weit ich das bezeugen kann.
Das Haus, in dem wir in Wien wohnten, gehörte vorher wahrscheinlich einer jüdischen Familie, die enteignet worden war. Klarheit haben wir über diesen Punkt nie erlangt. Mein Vater war zwar während der letzten Kriegsjahre immer im Hinterland, und ich bin davon überzeugt, dass er schon eine gewisse Ahnung hatte, was auf sämtlichen Ebenen damals passierte. Es gab in meiner Familie aber keine Auseinandersetzung und keine Gespräche über die Nazizeit. Insofern sind mir die politischen Implikationen dieser Jahre erst viel später klar geworden, als Kind habe ich davon nichts mitbekommen.
Ich war Gott sei Dank auch zu jung, um in der Hitlerjugend gewesen zu sein. Nachdem Hitler 1938 auf dem Heldenplatz den sogenannten Anschluss an das Deutsche Reich verkündet hatte, musste man in der Schule „Heil Hitler“ statt „Grüß Gott“ sagen. Wie ich heute weiß, spielte Österreich eine besondere Rolle in der Propaganda der Nazis, weil Hitler seine Heimat „heim ins Reich holen“ wollte, wie er es formulierte. Es gab viele Aufmärsche, die Nazis hielten Reden, das war durchaus präsent. Und mein Vater war als Reichspostmitarbeiter dafür verantwortlich, sich um technische Probleme bei diesen Veranstaltungen zu kümmern und Lautsprecher anzuschließen, was ich als Kind natürlich aufregend fand. Ich spürte allerdings keinerlei Ressentiments gegenüber Deutschen in Österreich. Ich bin zwar gebürtiger Berliner, aber durch die Breisgau-Linie hatten wir einen gewissen südlichen Einschlag und wurden nicht als Piefkes wahrgenommen. Einen Unterschied zu Deutschland konnte ich überhaupt nicht ausmachen als Kind, aber ich hatte in dieser Zeit auch kaum Kontakte nach Deutschland.
Bisweilen pflegten wir die Großeltern im Breisgau zu besuchen, aber Reisen waren damals beschwerlicher als heute, weswegen wir die meiste Zeit über in Wien blieben. Die Besuche bei den Großeltern waren für mich die totale Schwarzwaldidylle, mit Kirschwasser (nur für die Erwachsenen natürlich), Weintrauben und viel Wald. Außerdem hatten die Eltern meines Vaters ein Klavier, auf dem ich bereits als Kind wild herumimprovisierte. Mein Großvater war sehr agil und als Wandersmann bekannt. Ein honoriger, bodenständiger Typ, der überall beliebt war, sich für die Natur und den Schwarzwaldverein engagierte und am Feldberg Wanderwege anlegte. Heute gib es dort sogar einen „Doldinger-Felsen“. Während unserer Besuche dort war es mir ein Anliegen, möglichst viel Zeit mit ihm zu verbringen. Insbesondere für die damalige Generation war mein Großvater ein warmherziger, dem Leben zugewandter Mensch. Ein besonderes Verhältnis zwischen ihm und meinem Vater habe ich nicht feststellen können. Womöglich litt er darunter, dass sein Sohn ihn beruflich überflügelt hatte, ich selbst hatte jedenfalls ein herzlicheres Verhältnis zu meinem Großvater als zu meinem eigenen Vater.
Durch die Abwesenheit unseres Vaters hatten wir in Wien eine unbeschwerte Kindheit und konnten mehr oder weniger machen, was wir wollten. Das Haus hatte keinen Garten, wir durften aber überall spielen, und als ich eingeschult wurde, hatte ich einen sehr angenehmen und erlebnisreichen Schulweg mit Blick auf die Berge. Wir hatten eine Hausangestellte namens Roswitha, und über die klassische Musik meines Vaters kam ich bereits in frühen Jahren mit Mozart in Berührung. Musik hat mich von Anfang an begeistert. Jede Art von Musik in allen denkbaren Variationen. Ich erinnere mich an meine Kindheit in diesen Jahren insgesamt als friedlich und harmonisch, was aus heutiger Sicht absurd klingen mag, aber in Wien blieb es während der ersten Kriegsjahre vergleichsweise ruhig.
Die Intensität der Bombenangriffe nahm erst um 1943 herum deutlich zu. Wir hatten einen Luftschutzkeller, und bei Fliegerangriffen mussten wir immer schnell ins Haus kommen. Erfolgten die Angriffe nachts, wurden wir geweckt und rannten ebenfalls in den Keller. Komischerweise hatten Wolf-Dieter und ich aber nie Angst. Es war völlig normal, dass Bomber über der Stadt flogen, diese Angriffe waren für uns zu einem Teil der Kindheit geworden. Allerdings wurde auch niemals erklärt, weshalb Bomben fielen oder warum überhaupt Krieg war. Es war einfach so, das war der Normalzustand. Meine Mutter wirkte zwar mitunter ziemlich geschafft, aber ich habe sie in diesen Jahren niemals weinen sehen. So wuchsen wir also in einen ständigen Ausnahmezustand hinein. Einmal schlug direkt gegenüber von unserem Haus eine Bombe ein, während wir im Keller saßen, aber auch das schien nicht ungewöhnlich zu sein und wurde kaum weiter beachtet. Als wir den Keller wieder verließen, war das gegenüberliegende Haus beinahe komplett verschwunden, und es hatte Tote gegeben.
Es waren, wie ich heute weiß, die letzten Kriegstage. Mein Vater war längst über alle Berge, inzwischen war er nach einer Zwischenstation in Berlin nach Düsseldorf versetzt worden, wo er als Oberpostrat im zentralen Fernmeldebauamt arbeitete. Die Rote Armee stand vor Wien, und eines Nachts weckte uns die Mutter. Die Stimmung in der Stadt hatte sich infolge der vielen Bombenangriffe drastisch verschlechtert, als sogenannte Reichsdeutsche waren wir in Wien fortan unerwünscht und wurden aufgefordert, uns vom Acker zu machen. Das wurde uns Kindern aber damals nicht erklärt, meine Mutter sagte nur: „Es ist Krieg, wir müssen weg.“
Wir stiegen aus den Betten, packten eilig nur das Allernötigste zusammen und traten auf die Straße, wo bereits ein Holzgasmotorlaster wartete, Benzin war schon lange nicht mehr zu bekommen. Also kletterten meine Mutter, mein inzwischen vierjähriger Bruder, Roswitha und ich gemeinsam mit einer weiteren, uns unbekannten Familie auf die Pritsche des Fahrzeugs. Zwischen Führerhaus und Ladefläche war der Ofen angebracht, wir warfen unsere wenigen Klamotten dahinter auf die Pritsche und suchten uns einen Platz. Die Lichter des Westbahnhofs leuchteten hell, als wir Wien nach einem langen, kalten Winter bei trotz des Frühjahrs immer noch deutlich einstelligen Temperaturen verließen und uns auf den Treck gen Westen begaben.
Ich kann weder sagen, wie und von wem unsere Flucht aus Wien geplant wurde, noch, wie wir zu diesem Laster kamen, aber das Ziel unserer Reise, so viel wurde verraten, sollte die bayerische Ortschaft Schrobenhausen sein, wo offenbar ein Onkel Josef wohnte, der uns aufnehmen wollte. Vor uns lagen ungefähr 480 Kilometer, eine Entfernung, die einem heute nicht weit vorkommen mag, aber in der damaligen Zeit, zusätzlich erschwert durch die besonderen Umstände des Krieges, war es doch eine gewaltige Strecke. Wir gliederten uns in den endlosen Strom der Ost-Flüchtlinge ein, welcher vor dem Anmarsch der Roten Armee über Wien weiter nach Deutschland zog. Nach wenigen Kilometern fuhren wir an den russischen Truppen vorbei, die bereits unmittelbar vor Wien standen, später auf der Fahrt kamen uns französische und amerikanische Soldaten entgegen. Überall waren Menschen.
Wenn ich meine glückliche Kindheit in Wien und das schöne Haus, in dem wir gewohnt hatten, vermisst haben sollte, blieb jedenfalls keine Zeit, darüber traurig zu sein. Dafür fand ich die Flucht zu spannend, sie kam mir beinahe vor wie ein Abenteuer. Zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Lkw fahren zu dürfen empfand ich als Bereicherung. Dass der Laster wenig Platz und Komfort bot, war mir egal. Es waren Tausende von Menschen auf der Flucht, da waren wir vergleichsweise gut aufgehoben. Zudem waren wir mit einem Fahrer gesegnet, der sich auskannte und Wolf-Dieter und mich zwischendurch immer wieder einlud, bei ihm im Führerhaus zu sitzen. Immer wenn es auf der Strecke bergauf ging, mussten wir alle aussteigen und den Laster schieben. Mein Bruder lief dann zwanzig, dreißig Meter voraus und hielt nach potenziellen Hindernissen Ausschau. Merkwürdigerweise hatte ich auch auf diesem Flüchtlingstreck keine Angst, für mich war das alles, wie gesagt, wahnsinnig aufregend. Wir hatten wohl gelernt, mit dem Krieg zu leben.
Die Ruinen der zerstörten Städte überall auf dem Weg waren dennoch ein Schock. Als wir nach München kamen und die zerbombte Trümmerlandschaft passierten, aus der sich das arg lädierte Karlstor am Stachus wie ein Mahnmal zu erheben schien, dämmerte uns so langsam, wie sicher und bequem wir im Vergleich dazu in Wien gelebt hatten. Mindestens fünf Jahre waren wir der Zerstörung in kleinen Schritten immer näher gekommen, nun offenbarte sich das Drama des Krieges in seinem ganzen Ausmaß. Dennoch waren wir nicht deprimiert, und auch die meisten anderen Leute auf dem Treck schienen das nicht zu sein. Wir waren einfach nur froh, dass das alles nun endlich ein Ende hatte.
Als wir Schrobenhausen erreichten, war mein Onkel Josef nicht direkt beglückt, nun spontane Gäste zu haben, aber für eine Zeit lang durften wir dort bleiben. Auf mich wartete meine erste Begegnung mit dem Jazz – und danach noch so viel mehr, als ich damals auch nur ansatzweise hätte erahnen können.
2 nächster halt: düsseldorf
Plötzlich lebten wir in einer neuen Welt, und alles war wahnsinnig aufregend. Wir wohnten in der britischen Zone, und es fanden ständig überall Aufmärsche statt, die wir jedoch keineswegs als Bedrohung erlebten, die Briten begegneten uns Kindern freundlich und friedfertig. Sie waren für uns keine Besatzer, sondern Befreier, die Vorboten einer besseren Zukunft. Dabei war Düsseldorf unglaublich zerstört, die Stadt lag nahezu vollständig in Trümmern, aber dennoch herrschte ein schwer zu beschreibendes Klima der Zuversicht, ein Aufbruchsgeist. Ich fand das anfangs seltsam. Angesichts der Zerstörung überall im Land hatte ich allgemeine Niedergeschlagenheit erwartet, aber so habe ich es nicht erlebt. Wie die Menschen sich in diesen ersten Jahren nach dem Krieg an die Arbeit gemacht und alles wieder aufgebaut haben, hat mich in eine regelrechte Euphorie versetzt. Die Aussicht, nun in Düsseldorf neue Freunde zu treffen und in eine Gesellschaft zu gelangen, die uns wohltuend empfangen hatte, begeisterte mich. Bereits der rheinische Singsang klang ja fröhlich und dem Leben zugewandt.
Einige Monate zuvor war mein Vater nach Schrobenhausen gekommen, um uns abzuholen. Dem war eine längere Suche vorausgegangen, da er in den Wirren der letzten Kriegstage keinerlei Informationen über unseren Aufenthaltsort erhalten hatte. Er wusste allerdings von Onkel Josef und hatte uns dort schließlich auf eigene Faust gesucht und gefunden, nachdem er anderswo erfolglos geblieben war. Eines Tages kam er mit seinem Fahrer in einem Postauto auf den Hof gefahren und brachte uns auf einer abermals abenteuerlichen Fahrt durch das zerstörte Deutschland über nur streckenweise befahrbare Autobahnen und Landstraßen nach Düsseldorf.
Wie mein Vater es damals geschafft hat, vollkommen nahtlos bei der späteren Bundespost weiter Karriere zu machen, war mir lange ein Rätsel. Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass der Übergang nicht ganz so reibungslos erfolgt war, wie es den Anschein gehabt hatte, da er ja eine Weile in der NSDAP gewesen war. Dennoch wurde ihm von den Alliierten bald die Aufgabe übertragen, das völlig zerstörte Fernmeldewesen im neu zu gründenden Bundesland Nordrhein-Westfalen wieder auf die Beine zu stellen. Er war wohl einfach gut in seinem Beruf, technisch versierte Telekommunikationsexperten wie er wurden händeringend gesucht, alle wollten nach dem Krieg Telefon haben. Er stellte sich dann auch erstaunlich gut und schnell um, lernte Englisch und hatte in der britischen Zone jede Menge Arbeit. Über die Nazizeit hat er nie wieder gesprochen, man sprach damals überhaupt nicht besonders viel.
Wir wohnten in einem großen, dreckig gelb angestrichenen Gebäude, dem Fernmeldebauamt in der Gneisenaustraße, wo mein Vater Oberpostrat war. Mama, Papa, Brüderchen, die Sekretärin meines Vaters, Elsbeth Löffler, die über die Jahre eine Art Familienmitglied wurde, und ich. Und da sind wir dann in Trümmern aufgewachsen. Wir hatten zwar das Glück, dass wir eine Dienstwohnung in diesem Postamt hatten, aber nahezu alle anderen Gebäude in der Umgebung waren völlig zerstört. Die Schule gegenüber, das halbe Postgebäude, der zerbombte Bunker nebenan waren Ruinen und die Straßen von Schuttwällen gesäumt. Aber immerhin gab es genug zu essen.
Die Dienstwohnung war zentral im Postamt gelegen. In der vierten Etage war das Lehrlingsheim, darunter und darüber gab es weitere Dienstwohnungen, außerdem eine Waschküche und andere Nebenräume. Die Wohnung bestand aus einem schmalen, langen Flur, von dem alle Zimmer abgingen: ein Bad mit Wanne und Toilette, die Küche, das Zimmer von „Tante Elsbeth“, unser Kinderzimmer, das elterliche Schlafzimmer und das Wohnzimmer, der größte Raum der Wohnung. Dort wurde auch gegessen, außerdem gab es eine Couch. Für uns Kinder spielte vor allem der lange Flur eine entscheidende Rolle, weil man dort wunderbar spielen konnte. Auf den Gängen herrschte hektische Betriebsamkeit. Das Fernmeldebauamt hatte mehrere Hundert Mitarbeiter, die Kantine war auf der gleichen Etage wie unsere Wohnung, und die Bautrupps meines Vaters trafen sich morgens bei uns in der Küche, was für meine Mutter ziemlich anstrengend war.
Mein kleiner Bruder heißt bekanntlich Wolf-Dieter. Der Name Dieter wurde in Erinnerung an einen früh verstorbenen Bruder meiner Mutter gewählt, den sie sehr geliebt hatte. Warum mein Bruder nun ausgerechnet zwei Namen haben musste: keine Ahnung. Da hätte man meine Mutter fragen müssen, aber das habe ich leider nie getan. Zu Hause hieß er ohnehin nur „Wölfchen“, es gab aber noch andere Variationen, unter anderem schlicht und ergreifend „Wolfi“. Wir spielten drinnen, wie gesagt, gern im Flur, aber meistens spielten wir draußen in den Trümmern. Die Ruinen der umliegenden Gebäude waren bis zu fünf Stockwerke hoch, die Dächer fehlten oft, das war für uns wie ein riesiger Abenteuerspielplatz, auf dem wir unter anderem Feuer machten, um Kartoffeln garen zu können. Es gab dort regelrechte Banden, die gegeneinander kämpften, mit Zwillen und Steinen. Wir Trümmerkinder waren unruhig, aufgeregt, das war sicher auch der allgemeinen Stimmung der Zeit, dieser Mischung aus Aufbruch und Ungewissheit nach dem Krieg geschuldet. Es wurde sich jedenfalls häufig geprügelt, und vor den Steinschlachten musste man sich in Acht nehmen.
Ich war der draufgängerische Typ, während Wolfi zurückhaltender war. Er hing mehr an der Mutter, ich war eher dem Vater zugewandt. Im Hof des Fernmeldebauamts standen haufenweise ausrangierte Militärfahrzeuge, die man teilweise immer noch starten konnte. Es war uns ein Riesenvergnügen, ein paar Meter mit ihnen zu fahren und sie ineinanderkrachen zu lassen. Erwischen lassen durften wir uns dabei besser nicht, dann gab es vom Vater nämlich ein paar hinter die Ohren. Überhaupt brachte der Umzug nach Düsseldorf einen totalen Kulturwandel mit sich. Die Wohnung war stets vom Duft der Zigarren meines Vaters erfüllt, aber auch der Ton im Haus veränderte sich drastisch. Mein Vater duldete mit seiner autoritären preußischen Art keinen Widerspruch, es hatte zu geschehen, was er verlangte: „Du sprichst nur, wenn du gefragt wirst, du stehst nur auf, wenn es dir erlaubt wird“, das waren so die Sprüche. Eine gewaltige Umstellung, nachdem er in Wien niemals zugegen gewesen war und wir ein ziemlich freies Leben geführt hatten. Und natürlich musste immer der Teller aufgegessen werden, auch wenn es nicht schmeckte oder man überhaupt keinen Hunger hatte. Gewalt war sehr präsent, wenn ihm etwas nicht gefiel, gab es die Prügelstrafe.
Morgens wurden wir von meiner Mutter geweckt und mussten uns zügig fertig machen. Gefrühstückt wurde nicht immer zusammen, aber das gemeinsame Mittagessen war Pflicht. Am meisten liebte ich Suppen – die mag ich immer noch –, aber geschmacklich war ich breit aufgestellt. Solange es gut schmeckte, war ich einverstanden. Nach dem Essen hatte dann absolute Ruhe zu sein. Mein Vater kam um eins in die Wohnung und wollte sich eine Stunde ausruhen, da durfte man keinen Mucks von sich geben. Für uns waren das die freien Zeiten, die wir draußen zwischen den Trümmern verbrachten und zum Beispiel auf alten Kabeltrommeln balancierten. So war es jedenfalls zu Beginn, als der Unterricht noch permanent ausfiel. Der Schulbetrieb war noch nicht wieder richtig organisiert, das kam erst mit der Zeit. Wolfi und ich gingen auf die Volksschule, mit siebzig, achtzig weiteren Schülern pro Klasse. Eine gewisse aggressive Grundstimmung war normaler Bestandteil des pädagogischen Alltags: Wir verrückten Bänke oder spielten den Lehrern Streiche, sie schlugen uns. Wenn man nicht spurte, musste man vor die Klasse treten und bekam einen mit dem Stock übergezogen. Das hat mich aber nicht weiter irritiert, weil wir vom Vater ja auch geschlagen wurden. Ständig wurde überall gebrüllt, so war das damals.
Wann kamen Sie zum ersten Mal mit Jazz in Berührung und wie hat Sie das beeinflusst?
Meine erste Begegnung war witzigerweise nicht in irgendeinem rauchigen Jazzkeller in Düsseldorf, sondern viel früher in meiner Kindheit in einer kleinen Bayerischen Stadt Schrobenhausen. Nachdem wir aus unserer damaligen Heimat Wien fliehen mussten, sind wir für eine Weile bei einem Onkel in diesem kleinen urigen Ort untergekommen und dort war nebenan auch eine Gruppe von G.I.s untergebracht. Eines Abends bin ich dort die Straße entlanggelaufen und habe diese unglaublich bewegende neuartige Musik gehört, die aus einem Lokal erklang und ich mit meinem heutigen Wissen als eine kleine Swing-Kapelle identifizieren würde. Ich schaute durch das Fenster und sah diese amerikanischen Soldaten miteinander spielen und swingen und war ganz hin und weg von dieser Musik. Und dieser Funke blieb in mir meine ganze Jugend erhalten und entfachte meine Leidenschaft so etwas selbst einmal zu spielen zu können. Wie ein Ohrwurm, den man nicht mehr loswird, bis man das Lied wieder hört, habe ich mir diese Liebe glaube ich bis heute bewahrt.
Sie waren als Schüler an einem Konservatorium, in dem klassische Musik gelehrt wurde. Wäre auch ein Weg in die Klassik für Sie denkbar gewesen?
Klassische Musik habe ich, so sehr ich sie auch liebe, durch meine Begeisterung für Jazz nie wirklich als Hauptweg für mein künstlerischen Schaffen gesehen. Allerdings war diese Erziehung absolut die Basis für mein Grundverständnis von Noten und Harmonielehre und hat auch meine spätere Arbeit im Film sehr beeinflusstund war sogar fast unersetzlichfür Ihren Erfolg. Mich allerdings nur darauf zu konzentrieren wäre für mich zu beschränkend gewesen.
Schon in jungen Jahren lernten Sie erst Klavier, dann Klarinette und Sopransaxofon. Fiel Ihnen das Lernen immer leicht?
Leicht war es nicht, aber ich bin das Erlernen eines neuen Instruments immer sehr spielerisch angegangen. Vor allem beim Saxofon, welches ich mir selber beigebracht habe, bin ich das ganz nach Gefühl und Gehör angegangen,um so meinen eigenen Sound zu finden. Und solange das einem Spaßmacht, dann ist das auch nicht wirklich schwer. Das Schwierige ist bei den Blasinstrumenten eher das Erhalten des Ansatzes, was sehr regelmäßiges Üben abverlangt.
Ihr Vater hat sie zwar ans Konservatorium geschickt, aber er stellte sich für Sie dennoch eine solide Karriere als Ingenieur vor. Gab es zu Hause Konflikte?
Ja leider hat mein Vater den Berufsweg eines Musikers und Komponisten nie als potenzielle Zukunft für mich gesehen,sondern eher als eine Art Hobby. Noch dazu war mein Vater einzig und allein an klassischer Musik interessiert und meine Abenteuer in der neuen Deutschen Jazzszene sah er eher als einen Weg im „Tingeltangel“ zu enden. Allerdings hat mich das irgendwann einfach nicht mehr interessiert und wir hatten ein Ankommen, dass wenn ich mein Abiturschaffen würde und danach Toningenieurstudieren würde, dass ich dazwischen ein ganzes Jahr mein Musikerdasein ausleben könnte. Er dachte sich wahrscheinlich, dass ich danach vielleicht zu Sinnen kommen würde, aber das Gegenteil war Gott sei Dank der Fall. Leider war das bis zu seinem Tod immer ein Knackpunkt zwischen uns, den wir nie klären konnten, was ich sehr bedauere.
Erste Auftritte hatten Sie in Düsseldorf im „Czikos“. Was kann man sich darunter vorstellen?
Das Czikos war damals das erste ungarische Restaurant in Düsseldorf und war berühmt für das beste und schärfste Gulasch der Stadt. Außerdem war das Lokal ein Hotspot für die Intellektuellen und Künstler unserer Generation undder Besitzer war ein großerJazzfan. So spielten dort von den Abendstunden bis spät in die Nacht verschiedene Kombos und Musiker als Unterhaltung für die Gäste. Ein paar Jahre vor unserer Zeit spielte sogar Günther Grass am Hackbrett und wir als junge Musiker hatten dort eine Chance unser Talent vor einem kleinen Publikum zu beweisen und täglich zu verbessern. Wie spielten bis in die frühen Morgenstunden, sehr zum Ärger meines Vaters und bezahlt wurden wir anfangs nur mit einem Bier, einem Gulasch und siebzehn D-Mark, was selbst damals wirklich nicht viel war. Aber so lernten wir schon sehr früh ein Publikum zu erspüren und nach und nach regelrecht aufzumischen. Insofern waren die schlechte Bezahlungund die späten Stunden trotzdem Gold wert für meinen späteren Werdegang.
Sie stehen seit 7 Jahrzehnten auf der Bühne. Muss man da eigentlich noch üben, oder geht das Spiel von alleine?
Von alleingeht da leider gar nichts. Da muss man sich immer wieder von Neuem frisch halten. Denn das ist ja nicht nur das Transponieren von Tonarten und andere geistige Anstrengungen, sondern vor Allem der Ansatz ist beim Saxofon unglaublich wichtig für die korrekte Modulation der Töne und um dem Instrument seinen individuellen Sound zu geben. Das ist leider nichts was man einfach auslassen und sich auf sein Gedächtnis verlassen kann, sondern da muss man eben wirklich jeden Tag ran. Morgens ans Klavier und abends ein paar Töne auf dem Saxofon sind wirklich unabdingbar um fit zu bleiben, selbst nach so vielen Jahren.
„›Made in Germany‹ macht eben auch unmissverständlich bewusst: das hier ist nicht Amerika, nicht die South Side, Harlem oder East St. Louis. Und der das schreibt, hat ganz andere Storys zu erzählen als solche, wie sie aus vielen Selbstdarstellungen, vor allem afroamerikanischer Künstler, nur so hervorsprudeln.“
„Doldingers Kapitel zur Nachkriegszeit lesen sich wie ein aufschlussreiches historisches Zeugnis, das über seine persönliche Biografie hinausweist.“
„Der lockere Plauderton überträgt sich mit kurzen Sätzen ins Buch und führt zu einer angenehmen und unterhaltsamen Lektüre.“
„Der 86-Jährige schafft es, selbst Menschen, die mit Jazz nichts am Hut haben, in Sekunden dafür zu begeistern.“
„›Made in Germany‹ (…) setzt in der Tat einen neuen Maßstab für Musikerbiografien.“
„Sein Rückblick kommt ohne tiefere Brüche und Eintrübungen, aber auch ohne Weihrauch aus.“
„Erfrischende Offenheit und (...) aufblitzender Sinn für Humor.“
„Klaus Doldingers Autobiografie, die er bescheiden ›Made in Germany. Mein Leben für die Musik‹ nennt, schließt eine Lücke in der notierten deutschen Kulturgeschichte.“
„Das Buch ist ein Highlight im Bereich der Musiker-Biografien. Gut geschrieben, flüssig, spannend, emotional und amüsant erzählt.“
„Eine fesselnde Lektüre über ein Leben für die Musik.“
„Das vorliegende Buch ist ein Highlight im Bereich der Musiker-Biografien. Gutgeschrieben, flüssig, spannend und amüsant erzählt.“
„Seine Autobiografie lebt nicht nur von den vielen Geschichten, die der Mann nach all den Jahren zu erzählen weiß, das Buch wirkt auch deshalb so lesenswert, weil Doldinger es zusammen mit seinem Sohn Nico verfasst hat. Man spürt die persönliche Nähe hinter der Entstehungsgeschichte und wird so als Leser unmittelbar vertraut mit dem opulenten Werk eines überaus sympathischen Musikers.“
„›Made in Germany‹ ist nicht zuletzt auch wegen der schlimmen Kindheitserinnerungen des Autors ein empfehlenswertes Werk für alle, die sich durch eine erstaunliche Lebensgeschichte inspirieren lassen möchten.“
„In diesem Zuge ist es auch ein Stück deutscher Kulturgeschichte, das die Entstehung des Jazz ›Made in Germany‹ in der deutschen Nachkriegszeit nachskizziert.“
„Ich kann dieses Buch nicht nur allen Doldinger-Fans, sondern allen am ›Jazz in Deutschland‹ Interessierten nur sehr empfehlen.“
„›Made In Germany‹ ist eine Ode an die Freiheit, an Toleranz und die Wichtigkeit, im Leben immer neugierig und offen zu sein.“
„Nun liegt das Buch dieser beispiellosen Karriere vor, schön illustriert und durchzogen von QR-Codes zum Anhören von Musikbeispielen.“
„Klaus Doldinger erzählt in seinem Buch ausgesprochen offen seine ganz persönliche Lebensgeschichte, von seinen Lebensabschnitten und einschneidenden Erlebnissen.“
„Was für ein Solo!“
„Das Buch ist ein Lehrbuch für alle, die an Jazz interessiert sind, ist abwechslungsreich, extrem informativ und unterhaltsam.“
„Erinnerungen reihen sich, mit kleinen Anekdoten gespickt, wie auf einer Perlenschnur auf.“
„Doldingers Vita spiegelt fast 70 Jahre internationale Jazzgeschichte. Das macht das Buch als Quelle so wertvoll.“
„Im Plauderton, mit erfrischender Offenheit und immer wieder aufblitzendem Humor lässt Doldinger in seinen Lebenserinnerungen eine fast siebzigjährige Karriere Revue passieren.“
„Lesenswerten Biografie“
„Dieses Buch ist ein absolutes ›Muss‹ für alle, die vom Jazz begeistert sind.“
„Ein großartiges Feature sind die im Buch abgedruckten QR-Codes, die direkt zur besprochenen Musik führen.“









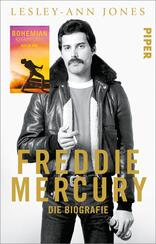



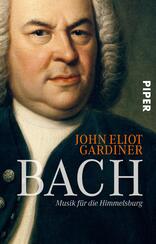

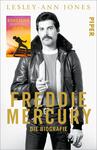


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.