

Immer noch ich. Nur anders Immer noch ich. Nur anders - eBook-Ausgabe
Mein Leben für den Radsport
— Berührende Autobiografie einer starken Frau„Als ich die Geschichte gelesen habe, war ich total fasziniert, wie sie mit ihrem Schicksalsschlag umgeht. Es hat mich zum Nachdenken gebracht.“ - Schwäbische Zeitung
Immer noch ich. Nur anders — Inhalt
„Ich bin gefallen, ich kann auch wieder aufstehen.“
Authentisch und ergreifend – eine erstaunliche Autobiografie einer starken Frau
Sportlerin Kristina Vogel erzählt in ihrer Autobiografie von ihrem Trainingsunfall, ihrer Querschnittslähmung und ihrem bewegten Leben danach.
Der Radsport ist für Kristina Vogel seit ihrer frühen Kindheit ein essenzieller Bestandteil ihres Lebens. Ihre Leidenschaft für den Sport ging so weit, dass sie sich nach einem schweren Verkehrsunfall im Alter von 18 Jahren mit eisernem Willen und hartem Training wieder aufrappelte. Anschließend gewann sie mehrfach Bahnradsport-Meisterschaften und wurde in den Jahren 2012 und 2016 sogar Olympiasiegerin.
Im Jahr 2018 folgte jedoch ein schwerer Schicksalsschlag: Beim Training prallte sie unverschuldet mit hohem Tempo mit einem anderen Fahrer zusammen, der auf der Bahn stand. Kristina Vogel war von diesem Zeitpunkt an querschnittsgelähmt und musste das Fahrrad gegen einen Rollstuhl eintauschen.
Mit viel Mut und Tatendrang schaffte sie jedoch den Neuanfang. Sie lernte, ihr Handicap zu akzeptieren, ließ sich in den Erfurter Stadtrat wählen, arbeitet als ZDF-Kommentatorin und setzt sich für Menschen mit Behinderungen ein.
Ehrliche Auseinandersetzung mit einem tragischen Unfall und dessen Konsequenzen
Mit einer bewundernswerten Offenheit lässt Kristina Vogel die Leser an ihrem Innenleben und ihren Erfahrungen direkt nach dem Unfall teilhaben. Die erste Ungeduld weicht Akzeptanz und schließlich folgt die Reflektion über ein Leben abseits des Profisports. Eine Phase, dir ihr auch eine neue Perspektive auf eine ungewisse Zukunft eröffnet.
„Ich bin gefallen, ich kann auch wieder aufstehen.“ Beeindruckender Lebensweg von der Profisportlerin zum mutmachenden Idol
Als Sportlerin des Jahres 2018 und mit einem Instagram-Account mit knapp 80.000 Followern stellt Kristina Vogel heute ein Vorbild für zahlreiche Menschen dar. „Immer noch ich. Nur anders: Mein Leben für den Radsport“ untermauert diesen Status und zeichnet ungeschönt-wahrhaftig ihre einzelnen Lebensstationen nach.
Leseprobe zu „Immer noch ich. Nur anders“
Prolog High Heels
1.
Am Abend vor der Hausbegehung besprachen Michael und ich, was noch organisiert werden musste. Er nahm ein paar Sachen mit, die ich über das Wochenende in Erfurt brauchen würde. Michael selbst wollte am nächsten Morgen von Kienbaum aus fahren und möglichst eine Stunde vor mir in der Märchensiedlung sein, damit die anderen auf keinen Fall vor der verschlossenen Tür standen. Die Leute vom Sanitärhaus, die auf den letzten Drücker zugesagt hatten, das neue Bett zu liefern, und Daniel und Jörg: der zuständige Physiotherapeut und der [...]
Prolog High Heels
1.
Am Abend vor der Hausbegehung besprachen Michael und ich, was noch organisiert werden musste. Er nahm ein paar Sachen mit, die ich über das Wochenende in Erfurt brauchen würde. Michael selbst wollte am nächsten Morgen von Kienbaum aus fahren und möglichst eine Stunde vor mir in der Märchensiedlung sein, damit die anderen auf keinen Fall vor der verschlossenen Tür standen. Die Leute vom Sanitärhaus, die auf den letzten Drücker zugesagt hatten, das neue Bett zu liefern, und Daniel und Jörg: der zuständige Physiotherapeut und der Sachbearbeiter, die entscheiden würden, ob unser Zuhause für mich noch infrage kam.
Als Michael gegangen war, legte ich auf dem Nachtschrank die Dinge zurecht, die ich am Morgen nicht vergessen durfte. Tabletten, Katheter, Kanülen für die Thrombosespritze. An meinem Fußende standen die Schuhe, die meine Freundin Lisa mir am Vormittag ins Krankenhaus gebracht hatte. Weiße Sneaker in der Größe 40. Ursprünglich hatte ich 37,5 getragen, aber nach einer Querschnittslähmung braucht man bequemere Schuhe, weil man die Druckstellen nicht mehr spürt und sich womöglich wund scheuert. Ich stellte mir den Wecker auf 6:00 Uhr, was natürlich Quatsch war, weil ich schon wusste, dass ich vor Aufregung nicht schlafen würde.
Das Frühstück kam sonst um sieben. Heute hatte ich es früher bestellt, und ich sah ständig auf die Uhr, den Finger auf dem Rufknopf, falls sie mich vergaßen. Als das Essen gebracht wurde, schlang ich es so schnell wie möglich herunter, länger als fünfzehn Minuten hatte ich dafür nicht eingeplant. Es gab wenig, was ich von meiner Seite zum Gelingen des Tages noch beitragen konnte. Das Darmmanagement würde einige Zeit in Anspruch nehmen, eine Stunde musste ich rechnen.
Ecki und John kamen um 9:00 Uhr. John war ein Zwei-Meter-Typ, der oft von seinem Gitarrenkurs erzählte und dessen Sohn ebenfalls im Radsport aktiv war. Ecki war ein kleiner, kräftiger und ruhiger Mann.
Eine Weile standen sie im Zimmer herum und überlegten, wie wir es machen sollten. Eine Stationsschwester kam hinzu, blickte mich skeptisch an und stieg nach kurzem Zögern in die Diskussion ein. Sie lief um das Bett herum, rüttelte an der Krankenwagenliege, die Ecki und John hereingerollt hatten.
Meine Sitzzeit betrug maximal zwei Stunden, weiter war mein Körper noch nicht – meine Haut, mein Kreislauf und die Muskulatur mussten sich an das ständige Sitzen erst noch gewöhnen. Spätestens nach zwei Stunden hielten mich Bauch und Rücken nicht mehr aufrecht. Die Fahrt von Berlin nach Erfurt dauerte aber dreieinhalb Stunden, was also zu viel war und vor allem bedeutet hätte, dass ich, sofern ich mir die Zeit zumutete, nach der Ankunft keine Sekunde mehr sitzen durfte. Ich musste die Fahrt liegend verbringen, um meine Kraft für die Hausbegehung zu sparen, und deshalb der Krankentransport mit Ecki und John.
Die Frage war jetzt: Wie kriegen wir Kristina Vogel vom Bett auf die Liege? Die Schwester ging ein Rutschbrett holen, während Ecki und John mein Bett vollständig hochfuhren, damit ich mit der Transportliege zumindest annähernd auf eine Höhe kam. Ich konnte kaum helfen; das Rollstuhltraining, in dem mir die grundlegenden Dinge beigebracht wurden, hatte erst vor wenigen Tagen begonnen. Die drei fummelten eine gefühlte Ewigkeit an mir herum, bewegten mich so vorsichtig wie möglich auf die Liege hinüber und schoben dann eine zweite gefühlte Ewigkeit die Polster zurecht, damit ich mich in der stabilen Seitenlage hielt. Eine zweite Schwester, die vierte Person in meinem engen Zimmer, kam von draußen mit einer Kissenrolle herein, die zum Schutz gegen Druckstellen zwischen meine Beine geklemmt wurde.
Es dauerte noch eine weitere halbe Stunde, dann lag ich im Wagen. Alles war gepackt und zurechtgebastelt, die Taschen waren verstaut. Ecki, der stille Mann, sollte hinten bei mir sitzen. Es war 9:45 Uhr, ich war pünktlich auf die letzte Sekunde noch fit geworden, sie ließen mich fahren. Ich war glücklich und nervös zugleich. Die erste Hürde war genommen, die erste Etappe lag hinter mir, ich hatte drei Monate im Krankenhaus ausgehalten, und länger konnte ich nicht warten. Ich musste dieses Zimmer zumindest kurz verlassen und probeweise in mein Leben zurück.
Auf Google Maps konnte ich schauen, wo wir waren, aber das wurde schnell langweilig. Der rote Punkt bewegte sich schleichend über die Karte. Im Liegen konnte ich die Baumkronen von schräg unten durch die Wagenfenster erkennen; es war ein milder Septembertag, die Schatten der Äste flackerten gleichmäßig über mich hinweg. Michael fuhr die Strecke zeitgleich in seinem eigenen Wagen, und ich machte mir Sorgen, dass er zu spät kommen, uns nicht in Empfang nehmen könnte. Das Sanitärhaus würde dann die Matratze und außerdem den Duschrollstuhl wieder mitnehmen, und der Sachbearbeiter und der Physiotherapeut würden herumstehen und schlechte Laune bekommen, sie würden sich mit Doreen unterhalten, unserer Architektin, die wir dazugebeten hatten, um die möglichen Umbauten zu besprechen. Das Beste wäre natürlich, wenn Michael das neue Bett und den Rollstuhl in Empfang nahm, während ich noch unterwegs war, dann würde er beides vorab zusammenbauen, und wir könnten den Pflichtkrempel bei der Begutachtung gleich vorweisen. Ich schickte ihm eine SMS. Ich wartete einen Moment. Ich schickte ihm gleich noch eine, insgesamt zwanzig.
Und als wir in Erfurt ankamen, sprang mein Herz. Ich konnte die ersten Baumkronen erkennen, der Straßenverlauf kam mir vertraut vor, ich brauchte kein Google Maps mehr, um zu wissen, wo wir langfuhren. Ich wusste, an welcher Ampel wir standen und wie lange die Rotphase dauerte. Aus der Innenstadt fuhren wir nach Windischholzhausen, an der Sportklinik und dem Halbleiterwerk vorbei, die Steigung zur Märchensiedlung hinauf, und ich erkannte jetzt einzelne Bilder wieder, die Wipfel der Birken und Ahornbäume, an denen ich vor dem Unfall oft vorbeigefahren war und die sich wie damals im Wind bewegten. Für einen kurzen Moment war ich im Glück. Es passierte wirklich, ich fuhr nach Hause. Wir bogen nach rechts in die Märchensiedlung, rollten an den anderen Straßen vorbei, am Sterntalerweg, an Rapunzel und Frau Holle, wir bogen noch einmal ab und hielten vor unserem Haus.
Ecki, der neben mir saß, bückte sich zur hinteren Wagenklappe und wartete. Ich fragte mich, warum er nicht öffnete. Es dauerte einen Moment, dann wurden die Flügeltüren zur Seite geschoben, und John stand vor uns, den Kopf dunkel vor dem blauen Himmel. Ich hörte Stimmen. Es waren schon Leute da. Ich hörte Michael. Sie würden sich zumindest einen Moment gedulden müssen, ich musste dringend aufs Klo, hatte die Zeit schon deutlich überschritten. Die Transportliege wurde vorgezogen und ausgeklappt, das Licht war überraschend grell, und ich fragte mich, wie sie mich in den Rollstuhl bekommen wollten. Es waren alle da, der Gutachter, der Physiotherapeut, die Architektin – Doreen, die mich anblickte und zum ersten Mal sah, was sie schon längst gehört hatte. Ich konnte an ihr vorbei in den Hausflur blicken, wo die Pakete vom Sanitärhaus lehnten. Bibbii kam zu mir, Michael, der von kaum jemandem so genannt wurde. Ich hatte irgendwann mit dem Spitznamen angefangen, und der restliche Freundeskreis hatte ihn übernommen. Bibbii jedenfalls griff unter mich und hob mich einfach in den Rollstuhl.
2.
Mir war nie aufgefallen, dass unser altes Boxspringbett so hoch war. Ich beugte mich über den Rand und sah die Holzdielen in schwindelerregender Tiefe. Wie sollte ich da jemals aus dem Rollstuhl selbstständig hinaufkommen? Der neue Rahmen aus dem Sanitärhaus stand noch verpackt im Erdgeschoss auf dem Flur, und das Rückenteil von unserem alten Bett ließ sich nicht so weit aufstellen, dass ich darin würde kathetern können. Es half nichts, Michael musste als Lehne mit ins Bett und meinen Rücken festhalten.
„Fertig?“, fragte er.
Und ich sagte: „Fertig.“
Im Erdgeschoss stand das Besichtigungsteam in einer Reihe, Sachbearbeiter, Physiotherapeut und Architektin. Wir beschlossen, im Keller zu beginnen, also trug Michael, der mich gerade aus dem Schlafzimmer heruntergeschleppt hatte, mich noch ein Stockwerk tiefer. Doreen brachte den Rollstuhl mit.
Ich hatte ein bisschen Respekt vor dem, was uns erwartete. Michael und ich hatten im Fernsehen einmal einen Bericht gesehen über jemanden, der unendlich viele Schuhe besaß.
„Guck dir das an“, hatte ich gesagt. „Wofür braucht der so viele Schuhe?“
Michael hatte gelacht: „Das fragst jetzt ausgerechnet du?“
Ich war damals zum ersten Mal in den Keller gegangen, um meine Schuhe zu zählen. Die Sammlung stand auf drei Billy-Regale verteilt, über die wir eine Beleuchtung installiert hatten, um die Schuhe ein wenig in Szene zu setzen. Es waren tatsächlich nicht wenige.
Als wir im Rahmen der Besichtigungstour im Keller ankamen, blickte ich auf meine Füße, an denen ich noch immer Lisas Sneaker trug. Wir hatten nicht darüber gesprochen, ob sie mir die Schuhe nur geliehen oder als Einstiegsgeschenk in mein neues Leben endgültig vermacht hatte. Wenn ich den Leuten im Krankenhaus glauben durfte, dann waren die Sneaker jetzt das einzige Paar Schuhe, das ich noch besaß. Ich würde in meine alte Größe nicht mehr hineinpassen, und die hohen Schuhe, meine unzähligen High Heels, würde ich sowieso nicht mehr anziehen können. Ich versuchte gar nicht daran zu denken, was die zweihundert Paar wohl insgesamt gekostet hatten.
Im oberen Stockwerk standen Jörg und Daniel im Badezimmer und erklärten, dass die Dusche für mich ungünstig sei. Wir hatten am hinteren Ende eine Bank montiert, die von der eigentlich quadratischen Kabine etwas Platz wegnahm. Die Dusche war standardmäßig 1,20 Meter lang, nach unserem Einbau aber nur noch 90 Zentimeter, was jetzt der Diskussionspunkt war. Um mit dem Rollstuhl hineinzukommen, fehlten 30 Zentimeter. Michael und ich hatten allerdings auf der Duschbank zu zweit immer sehr glücklich gesessen. Ich fand, dass es auch jetzt noch gehen musste.
Das werdet ihr ja sehen, dachte ich, wie das alles noch passt.
Michael kam mit dem Duschrollstuhl, den er unten zusammengebaut hatte, und ich fuhr in die Duschkabine und musste feststellen, dass es nicht passte.
Die Dusche war für den funkelnagelneuen Duschrollstuhl zu klein, sogar deutlich.
„Das geht“, erklärte ich. „Das seht ihr doch. Der passt hier rein, der verdammte Stuhl.“
Niemand sagte etwas, und in mir stieg eine Wut auf, die ich nicht mehr lange unter Kontrolle halten konnte.
Wir gingen ins Ankleidezimmer, das in Sachen Mädchenverwirklichung mein absoluter Traum gewesen war. Dort waren nun alle Schränke zu hoch. Ich kam an meine Klamotten nicht heran. Die Schubladen waren zu weit oben, die Hänger sowieso, und wir gingen zurück ins Badezimmer und überlegten, wie sich die Dusche dort vergrößern ließ, besprachen, dass man vermutlich das Fenster würde herausreißen müssen, und dann schlichen Daniel und Jörg um die frei stehende Badewanne herum, die sündhaft teuer gewesen war und in die ich nun unter keinen Umständen mehr hineinkäme. Es wurde überlegt, ob man einen Lifter installieren oder die Badewanne herausreißen könnte oder, wenn man das Badezimmer ohnehin auf den Container warf, die Badewanne dann anders machte.
Es gab eine zweite Badezimmertür, die vom Schlafzimmer herüberführte und die lediglich 60 Zentimeter breit war. Michael hatte die zusätzliche Verbindung vom Schlafzimmer zum Bad so gern haben wollen, damit man nicht ständig den Umweg über den Flur laufen musste. Und diese Tür, Michaels Tür, war jetzt zu klein. Ich versuchte mehrfach schräg hindurchzukommen, aber es war zu eng. Es kam mir vor, als hätte ich Michael nachträglich seine Tür vermasselt.
Und die Treppe war totaler Mist. Auf der Treppe würde sich kein Lift befestigen lassen. Wir würden das Büro im Erdgeschoss verschieben müssen, dann käme ein Fahrstuhl hinein, wofür wir allerdings die Fußbodenheizung herausreißen mussten, weil man in den Boden sonst nirgendwo bohren konnte. Man würde auf der Küchenseite eine Wand herausreißen müssen, wenn da der Fahrstuhl hinkam.
Wir gingen ins untere Bad, gingen wieder hinaus, nein, das funktionierte alles nicht, das ganze Haus ging nicht.
Es hörte gar nicht wieder auf. Mein Zuhause wurde Stück für Stück abgetragen, obwohl es gerade erst fertig war und uns die vermurkste Bauphase fast die Beziehung gekostet hätte.
Im Wohnzimmer hatten meine Freunde Lisa und Max, die einen Schlüssel vom Haus hatten, überall Luftballons und ein großes Schild aufgehängt: Welcome back! Wir blieben mit dem Besichtigungsteam vor einem Minion-Luftballon stehen. Dem kleinen dicken Bob. Die Minions hatte ich schon immer zum Schießen gefunden. Auf dem kleinen Tisch in der Wohnzimmernische stand meine Nähmaschine, und ich erkannte die Stoffe wieder, die ich vor Monaten zurechtgelegt hatte, um unsere Gardinen zu nähen. Ich hatte ja ursprünglich gedacht, dass ich nur für eine Woche weg wäre.
Auf dem Balkon standen die Blumenkästen neben den noch ungeöffneten Säcken mit der Blumenerde. Daniel und Jörg traten neben mich an die Balkontür, und ich wusste gleich, dass wir den Terrassenvorbau mit den glitschigen Schiffsdielen am besten in die Luft sprengen würden.
Während der Verabschiedung merkte ich, dass Doreen die Sache naheging. Sie kannte mich ein bisschen besser als die anderen – sie hatte das Haus für uns entworfen. Bei mir legte sich sofort der Schalter um. Doreen sah mich vor sich im Rollstuhl sitzen, ich merkte, wie sehr sie schlucken musste, und sofort wollte ich es ihr leicht machen. Man lernt das als Athletin auch für die Pressegespräche: immer objektiv bleiben, nur nicht persönlich werden. Wir gaben uns die Hand und sprachen darüber, wann wir uns das nächste Mal sehen würden.
Ich verabschiedete mich von Daniel und Jörg. Wir verabredeten uns für ein Nachbereitungsgespräch im Unfallkrankenhaus in Marzahn.
Das Treffen endete auf einer versöhnlichen Note. Man hatte den Termin nicht besser hinbekommen können. Es war das Ziel der Besichtigung gewesen, mir zu zeigen, wie das Leben draußen sein würde, nun ja, eine solche Veränderung sei für niemanden angenehm, sagten die Gutachter.
Ich nickte.
Drinnen wollte Michael etwas zu essen machen. Er schlug zwei Eier in die Pfanne, für mehr reichte auch seine Energie nicht mehr. Ich wollte mich nützlich machen, in der Zwischenzeit den Geschirrspüler ausräumen, und deshalb fuhr ich an der Kücheninsel vorbei in die hintere Ecke. Ich zog die Klappe auf und beugte mich vor, um den ersten Teller aus der Strebe im Oberkorb zu ziehen, und plötzlich musste ich mich am Rollstuhl festhalten. Es kostete mich unendliche Kraft, mich zu bücken und den Teller anzuheben. Es gab keine Muskeln in meinem Körper, die mich bei dieser Bewegung unterstützt hätten.
Und dann war Schluss. Der Geschirrspüler. Die hatten ja alle recht. Es würde nicht gehen. Mein Zuhause funktionierte nicht mehr. Ich war jetzt behindert. Mein bisheriges Leben war vorbei.
3.
Am nächsten Morgen war es schon besser. Es gab ein bisschen Routine, die mir vertraut vorkam. Ich erwachte in unserem Bett, bei mir zu Hause, und neben mir lag Bibbii, der alte Stinker. Und Alexa dingelte. Die Dose sagte: „Guten Morgen, aufstehen!“
Wie ich mich darüber freuen konnte. Wie ich sagen konnte: „Alexa, weck mich in zehn Minuten.“
Das hatte ich tatsächlich vermisst.
Später begriff ich, dass die Lage so dramatisch nicht war. Sommerschuhe zum Beispiel musste ich nicht zwei Nummern größer kaufen, die fielen mir sonst auch als Rollstuhlfahrerin vom Fuß. Ich hatte mich immer hübsch angezogen, daran würde sich auch in Zukunft nichts ändern. Ich würde einfach herausfinden, was mir im Gegensatz zu früher nun stand. Eine Lähmung unterschied sich nicht wesentlich von den anderen Ereignissen im Leben, einiges musste man ändern, anderes blieb. Ich musste bloß daran glauben, dass es voranging. Das war mein Credo gewesen, das würde ich nicht aufgeben.
Michael hatte das Frühstück fertig, hob mich auf den Arm und trug mich nach unten wie ein Baby. Es war so warm, dass wir draußen frühstücken konnten, auf dem Terrassenvorbau mit den rollstuhluntauglichen Schiffsdielen. Die Sonnenstrahlen fielen mir aufs Gesicht, ich hörte die Vögel. Michael hatte wunderbarerweise Pancakes gemacht, und ich kämpfte das Gefühl nieder, dass ich zu wenig beigetragen hatte zu diesem glücklichen Moment, zu wenig geholfen. Es war vielleicht nicht entscheidend. Wir saßen auf der Terrasse, und es war schön, dass ich dazu einen Tag lang die Freiheit hatte.
Später kamen die engsten Freunde vorbei: Max und Lisa und Pierre. Sie gehörten zu den wenigen Leuten, zu denen ich in der ersten Zeit im Krankenhaus den Kontakt hatte halten dürfen. Wir hatten dafür extra eine Chatgruppe eingerichtet: Pummelfee auf vier Rädern. Auch Sabine kam dazu, meine Schwester, und wir beschlossen, dass wir grillen würden. Die Männer fuhren los, um den Einkauf zu erledigen, während Lisa und Sabsi den Tisch vorbereiteten und ich ihnen zurief, wo alles zu finden war. Die beiden feuerten auf der Terrasse den Grill an, und ich saß im Wohnzimmer und machte aus dem Rollstuhl heraus einen langen Hals, wie sich das für einen guten Thüringer gehörte: Man prüft, ob die Damen auch die Kohle ankriegen.
Wie es mit der Terrassenschwelle werden sollte, die bestimmt fünf Zentimeter hoch war? Würde man mich da jedes Mal tragen müssen? Im Gegensatz zum Vortag, wo wir mit den Gutachtern hier entlanggegangen waren, kam mir das alles nicht mehr unlösbar vor. Meine Freunde waren da. Wir würden das irgendwie regeln.
In der Abenddämmerung fühlte es sich an wie früher. Da waren ein paar Freunde, die sich lange kannten und gemeinsam etwas aßen. Wir sprachen über das, was in meinem Leben passiert war, und über das, was die anderen erlebt hatten. Im Kreis der Menschen, die mir so nahestanden, konnte ich es mir herausnehmen, ein wenig stolz auf mich zu sein. Stolz auf das, was ich geschafft hatte, auf die lange Reise, die hinter mir und hinter Michael lag.
Es wurde dunkel, und mit der Dunkelheit wurde es empfindlich kühl, sodass ich sofort zu zittern begann.
Pierre schlug auf den Tisch und sagte: „Wisst ihr was, wir lassen uns doch den Abend nicht verderben, wir fahren in die METRO und kaufen einen Heizpilz.“
Ich konnte gar nicht so schnell über diesen Gedanken mit dem Lachen aufhören, wie er und Michael im Wagen saßen und wenig später mit dem Riesengerät schon wieder auf der Terrasse standen.
Als die Nachbarn herüberkamen, die unsere Stimmen gehört hatten, gaben wir vermutlich ein eigenwilliges Bild ab. Der Heizpilz lief, wir hatten aus der Bauphase noch eine Gasflasche im Keller gehabt; das verrückte Ding funktionierte dermaßen gut, dass Pierre inzwischen in kurzer Hose und T-Shirt auf der Terrasse saß. Ich hatte mir zur Sicherheit noch Michaels Jacke um die Schultern gelegt. Die Nachbarn hatten sich in unserer Abwesenheit oftmals um die Post gekümmert und im Haus nach dem Rechten gesehen, und mit Blick auf den Heizpilz sagten sie nun, was jeder in dieser Situation gesagt hätte: „Was macht ihr denn da?“
Und sie sagten nicht, was die meisten in den vergangenen Wochen und Monaten gesagt hatten, wenn sie mein Krankenzimmer betraten. Sie sagten nicht, was fast alle sagten, wenn sie mich in der kommenden Zeit erstmals im Rollstuhl sahen. Es war ein so stinknormaler Grillabend, dass die Nachbarn sich ein Bier nahmen und vergaßen, mich auf meine Querschnittslähmung anzusprechen. Selbst ich vergaß den Rollstuhl. Es war für einige Stunden keine große Sache. Ich war immer noch ich, nur anders.
1. Teil Die Zarentochter
1.
Es ist schwer zu sagen, wo meine Geschichte beginnt. Meine Oma ist aus Bamberg in die Ukraine verschleppt worden, von wo aus sie noch einmal zurückging, um später in Kirgisien zu landen. Sie spricht nicht gern über die Zeit, weshalb nicht einmal bekannt ist, wer genau sie eigentlich verschleppt hat. Sie ist, wie alte Leute gern sind – wenn man sie nach den großen Zusammenhängen fragt, erzählt sie von einer blauen Jacke oder von der Erinnerung an ein Kornfeld im Mai. Und selbst das tut sie nur zu Weihnachten und niemals länger als zwei Minuten, und wenn sie bei dem Kornfeld angekommen ist, dann sagt sie: „So, ihr Lieben, jetzt gibt es das Essen.“
Meine Mutter ist in Kirgisien geboren. Sie war dort mit meinem leiblichen Vater verheiratet, der in der Armee war und ständig unterwegs. Irgendwann kam heraus, dass er sie betrogen hatte, und Mama beschloss, ihre kleine Kristina zu nehmen und das Land zu verlassen. Meine Oma erzählt, und da kann sie sich nun deutlich erinnern: dass sie alle viel früher gegangen wären, wenn meine Mutter nicht so lange hätte bleiben wollen – wegen ihm. Meine Oma war sofort mit dabei, nahm auch den Opa mit, meine Tante wollte ebenfalls nach Deutschland, und so reisten wir alle zurück, wohin wir gehörten, wie Oma das nannte.
Das war im Sommer 1991.
Meine Mutter war zwanzig und sprach kein einziges Wort Deutsch.
Für die Behörden in Deutschland war es mit der Zugehörigkeit nicht ganz so eindeutig. Wir waren keine Russen, hatten keine kirgisischen Wurzeln, richtige Deutsche waren wir auch nicht. Wir mussten in ein Auffanglager nach Kindelbrück in Thüringen und blieben dort für zwei Jahre. Es gibt ein oder zwei Babyfotos von mir, die noch in Kirgisien aufgenommen wurden und auf denen meine Mutter und mein leiblicher Vater zu sehen sind: zwei junge Leute, die ein Kindchen in einem weißen Kleid in die Kamera halten. Ansonsten stammen sämtliche Bilder aus dem Auffanglager in Deutschland. Es gibt ein Foto von mir und meinem Opa, auf dem wir entspannt oben auf dem Stockbett im Lager liegen. Ich ein süßer Fratz, er mit seinen großen Bauarbeiterhänden, die ich, wie sich später herausstellen würde, geerbt hatte. Opa litt an einer Nervenkrankheit, was ich natürlich noch nicht wusste und was auf dem Bild nicht zu sehen ist. Er war mein Liebling, Opa, und das Foto steht jetzt vor mir auf dem Schreibtisch.
Die ersten Erinnerungen, die nicht von einem Foto stammen, sind mit dem Kindergarten im Auffanglager verbunden. Es gab dort eine Tagesmutter, die sich in mich verliebte und mich auch nach der offiziellen Betreuungszeit am Nachmittag herumtrug. Ihr Mann kam nach Feierabend in seiner blauen Arbeiterlatzhose dazu und war ebenfalls begeistert von dem Kind. Diese beiden waren nun meine Findeleltern, Helmut und Viola, und als sich nach einer Weile ihre berufliche Situation veränderte und sie nicht mehr die Zeit hatten, um täglich in das Auffanglager zu kommen, fuhr ich alle vierzehn Tage zu ihnen ins Wochenende. Kindelbrück war winzig, tatsächlich wohnten Helmut und Viola kaum fünf Minuten von dem Flüchtlingsheim entfernt, trotzdem fühlten sich die Wochenendfahrten jedes Mal an, als würde ich auf eine Reise gehen. Den Besuchsrhythmus behielt ich lange bei, für viele, für sehr viele Jahre.
2.
Helmut hatte eine Firma für Heiztechnik. Neben dem Wohnhaus in Kindelbrück errichteten die beiden eine Lagerhalle, in der ich zwischen den Ersatzteilen spielen und auf den Rohren herumrutschen konnte. Ich wuchs zwischen Sägespänen und seltsam geformten Metallteilen auf, deren Funktion mir schleierhaft war. Viola half in der Firma aus, erledigte für Helmut den Papierkram im Büro, und erst später, als die Firma wuchs und für die Buchhaltung jemand eingestellt wurde, konnte sie das Tagesmuttergeschäft wieder aufnehmen.
Helmut und Viola behandelten mich wie ihr leibliches Kind, obwohl sie zwei eigene Kinder hatten. Die beiden waren älter als ich, begannen bald ihr Studium und verschwanden aus meinem Leben, als ich sechs oder sieben wurde. Ich war allein im Sanitärbetrieb, eine Einzelgängerin, es gab allerdings drei Hunde: Poldi, einen kleinen Mischling, und zwei Schäferhunde namens Erus und Sarah. Mit den Schäferhunden spazierte ich an den Vormittagen wie der Boss durchs Dorf und zur Wipper hinunter, einem Zufluss der Unstrut. Es waren riesige schwarze Tiere mit hellbraunen Akzenten, die mir kleinem Wesen seltsamerweise aufs Wort gehorchten – meine Eltern erzählen noch heute davon, wie ich mit den beiden Monstern herumlief und die Nachbarn den Kopf schüttelten. Heute würde man ein kleines Kind nicht mehr allein ziehen lassen, aber damals war es für Helmut und Viola normal. Kindelbrück war ein winziges Dorf mit kaum mehr als 2000 Einwohnern. Was hätte da passieren sollen? Ich verschwand nach dem Frühstück, man sah mich nicht mehr, und zum Mittagessen stand ich mit meinen beiden Hunden wieder auf dem Hof.
Helmut und Viola kamen mir auf fantastische Weise wohlhabend vor. In unserem Auffanglager in Kindelbrück und anschließend in der ersten Wohnung unserer Familie in Sömmerda waren wir nicht gerade finanzkräftig, und im Vergleich dazu erschien mir mein Leben bei Helmut und Viola wie eine Episode am Hof der Zarenfamilie. Schon damals stand im Büro der Sanitärfirma ein Computer, an dem ich spielen durfte. Windows 97 – das war das erste Betriebssystem, das ich bewusst mitbekam. Als ich eingeschult wurde und lesen und schreiben lernte, bastelte ich mir in Microsoft Word meine eigene Version der BILD-Zeitung zusammen, die ich dann auf Endlospapier ausdruckte. Stinkende Hunde nach Regenguss in Kindelbrück! Schon drei Tage kein Nachtisch bei Helmut und Viola! Auch meinen ersten CD-Player bekam ich von Helmut und Viola, weil für so etwas zu Hause das Geld fehlte. Für mich bestand gar kein Zweifel daran, dass die beiden Millionäre waren. Sie hatten einen Swimmingpool hinter dem Haus, sie fuhren mit mir in den Urlaub nach Kroatien und sogar nach Paris ins Disneyland. Heute nehme ich an, dass für damalige Verhältnisse einfach der Heizungsladen gut lief. Vermutlich hatten Helmut und Viola nach der Wende sämtliche Rohre nördlich von Erfurt neu verlegt.
Mama hatte zu Anfang im Auffanglager einen Mann kennengelernt. Er hieß Peter, ebenfalls ein Russe, meine Mutter sprach ja zunächst keine andere Sprache, und damals waren Mama und Peter einfach ein Paar, sie waren zusammen, solange ich mich erinnern konnte, und ich wusste nicht, dass sie sich erst nach der Ankunft in Deutschland begegnet waren. Peter war mein Papa, was niemals infrage gestellt wurde.
Meine Eltern verstanden sich gut mit Helmut und Viola und kamen an den Samstagen im Sommer ebenfalls zu Besuch auf den Hof. Sie brachten meine kleine Schwester Sabsi mit, die drei Jahre nach mir geboren worden war. Alle zusammen saßen wir dann beim Grillen, und es war, als wären wir eine einzige große Familie. Neid auf Helmut und Viola gab es keinen, oder gar Angst, dass sie meinen Eltern das Kind wegnehmen könnten. Alles, was in Kindelbrück passierte, war entspannt und freundlich.
Ich weiß noch, wie wir einmal gemeinsam an der Wipper unten im Dorf spazieren gingen. Die Erwachsenen unterhielten sich, wie Erwachsene das tun, wenn zu viele von ihnen zusammenkommen, und es war so langweilig, dass ich froh war, meine zwei großen Schäferhunde zu haben. Ich lief ein Stück weit vor, warf Steine und Stöckchen, um die sich Erus und Sarah dann stritten. Als wir zum Fluss kamen, waren die Erwachsenen außer Hörweite; es war mir ein Rätsel, wie man für eine Strecke, die wir so oft gegangen waren, dermaßen lange brauchen konnte. Ich stieg die Böschung hinab, versuchte in den Tunnel hineinzusehen, den die seltsam schief stehenden Bäume über dem Fluss bildeten – und fiel ins Wasser.
Zu meiner Überraschung war die Strömung stark. Von oben hatte der Fluss ruhig und leblos ausgesehen, aber jetzt wurde ich augenblicklich davongetragen. Ich konnte nicht atmen, befand mich unter Wasser, ich war noch mehr als sonst an den Tagen jetzt vollkommen für mich, und ich fragte mich, wie das Abenteuer wohl ausgehen und an welcher Stelle ich wieder auftauchen würde. Ich hörte Erus und Sarah, das Bellen der beiden Hunde, sah ihre schwarzen Schatten neben mir im Wasser, sie bissen in meine Kleider, stießen und zerrten mich mit sich. Es gelang ihnen tatsächlich, mich gegen die Strömung bis ans Ufer zu bringen, wo ich mich halten und auf allen vieren in das Gras der Böschung krabbeln konnte.
Dass die Sache nicht gut ausgegangen und ich ohne die Hilfe der Hunde überhaupt nicht aufgetaucht wäre, begriff ich erst, als meine Eltern zusammen mit Helmut und Viola mich nass im Ufergras fanden und entsetzt die Hände über den Köpfen zusammenschlugen.
Es war der erste Unfall, der tödlich hätte ausgehen können. In meinem späteren Leben würden sich so einige davon ansammeln.
Als ich acht oder neun war, mussten Helmut und Viola expandieren. Es fehlte eine zweite Lagerhalle, auch ein größeres Büro musste her, weshalb sie beschlossen, nicht nur die Zweckbauten, sondern auch die Tagesgebäude und das Wohnhaus auf der anderen Straßenseite in Kindelbrück noch einmal komplett neu zu bauen. Ich bekam nun mein eigenes Zimmer. Und mehr als das, viel mehr – ich bekam zwei Zimmer, ein Wohnzimmer im Erdgeschoss, das ich nach meinen eigenen Vorstellungen einrichten konnte, dazu mein eigenes Schlafzimmer oben im Haus. Jedes der Zimmer war für sich bestimmt zwanzig Quadratmeter groß. Ich verbrachte eine wunderbare Zeit bei Helmut und Viola, einen Einwanderermädchen-Kindheitstraum, und der einzige große Fehler der beiden war, sozusagen, dass sie mir noch ein weiteres Geschenk machten: mein erstes Fahrrad.
Es waren Helmut und Viola, die mir das Fahrradfahren beibrachten, nicht meine Eltern. Ich begann mit dem Radsport, trainierte bald auch an den Wochenenden, fand nicht mehr die Zeit, um regelmäßig auf den Hof zu kommen. Allmählich lebten wir uns auseinander. Wir sprachen nicht darüber, auch später nicht, sie verschwanden einfach aus meinem Leben. Ich verschwand aus ihrem.
Erus und Sarah waren schon nicht mehr die Jüngsten, als ich wie der Boss mit ihnen durch die Dorfstraßen von Kindelbrück gezogen war. Sie starben, und Helmut und Viola mussten sich zwei neue Hunde zulegen. Ich erfuhr die traurige Geschichte aus der Zeitung: Viola wurde von einem ihrer Hunde angegriffen, absurderweise an ihrem eigenen Geburtstag, und sie kam dabei ums Leben. Ich konnte an ihrer Beerdigung nicht teilnehmen, weil ich irgendwo in der Welt auf einem Wettkampf unterwegs war. Das war lange Jahre typisch für mich, dass ich in den wichtigen Momenten zu Hause fehlte.
Dann hatte ich mit sechzehn oder siebzehn nach einem Trainingslager etwas Leerlauf und fuhr zu Besuch in die Wohnung meiner Eltern nach Sömmerda. Ich saß unruhig auf dem Sofa herum, weil ich an Viola und Helmut denken musste, an meinen Findelvater, der nun allein war. Ich beschloss, aufs Fahrrad zu steigen und zum Hof nach Kindelbrück zu fahren. Im Garten vor dem Haus sah ich Poldi, den kleinen Mischling, ansonsten schien alles still zu sein. Ich stieg ab, lehnte das Fahrrad an den Zaun und öffnete das Tor. Poldi erkannte mich sofort. Ich klingelte, lief sogar um das Haus herum, klopfte an die Fenster.
Es war niemand da. Und was hätte ich tun sollen?
Ich streichelte Poldi noch einmal, ging zurück zur Straße und fuhr weiter Fahrrad.
3.
Das Dreierstockbett, das es in meiner Familie zu einiger Berühmtheit gebracht hat, stand in der Thomas-Müntzer-Straße in Sömmerda. Dorthin waren meine Eltern gezogen, als sie das Auffanglager endlich verlassen durften. Sie hatten eine kleine Wohnung in einem Mietblock bekommen, in einem zurückhaltenden Mehrfamilienhaus mit vier Etagen, nicht zu vergleichen mit den endlosen Plattenbaulandschaften anderenorts. Es gab in der Wohnung ein Elternschlafzimmer, ein Wohnzimmer und ein kleines Kinderzimmer, in dem meine Schwester und ich uns die zweistöckige Urversion des Stockbettes teilten. Als ich neun Jahre alt war, wurde meine zweite Schwester Jessica geboren, und meine Eltern mussten das größere Schlafzimmer an uns Kinder abtreten. Und da auch das neue Zimmer nicht so groß war, dass drei Betten nebeneinander hineingepasst hätten, fuhr mein Vater in den Baumarkt, suchte einige Latten aus und bastelte die dritte Etage ans Stockbett.
Ich durfte ganz oben schlafen und war zufrieden mit dem Upgrade. Es war zwar die knappste Etage – das Bett war so nah an die Decke gebaut, dass ich auf meiner Matratze gerade noch sitzen konnte –, aber ich hatte mit der Oberseite vom benachbarten Kleiderschrank meinen eigenen Nachttisch. Ich musste nie mein Bett machen, weil ohnehin niemand mitbekam, wie es bei mir aussah. Ich hatte meine Ruhe, wenn ich mich da oben unter die Zimmerdecke zurückzog.
Für meine Mutter war es schwierig, eine Arbeit zu finden mit ihrem russischen Hintergrund und dem starken Dialekt. Irgendwann machte mein Vater sich mit einem Gebrauchtwagenhandel selbstständig, der zur allgemeinen Erleichterung in den Neunzigerjahren so gut lief, dass Mama als selbst ernannte Bürokauffrau die Buchhaltung übernehmen konnte. Nach der Arbeit und am Wochenende fuhren sie in unseren Schrebergarten, wo sie das Gemüse selbst anbauten und sich um die Kaninchen kümmerten, die erstaunlich aufwendig versorgt und später geschlachtet werden mussten. Es gab so viel zu tun, dass sie mit der kleinen Jessica regelmäßig über Nacht im Garten blieben, und in der Wohnung war dann ich die Älteste, übernahm den Haushalt und gab auf Sabsi acht. Im Sommer pflückten wir Schwestern das Gras für die Kaninchen und halfen im Garten bei der Gemüseernte. Bei uns wurde eigentlich immer gearbeitet.
Zeit für gemeinsame Mahlzeiten blieb deshalb selten. Wenn wir zur Schule gingen, lagen meine Eltern oftmals noch erschöpft im Bett. Sabsi und ich zogen uns allein an, fast jeden Morgen identische Sachen, weil meine Mutter gern alles doppelt kaufte. Ob sie das lediglich praktisch fand oder tatsächlich niedlich, war schwer zu sagen. Ich selbst war wenig begeistert von dem Zwillingslook; Sabsi als kleine Schwester hingegen fand unsere Auftritte cool.
An den Mittagen bereitete ich für meine Eltern gelegentlich ein Essen vor. Ich machte eine gute Bohnensuppe, wie ich fand. Wenn Mama und Papa aus dem Gebrauchtwagenhandel hereinkamen, schoben sie allerdings den Teller nach wenigen Löffeln unauffällig zur Seite. Ich verstand schon, die Bohnensuppe war nicht so gut, wie ich gedacht hatte. Aber ich war auch beleidigt, schließlich war ich erst elf Jahre alt und hatte für die Suppe einigen Aufwand betrieben. Meine Eltern riefen mich am Abend in das kleine Badezimmer, wohin sie zum Rauchen gingen, und beschwerten sich eben genau wegen dieser Zeitverschwendung. Die Wohnung hätte gestaubsaugt werden müssen und die Wäsche gebügelt, und ich hatte mich nur um die Bohnen gekümmert! Ich verstand, was sie meinten, aber ich fand meine Eltern – damals zumindest – ein bisschen undankbar.
Sabsi und ich bekamen kein Taschengeld. Ich grübelte ewig darüber nach, was ich mir kaufen würde, wenn ich Geld hätte wie die anderen in meiner Klasse. In Mode waren damals diese Diddl-Mäuse – Diddl-Taschen, Diddl-Papier und Diddl-Radiergummis. In der großen Pause saßen alle zusammen und tauschten ihre Diddl-Schätze, und ich hatte nicht die kleinste Diddl-Anstecknadel. Es sah auch nicht so aus, als ob sich an diesem Zustand jemals etwas ändern könnte. Das fand ich am schlimmsten: dass ich festsaß und nichts tun konnte gegen die ungerechte Verteilung. Also beschloss ich, mir selbst zu helfen.
Es gab in Sömmerda einen kleinen Laden für Schulbedarf und Schreibwaren, und in dem wollte ich mir zwei Diddl-Blöcke stehlen. Das war das große Ziel meiner Sehnsucht: zwei Schreibblöcke mit Mäusen darauf. Ich dachte, wenn ich die Blöcke hätte und womöglich niemand mit mir tauschen wollte, dann könnte ich sie zumindest im Unterricht gut gebrauchen.
Bei dem Laden in Sömmerda handelte es sich leider um eines jener Geschäfte, in denen ein verbitterter Verkäufer hinter dem Tresen steht und gar nicht erst auf den Gedanken kommt, dass es sich bei dem elfjährigen Mädchen, das seinen Laden betritt, um eine seriöse Kundin handeln könnte. Ich wurde geschnappt, bevor ich bei dem Regal mit den Blöcken auch nur angekommen war.
Meine Eltern mussten aus dem Gebrauchtwagenhandel kommen und mich bei dem griesgrämigen Verkäufer abholen, und ich musste am Abend wieder zu den Rauchern ins Badezimmer und mir anhören, dass es bei uns zu viel zu tun gab für derartige Sperenzchen.
Zu meinem Geburtstag wünschte ich mir eine Kaugummiuhr. Das gab es damals wirklich, funktionierende Quarzuhren mit einem Geheimfach, in dem ein Kaugummi lag. Was für ein Traum. Wer eine solche Uhr besaß, konnte auch als verlorener Einzelgänger auf dem Schulhof geheimagentenhaft seine Uhr aufklappen. Weil meine kriminelle Karriere nun beendet war, redete ich auf meine Mutter ein, mir die Kaugummiuhr zum Geburtstag zu schenken. Sie hörte zu, sagte aber nicht viel, weshalb ich die Predigt einige Tage lang wiederholte, bis ich sicher sein konnte, dass der Wunsch bei ihr angekommen war.
Am Morgen meines zwölften Geburtstags stand ich allein auf, machte das Frühstück für Sabsi und mich und ging in die Schule. Den Nachmittag verbrachte ich damit, auf meine Mutter zu warten. Es wurde Abend, wir aßen das Abendbrot, dann kam sie herein – und warf übermüdet die Uhr auf den Tisch. Ohne Geschenkpapier, sie sagte nur: „Hier, Kind, dein Geschenk.“
Ich weiß nicht, warum sie manchmal so war. Ob sie sich mit meinem Vater gestritten hatte oder sich in Momenten wie diesen überfordert fühlte. Trotzdem war es für mich eine zwiespältige Situation: Ich hatte genau das Geschenk bekommen, das ich wollte, gleichzeitig schien mit meinen Wünschen an sich etwas nicht in Ordnung zu sein. Ich fragte mich, ob das Wünschen verboten war. Aber je länger ich darüber nachdachte, desto sicherer war ich, dass das Wünschen im Prinzip nicht falsch war. Meine Wünsche waren okay und die Wünsche der anderen auch. Ich konnte den Klassenkameraden nicht vorwerfen, dass sie erfüllt bekamen, wonach ich selbst mich vergeblich sehnte. Und ich konnte meiner Mutter ihre Launen nicht vorwerfen, die vermutlich bloß damit zu tun hatten, dass auch sie sich etwas wünschte. Das Wünschen war gut und richtig, es war bloß ungerecht, wie die Welt damit umging.
Sabsi und ich hatten meist eine schöne Zeit. Der Alltag zu Hause ließ die Klassenkameraden spätestens nachmittags in Vergessenheit geraten. Solange wir unter uns waren, fiel nicht auf, dass wir kein Geld hatten und die Wohnung ein bisschen klein war. Nur auf den Familienfesten öffnete sich der Blick dann ins Weite, wir fuhren zu Kindstaufen und Hochzeiten, wurden zu diesen Anlässen in die festliche Variante unserer Zwillingskluft gesteckt, und dann schliefen wir auf den Matratzen, die als improvisierte Schlafstätte von den Erwachsenen in einen fremden Raum getragen wurden. Wir schliefen in großen Häusern und in den Seitenflügeln der angemieteten Festsäle, und es fehlte plötzlich die Zimmerdecke, die zu Hause im Dreierstockbett auf Armeslänge stets über mir schwebte. Ich starrte in das entfernte Dunkel, das wie das Versprechen der anderen Möglichkeiten erschien.
Interview mit Kristina Vogel
Worum geht es in deinem Buch?
Manchmal denke ich, die Menschen glauben, dass ich eine Resilienz-Maschine bin. Ich bin aber nicht so bärenstark auf die Welt gekommen, sondern mit den Menschen und Erlebnissen die Person geworden, die ich jetzt bin.
Viele wissen, dass ich Olympiasiegerin und Weltmeisterin bin. Ich erzähle im Buch aber vor allem, wie ich es geschafft habe, meine zwei schweren Schicksalsschläge zu überwinden.
Was war die Herausforderung beim Aufschreiben deiner Geschichte?
Es war eine sehr intensive Zeit. Ich wollte absolut ehrlich sein. Ich habe viele Momente in meinem Leben reflektiert und beleuchtet. Für mich waren es Therapiestunden. Es hat mir viel abverlangt, mich und mein Leben zu reflektieren, ich bin aber wirklich stolz auf das Geschriebene. Ich muss immer wieder weinen und lachen. Jedes Mal wieder.
Wer sollte dein Buch lesen?
Von Radsportverrückten bis zu Menschen, die einfach eine gute Zeit haben wollen.
Ich wollte, dass mein Buch Menschen hilft – und wenn nicht, dass sie wenigstens eine gute Zeit beim Lesen haben.
Worauf freust du dich 2021?
Der Unfall hat mich lernen lassen, dass alles geht und nichts muss.
Ich darf jeden Tag neue Abenteuer leben und an Herausforderungen wachsen.
Das möchte ich für 2021 und für jeden weiteren Tag!
„›Immer noch Ich. Nur anders‹ ist gut, kurzweilig und mit sehr viel Humor geschrieben. Lachen, Weinen, Schmunzeln – es ist alles dabei. Am Ende des Buches kann man nur von Kristina Vogel beeindruckt sein, mit welcher Stärke und Mut sie ihrem neuen Leben begegnet und somit zum Vorbild von unzähligen Menschen wurde.“
„Dies ist das Porträt einer außergewöhnlichen Frau mit einem imponierenden Charakter. Es ist zu spüren, dass sie nicht mehr den Erwartungen anderer gerecht werden will und selbstbestimmter leben will. Ihr Umgang mit ihrem Unfall und dem Ende ihrer Karriere ist bemerkenswert. Leser können daraus viel mitnehmen für sich selbst.“
„Das Buch wirkt ehrlich – es ist spannend zu lesen und daher eine Empfehlung.“
„Das ist wirklich gelungen.“
„Die Gänsehaut verschwindet beim Lesen nicht.“
„Kristina Vogel hat, wie ihr Buch eindrucksvoll beweist, viel zu erzählen.“
„Ihre auch für Radsportfremde sehr empfehlenswerte Autobiografie ist ein mitreißend und erfrischend selbstironisch verfasstes Mutmachbuch, das einem die Tränen des Mitgefühls oder der Freude in die Augen treibt: eine Hommage an das Glück der kleinen Dinge.“
„Vogel erzählt in ›Immer noch ich. Nur anders‹ von den Mühen, sich ein Stück Alltag zurückzuerobern. Sie tut dies in einem leichten, niemals klagenden Ton.“
„Als ich die Geschichte gelesen habe, war ich total fasziniert, wie sie mit ihrem Schicksalsschlag umgeht. Es hat mich zum Nachdenken gebracht.“
„Packend und ehrlich schildert sie die entscheidenden Momente ihrer Karriere.“
„Mich hat es total geflasht, wie viel Lebensfreude sie versprüht, was für eine positive Energie sie hat.“
„Bewegende, reflektierende Einsichten und Bekenntnisse. Auf jeden Fall ein Buch, das man nicht so einfach wieder aus der Hand legt.“
„Sie lässt uns ohne zu klagen und zu jammern teilhaben an ihrem Weg und beeindruckt mit ihrer Offenheit.“
„Bewundernswert, inspirierend.“
„Ein sehr persönliches, auch mutmachendes Buch“
„Trotz der Umstände schafft sie es dabei, witzig zu sein und den Lesern so manches mal ein Lachen zu entlocken.“












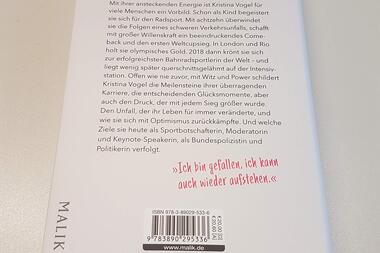

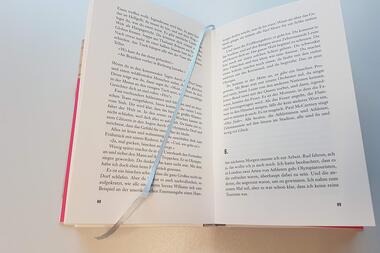
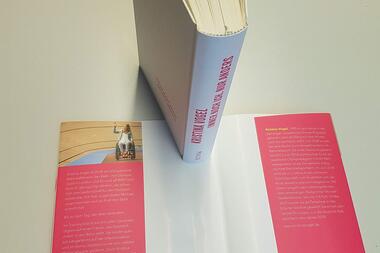
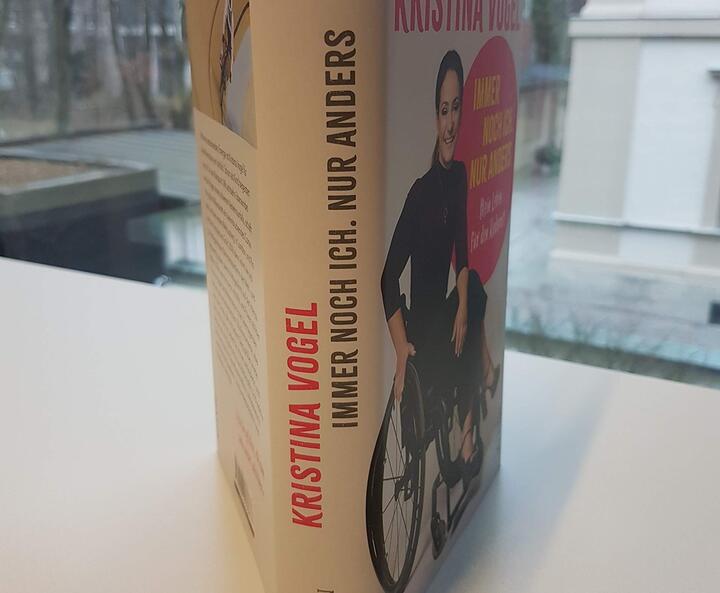
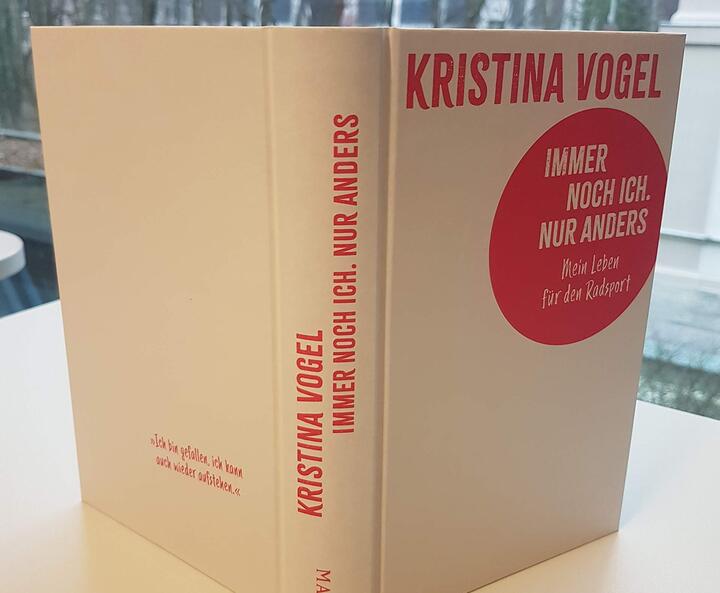
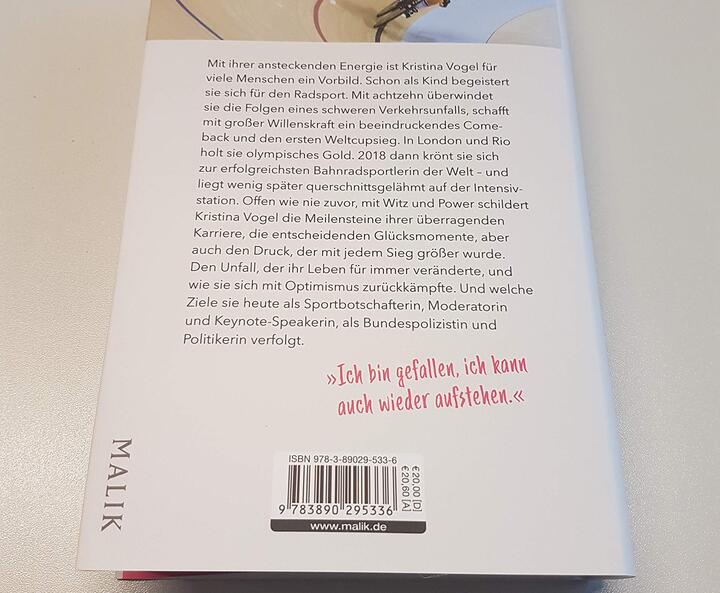

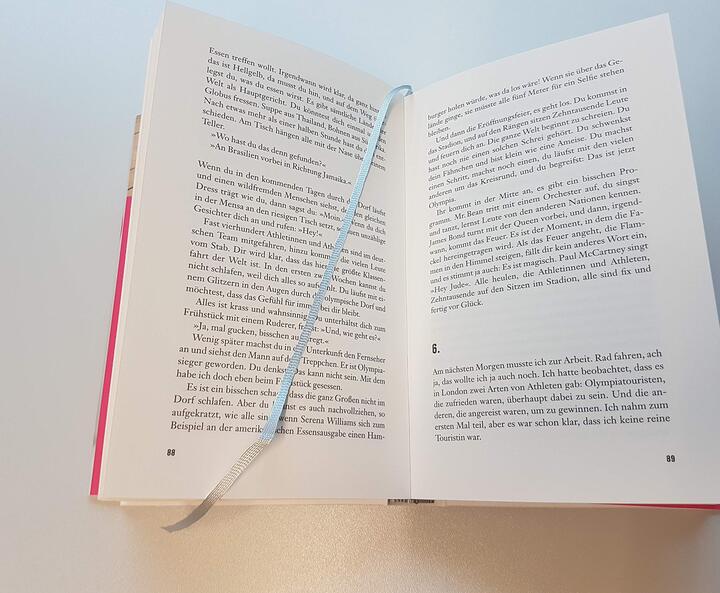




DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.