
Ich war schon immer ein Rebell - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„ ›Ich war schon immer ein Rebell‹ hebt sich von den meisten Fußballer-Biographien positiv ab, da es nicht nur viele Nuancen des Fußballs und ehrliche, teilweise auch selbstkritische Episoden aus Lienens Leben enthält, sondern auch wunderbar von ihm selbst geschrieben ist. So hat sich Ewalds oft zitierte „Zettelwirtschaft“ jetzt in ein rundum gelungenes Buch für jeden Fußballinteressierten verwandelt.“
boersenblatt.netBeschreibung
Seit Ewald Lienen bei Borussia Mönchengladbach legendärer Linksaußen war, weckt er extreme Gefühle bei Fans und Fachleuten. Als Spieler, Trainer und Fußballfunktionär ist er bis heute ein Querdenker, ein leidenschaftlicher Rebell auf und neben dem Platz. Für einen Sternmarsch ließ er als Spieler schon mal das Training ausfallen, seine politische Haltung kostete ihn die WM 1978, und als Trainer handelt er sich mit seiner Akribie den Beinamen „Zettel-Ewald“ ein. Ewald Lienen ist eine einzigartige Gestalt im Profi-Fußball, in seiner Autobiografie erzählt er offen von sich, dem Fußball und seinem…
Seit Ewald Lienen bei Borussia Mönchengladbach legendärer Linksaußen war, weckt er extreme Gefühle bei Fans und Fachleuten. Als Spieler, Trainer und Fußballfunktionär ist er bis heute ein Querdenker, ein leidenschaftlicher Rebell auf und neben dem Platz. Für einen Sternmarsch ließ er als Spieler schon mal das Training ausfallen, seine politische Haltung kostete ihn die WM 1978, und als Trainer handelt er sich mit seiner Akribie den Beinamen „Zettel-Ewald“ ein. Ewald Lienen ist eine einzigartige Gestalt im Profi-Fußball, in seiner Autobiografie erzählt er offen von sich, dem Fußball und seinem Leben, das in einfachen Verhältnissen begann und ihn national und international in die höchsten Fußballligen führte.
Über Ewald Lienen
Aus „Ich war schon immer ein Rebell“
Prolog
Und immer wieder dieses Foul
Bonavista, Portugal im Juni 2018. Unser Feriendomizil liegt auf einer Anhöhe in einem Wohngebiet, bestehend aus vielleicht achtzig Häusern. Geschmackvoll gestaltete Gebäude, denen man ansieht, dass sich ihre Eigentümer die absolute Ruhe, die hier zu finden ist, etwas haben kosten lassen. Hell getünchte Hauswände, handgeformte beige Dachziegel, adrett gepflegte Gärten mit Pool. Vormittags huschen Heerscharen von Domestiken und Handwerkern über die Grundstücke, um die betrauten Objekte instand zu halten. 20 Grad sind für diese [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Ewald Lienens Buch ist nicht nur ein Buch über den Fußball und ihn, es ist ein Sittengemälde eines halben Jahrhunderts in Deutschland.“
Westdeutsche Zeitung„In seiner Autobiografie entpuppt (Ewald Lienen) sich als fesselnder Erzähler.“
Südkurier Konstanz„Ewald Lienens Buch ist ein Buch über einen Protagonisten des Fußballs – es ist aber vor allem ein Sittengemälde der Fußballwelt und damit auch unserer Gesellschaft.“
Stader Tageblatt„Spannend erzählt … glaubwürdig und sympathisch.“
Junge Welt„Ein lesenswertes Buch, das einen erkenntnisreichen Blick hinter die Kulissen eines Sports gewährt, dessen eigentlicher Wert hinter seiner gnadenlosen Vermarktung zu verschwinden droht.“
Elbe Wochenblatt„eine außergewöhnliche Biografie“
Die ZEIT - Online„Lienen wollte stets Mensch bleiben, bei aller Härte des Geschäfts. Das Buch gibt beeindruckendes Zeugnis, dass ihm das gelungen ist.“
11 Freunde„ ›Ich war schon immer ein Rebell‹ hebt sich von den meisten Fußballer-Biographien positiv ab, da es nicht nur viele Nuancen des Fußballs und ehrliche, teilweise auch selbstkritische Episoden aus Lienens Leben enthält, sondern auch wunderbar von ihm selbst geschrieben ist. So hat sich Ewalds oft zitierte „Zettelwirtschaft“ jetzt in ein rundum gelungenes Buch für jeden Fußballinteressierten verwandelt.“
boersenblatt.netProlog – Und immer wieder dieses Foul
»Da müsste mir schon ein Stein auf den Kopf fallen …« – Kindheit und Jugend, 1953 bis 1974
Wie alles begann
Oktober 1965 – Die große Zäsur
„Was soll eigentlich mal aus Ihnen werden?“
„Nur Fußball reicht mir nicht“ – Mein Leben als Spieler, 1974 bis 1981
Der Kulturschock
Das letzte Jahr auf der Alm
Der Wechsel auf den Bökelberg
Oktober 1978 – Die große Liebe
Der „linke Lienen“
»Eigentlich wollte ich immer aufhören …« – Vom Spieler zum Trainer, 1981 bis 1993
Die Rückkehr auf die Alm
Der nächste Wechsel zurück
Pläne, von denen ich nichts wusste
„Fußball ist dein Leben!“ – Erste Stationen als Profitrainer, 1993 bis 2002
Lehrjahre mit wenig Leerlauf
Tranquilo, tranquilo
Rückkehr nach Deutschland
Emotionen und Jeföhle
„Ungeplant, unerträglich, unglaublich!“ – Von Teneriffa bis St. Pauli, 2002 bis 2017
Ungeplante Intermezzi
Unerträgliche Machtspiele
Apistefto – unglaublich!
Eine Pause und drei kurze Zwischenspiele
Besetzt, betrogen und pleite
Welcome to the hell
Gestern, heute, morgen
Rückblicke und Einblicke
Die Zukunft des Fußballs
Epilog – Ein ewig Lernender
Dank
Die wichtigsten Stationen meines Lebens








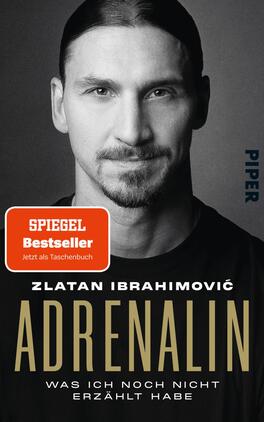

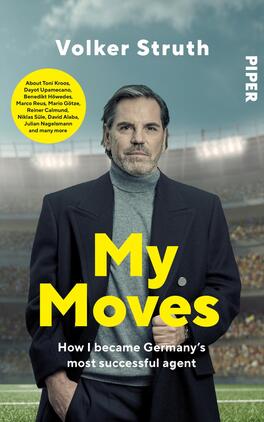


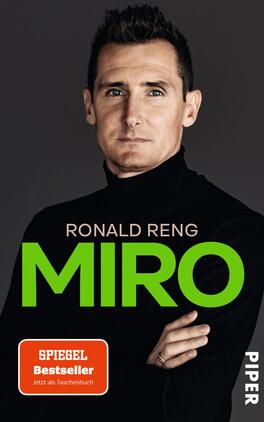





Die erste Bewertung schreiben