
Ich bin eine andere - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Eine wahre Geschichte, packend und eindringlich erzählt.“
AllegraBeschreibung
Dilan ist eine lebenslustige junge Frau mit einem guten Job und vielen Freunden, doch ihren wahren Namen und ihre Geschichte kennt niemand. Als Kind flüchtete sie mit ihrer jesidisch-kurdischen Familie aus dem Irak. Ihr Vater ersticht die Mutter, als Dilan 12 Jahre alt ist. Der älteste Bruder rächt die Tat und kommt ins Gefängnis, danach wird der Onkel das Oberhaupt in der Familie, er drangsaliert und misshandelt die sechs Kinder. Es kommt zum Machtkampf zwischen Onkel und Brüdern. Dilan flieht und wendet ihr Schicksal – sie baut sich ein unabhängiges Leben auf. Mit diesem Buch möchte sie…
Dilan ist eine lebenslustige junge Frau mit einem guten Job und vielen Freunden, doch ihren wahren Namen und ihre Geschichte kennt niemand. Als Kind flüchtete sie mit ihrer jesidisch-kurdischen Familie aus dem Irak. Ihr Vater ersticht die Mutter, als Dilan 12 Jahre alt ist. Der älteste Bruder rächt die Tat und kommt ins Gefängnis, danach wird der Onkel das Oberhaupt in der Familie, er drangsaliert und misshandelt die sechs Kinder. Es kommt zum Machtkampf zwischen Onkel und Brüdern. Dilan flieht und wendet ihr Schicksal – sie baut sich ein unabhängiges Leben auf. Mit diesem Buch möchte sie andere Frauen ermutigen, den Weg in die Freiheit zu wagen.
Über Dilan S.
Aus „Ich bin eine andere“
Ja, wer bin ich? Meine Mutter gab mir einen Namen, unter dem ich Jahre einer glücklichen Kindheit erlebte, erst inmitten meiner jesidisch-kurdischen Großfamilie in unserem irakischen Heimatdorf, wo ich mit meiner gleichaltrigen Tante Höhlen baute und Friseurin spielte; dann in einem kleinen Ort in Brandenburg, in dem ich bei Frau Meier in der Küche Zitronenkuchen aß. Als Schulkind in einem baden-württembergischen Dorf entdeckte ich meine Leidenschaft fürs Kicken. Da war ich noch ein neugieriges Kind, das viele Fragen hatte, vorlaut in der Schule war, gern den [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
INHALT
1 Wer bin ich?
2 Incognito
3 Irgendwo in Afrika
4 Kuhfladen und Dattelbaum
5 Schwarzköpfe
6 Kurdische Hochzeit
7 Ich bin Maria
8 Unter den Jesiden
9 Die Mordnacht
10 Waisenkind
11 Mitternachtsgespenst
12 Ferhats langer Schatten
13 Deutschunterricht mit Anjela Merrrrkell
14 Dogan und Aida
15 Unter Brüdern
16 Wie ich eine andere wurde
17 Kein Zurück
18 Das erste Mal
19 Der Notruf
20 Persische Porzellanpuppe
21 Lerne, glücklich zu sein!
22 Meine Sonnenblumen
Dank




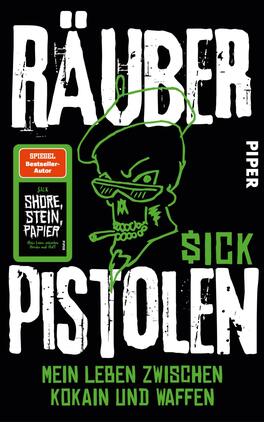
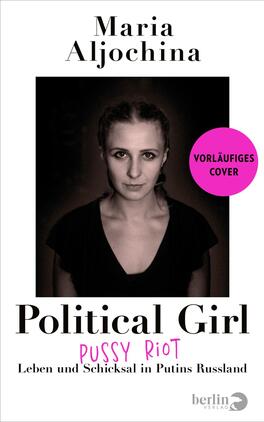
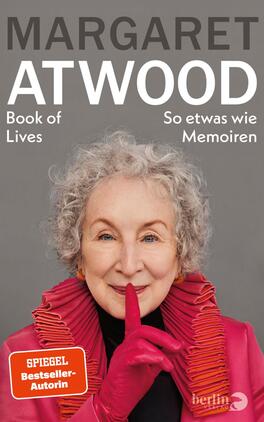

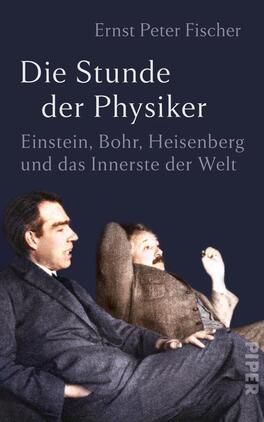





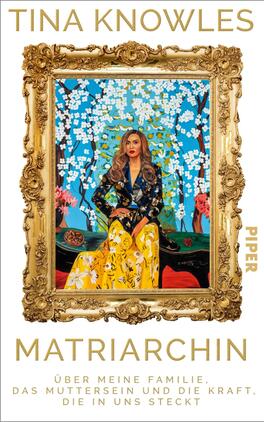

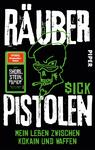

Die erste Bewertung schreiben