Produktbilder zum Buch
Gebrauchsanweisung für Tokio und Japan
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Sumo, Sony und Sashimi: So viel Japan kennt jeder. Mangas, Karaoke und andere Importe gehören längst auch bei uns dazu – und doch ist uns ihre Heimat fremd. Andreas Neuenkirchen entschlüsselt aufs Unterhaltsamste Land und Leute. Er verrät, wie Sie in Restaurants und Privathaushalten, in buddhistischen Tempeln, beim Small Talk oder in Geschäftsverhandlungen glänzen. Welche Speisen schmecken – und vor allem, wie man sie isst. Sie erfahren, was Sie mit Stäbchen zu tun und zu lassen haben und was es mit dem Mythos vom Schlürfen auf sich hat. Wie Japaner Erdbeben trotzen und Protestkultur leben.…
Sumo, Sony und Sashimi: So viel Japan kennt jeder. Mangas, Karaoke und andere Importe gehören längst auch bei uns dazu – und doch ist uns ihre Heimat fremd. Andreas Neuenkirchen entschlüsselt aufs Unterhaltsamste Land und Leute. Er verrät, wie Sie in Restaurants und Privathaushalten, in buddhistischen Tempeln, beim Small Talk oder in Geschäftsverhandlungen glänzen. Welche Speisen schmecken – und vor allem, wie man sie isst. Sie erfahren, was Sie mit Stäbchen zu tun und zu lassen haben und was es mit dem Mythos vom Schlürfen auf sich hat. Wie Japaner Erdbeben trotzen und Protestkultur leben. Wie Olympia Tokio in eine Baustelle verwandelt. Und was es braucht, um ein rosa Spitzenhäubchen auf besonders männliche Weise zu tragen.
Über Andreas Neuenkirchen
Aus „Gebrauchsanweisung für Tokio und Japan“
Hello Kitty lebt hier nicht mehr
Keine Sorge, ganz so schlimm ist es doch noch nicht gekommen. Aber wo ich Ihre Aufmerksamkeit habe: Japan ist im Wandel. Ein Satz, so beliebig, dass man ihn am liebsten gleich wieder streichen möchte. Nichtsdestotrotz kann man kaum bestreiten, dass seine Kernaussage in mehr als einer Hinsicht stimmt. Die Gesellschaft transformiert sich ebenso schnell wie die Szenerie. Die Alten werden immer älter, Neugeborene kommen kaum nach. In Tokio lebt es sich wie auf einer Baustelle: Jeden Abend fragt man sich vor dem Einschlafen, welches Haus [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Hello Kitty lebt hier nicht mehr
Hajimemashite! Von Kontakt und Kommunikation und anderem Unvermeidlichen
Ein Kanpai der Gemütlichkeit
Essen und einkaufen wie die Götter
Kirschblüten, Killerspiele und andere Freizeitvergnügen
Männer im Ring, Frauen am Ball und eine neue Hauptstadt für Olympia
Von Innenmenschen, Außenmenschen und Halbwesen
Alles daijoubu nach 3/11?
Geschlechterrollen und Beziehungskisten: Frauen & Männer
Mein erstes japanisches Wort (und der ganze Rest)
Essen und was hinten rauskommt: Film & Fernsehen
Kunstoffplatten & Plastikpop
Epilog: Lob & Tadel
Arigatō gozaimasu

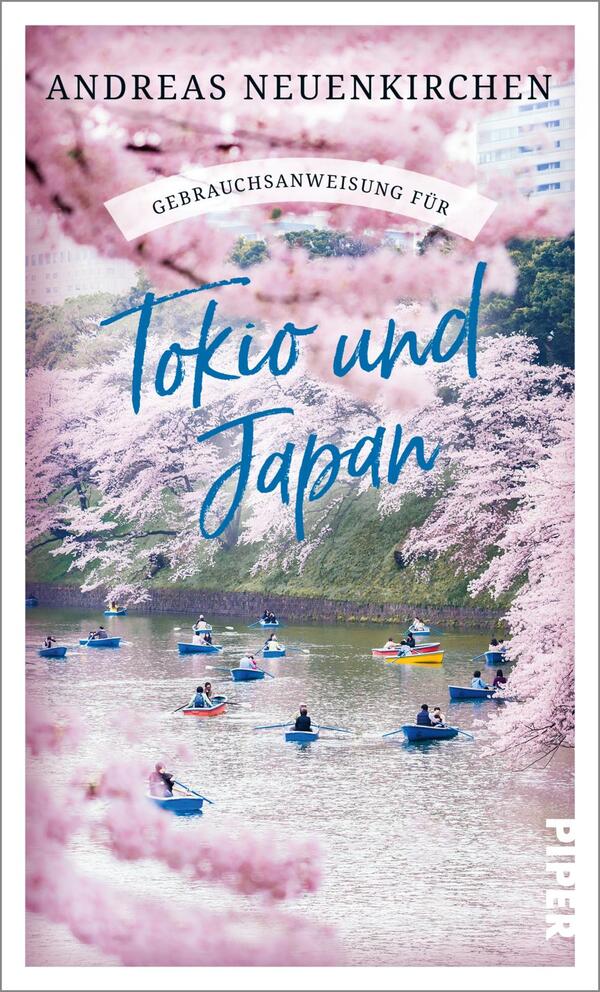
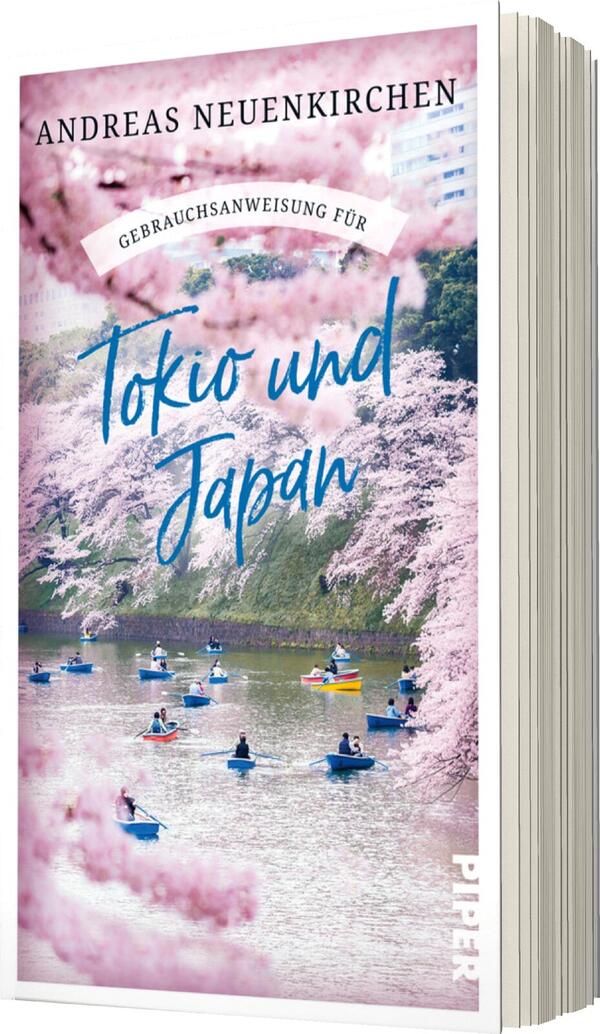











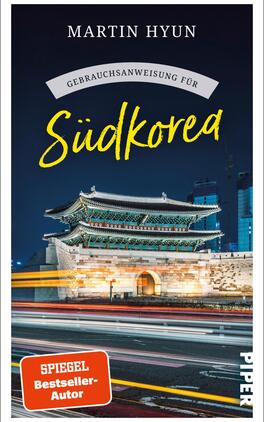
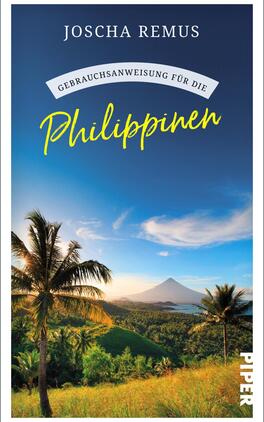
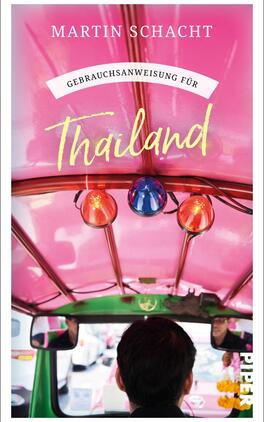
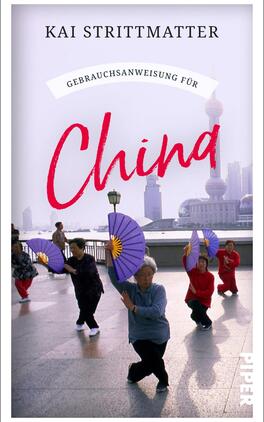


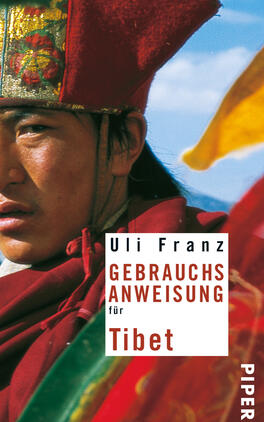


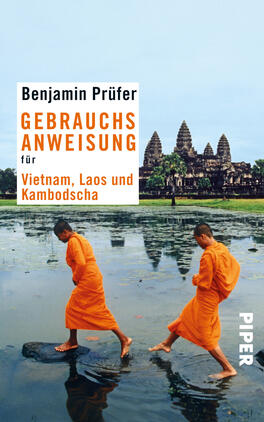

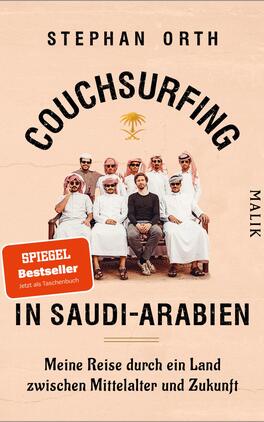



Die erste Bewertung schreiben