
Gebrauchsanweisung für das Engadin - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Mit dem Blick der Fremden-Einheimischen ist ihr eine kenntnisreiche Hommage gelungen, geordnet nach dem Alphabet, angereichert mit Recherchen, Erfahrungen, Interviews und Gesprächen: ein Must für alle Neugierigen mit Sinn fürs Besondere.“
Schaffhauser Nachrichten (CH)Beschreibung
Tiefblaue Seen, sonnenbestrahlte Schneegipfel - mit seiner extremen Landschaft und dem einzigartigen Licht gehört das Engadin zu den spektakulärsten Ferienzielen der Alpen. Angelika Overath stellt die bedeutendsten Orte und schönsten Landschaften vor, von Scuol bis Sils, vom Corvatsch bis ins Münstertal, und gibt spannende Geheimtipps. Sie erklärt, warum die Alpenpässe Eisenbahnfans begeistern und Autofahrern den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Wieso sich Engadiner Spezialitäten nicht zum Abnehmen eignen und wie die uralte romanische Sprache, in der es „Bun di“ und „Chau“ heißt, in dieser…
Tiefblaue Seen, sonnenbestrahlte Schneegipfel - mit seiner extremen Landschaft und dem einzigartigen Licht gehört das Engadin zu den spektakulärsten Ferienzielen der Alpen. Angelika Overath stellt die bedeutendsten Orte und schönsten Landschaften vor, von Scuol bis Sils, vom Corvatsch bis ins Münstertal, und gibt spannende Geheimtipps. Sie erklärt, warum die Alpenpässe Eisenbahnfans begeistern und Autofahrern den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Wieso sich Engadiner Spezialitäten nicht zum Abnehmen eignen und wie die uralte romanische Sprache, in der es „Bun di“ und „Chau“ heißt, in dieser Kulturregion weiterlebt. Vom mondänen Oberengadin bis hinunter zum schroffen, noch bäuerlichen Unterengadin ermöglicht sie faszinierende Einblicke in eines der schönsten Täler der Schweiz.
Über Angelika Overath
Aus „Gebrauchsanweisung für das Engadin“
Vorwort
Seit neun Jahren leben wir im Unterengadin, in Sent, einem Dorf auf einer Sonnenterrasse 1450 Meter über dem Meeresspiegel. Etwa 300 Meter tiefer fliesst der Inn. Unser jüngster Sohn Matthias kam mit sieben Jahren in die zweite Klasse der rätoromanischen Volksschule in Sent; mit fünfzehn Jahren ging er nach Chur auf die weiterführende Kantonsschule. Während der Schulzeiten kommt er nur noch an den Wochenenden nach Hause.
Unsere beiden erwachsenen Kinder Silvia und Andreas studieren in Deutschland. Aber sie besuchen uns regelmässig im Tal; beide haben in den [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Voller Zuneigung entwirft sie das Panorama einer Region. (...) Sie taucht ein in die Sprache, die Geschichte und die Gemeinschaft der Engadiner.“
Piz Magazin (CH)„Erstaunlich, wie sie dem schon so oft beschriebenen Engadin neue, überraschende Seiten abgewinnt. Die 43 Geschichten lesen sich leicht und stimmen so richtig ein auf den Moment, da man aus dem Tunnel in die Sonne des Engadins fährt.“
Die Alpen (CH)„Indes ist nun auch das Engadiner Literaturwerk mit Angelika Overaths ›Gebrauchsanweisung für das Engadin‹ um einen Glanzpunkt reicher und bietet selbst für eingefleischte Kenner die eine oder andere Novität.“
Der Schrittler„Engadin ist eine sehr sehenswerte Gegend, die man mit diesem Buch schon einmal lesend bereisen kann.“
AutoRevue (A)„Ein sehr informatives, interessantes und feinfühlig recherchiertes Buch. (...) Engadin zum ›Erlesen‹.“
(A) Bibliotheksnachrichten„Mit dem Blick der Fremden-Einheimischen ist ihr eine kenntnisreiche Hommage gelungen, geordnet nach dem Alphabet, angereichert mit Recherchen, Erfahrungen, Interviews und Gesprächen: ein Must für alle Neugierigen mit Sinn fürs Besondere.“
Schaffhauser Nachrichten (CH)



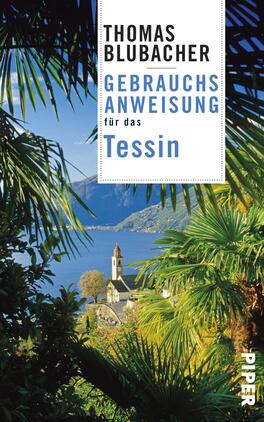






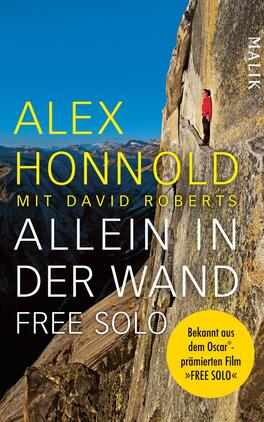
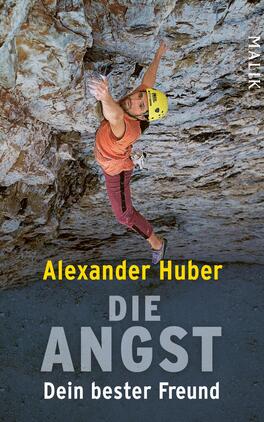






Die erste Bewertung schreiben