Produktbilder zum Buch
Die Krankenschwester von St. Pauli – Tage des Schicksals (Die St. Pauli-Saga 1)
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Eine Krankenschwester muss sich in der Hamburger Familiensaga behaupten: historischer Roman mit starken Frauen
Eine junge Krankenschwester muss sich in der Cholera-Epidemie beweisen und kämpft um die Liebe ihres Lebens. Für Leserinnen von „Die Ärztin“ und „Die Charité“.
1885 – Svantje Claasen ist dreizehn Jahre alt, als ein Hochwasser den elterlichen Hof im Alten Land zerstört und die Familie gezwungen ist, nach Hamburg zu ziehen. Im lauten und überfüllten Gängeviertel der Stadt lernt Svantje schnell, sich durchzukämpfen. Doch das Elend lässt sie nicht los, und so beschließt die junge Frau,…
Eine Krankenschwester muss sich in der Hamburger Familiensaga behaupten: historischer Roman mit starken Frauen
Eine junge Krankenschwester muss sich in der Cholera-Epidemie beweisen und kämpft um die Liebe ihres Lebens. Für Leserinnen von „Die Ärztin“ und „Die Charité“.
1885 – Svantje Claasen ist dreizehn Jahre alt, als ein Hochwasser den elterlichen Hof im Alten Land zerstört und die Familie gezwungen ist, nach Hamburg zu ziehen. Im lauten und überfüllten Gängeviertel der Stadt lernt Svantje schnell, sich durchzukämpfen. Doch das Elend lässt sie nicht los, und so beschließt die junge Frau, Krankenschwester zu werden, um den Menschen das Leben in den armen Vierteln erträglicher zu machen.
Als sie sich schließlich in den weltoffenen Tuchhändler Friedrich Falkenberg verliebt, muss Svantje gegen gesellschaftliche Konventionen und für eine gemeinsame Zukunft kämpfen. Dann bricht 1892 eine verheerende Choleraepidemie in Hamburg aus, und die junge Krankenschwester kann sich endlich beweisen …
Autorin Rebecca Maly wurde mit dem Delia-Preis ausgezeichnet. „Die Krankenschwester von St. Pauli – Tage des Schicksals“ ist der erste Teil einer Trilogie, in der Svantje Claasen als starke Frau die Emanzipation greifbar macht. Die Liebesgeschichte bietet alles, was das Herz begehrt: große Gefühle, historisches Setting und eine Krankenschwester, die für das kämpft, was ihr wichtig ist.
Historische Roman-Reihe in realistischem Krankenhaus-Setting
Von der Cholera zur Arbeiterbewegung, von verhinderten Hochzeiten und erzwungenen Berufen: Rebecca Maly bereichert die Liebesgeschichte in „Die Krankenschwester von St. Pauli – Tage des Schicksals“ mit einem gut recherchierten historischen Hintergrund, der die zeitgenössischen Probleme der Protagonisten greifbar macht. Und dass, ohne die Spannung auch nur eine Minute aus den Augen zu lassen.
Weitere Titel der Serie „Die St. Pauli-Saga“
Über Rebecca Maly
Aus „Die Krankenschwester von St. Pauli – Tage des Schicksals (Die St. Pauli-Saga 1)“
„Ich habe noch nie solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für jeden Ansteckungskeim angetroffen wie in den sogenannten Gängevierteln, die man mir gezeigt hat, am Hafen, an der Steinstraße, an der Spitalerstraße oder an der Niedernstraße. […] Ich vergesse, dass ich mich in Europa befinde.“ Robert Koch, 1892
1
Altes Land, 1885
Svantje zerrte mit aller Kraft an den Stricken, doch die beiden Ziegenböcke blieben stur. Erst als Mutter drohend den Stock hob, warfen sie sich wieder ins Geschirr und zogen den hoch beladenen Karren vorwärts.
»Du darfst nicht so [...]














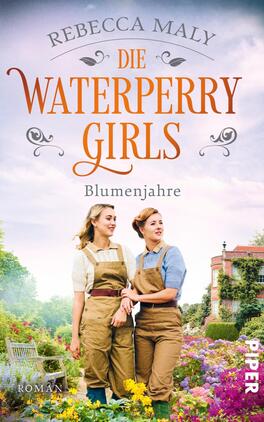

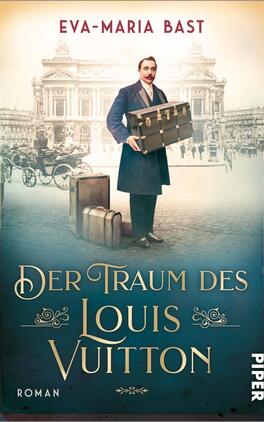






Bewertungen
Zwischen Hammer und Amboss
'Die Krankenschwester von St. Pauli - Tage des Schicksals' ist ein historischer Roman der Autorin Rebecca Maly. Der Roman bildet den ersten Band der Saga um die Krankenschwester Svantje Claasen mit den Titel 'Die Krankenschwester von St. Pauli'.
Ich finde das Cover gut und passend zum Inh…
'Die Krankenschwester von St. Pauli - Tage des Schicksals' ist ein historischer Roman der Autorin Rebecca Maly. Der Roman bildet den ersten Band der Saga um die Krankenschwester Svantje Claasen mit den Titel 'Die Krankenschwester von St. Pauli'.
Ich finde das Cover gut und passend zum Inhalt und der Zeit gewählt. Mir gefällt es sehr und ich habe es während des Lesens immer wieder gerne betrachtet.
Die Geschichte umfasst einundzwanzig Kapiteln sowie eine Epilog mit Ausblick auf den nächsten Band. Den Einstieg ins Jahr 1885 fand ich gelungen. Auch der Sprung ins Jahr 1890 ist stimmig gestaltet, vor allem mit den kurzen Erinnerungen zwischendrin an die fünf Jahre dazwischen. Man darf Svantje zwei Jahre begleiten - und ich muss sagen diese sind sehr spannend! Ich freue mich bereits sie wiederzusehen und werde die weiteren Bände bestimmt verfolgen!
Fazit: Mit so manchen Wörtern (ich weiß nicht ob diese Hamburgisch waren?) hatte ich mir etwas schwer getan und es irgendwann aufgegeben jedes nachzuschlagen - vorallem da ich einige davon überhaupt nicht finden konnte, bei Seivel z.B. hat sogar das Internet aufgegeben und mir nichts sinnvolles ausgespuckt... Es hat, muss ich leider gestehen, doch meine Lesefreude getrübt aber ich fand es hatte auch etwas Charme und verlieh dem ganzen mehr Glaubwürdigkeit. Ich habe lange geschwankt wohin ich mehr tendiere und alles zusammengenommen fand ich es dennoch störend und ziehe deshalb einen Stern ab.
Ein richtig tolles Buch
1885 - Svantje, ein junges Mädchen mit großen Träumen. Durch ein Hochwasser von einem Bauernhof ins Gängeviertel von Hamburg katapultiert muss sie lernen, mit dem Elend und Leid der dortigen Bewohner zu leben. Der kleine Bruder springt dem Tod gerade noch einmal von der Schippe und nun steht ihr Tr…
1885 - Svantje, ein junges Mädchen mit großen Träumen. Durch ein Hochwasser von einem Bauernhof ins Gängeviertel von Hamburg katapultiert muss sie lernen, mit dem Elend und Leid der dortigen Bewohner zu leben. Der kleine Bruder springt dem Tod gerade noch einmal von der Schippe und nun steht ihr Traumberuf fest – sie möchte Krankenschwester werden. 1890 - 5 Jahre und viele Wasserkarren später hat sie endlich ihr Ziel erreicht – sie ist offiziell Krankenschwester und freut sich darauf, ihrem Beruf endlich nachgehen zu können. Doch nicht alles läuft wie geplant und so muss sie, gegen ihren eigentlichen Willen, ihrer schwangeren Mutter auf deren Arbeitsstelle als Dienstmädchen bei der Reederfamilie Harkenfeld zur Hand gehen. Schnell lernt Svantje dort den Sohn und die Tochter der Familie kennen und freundet sich trotz der Standesunterschiede mit ihnen an. Friedrich Falkenberg, ein Freund des Sohnes, kreuzt immer wieder ihren Weg und Svantje verliebt sich in ihn. Aller Widrigkeiten zum Trotz entsteht aus dieser Verliebtheit eine Verbindung. Doch das Glück währt nur kurz. Als eine Choleraepedemie ausbricht, ist niemand vor ihr sicher. Weder die Menschen im Gängeviertel noch die reichen Reedereibesitzer. So steckt sich auch Friedrich mit Cholera an und plötzlich müssen alle an einem Strang ziehen. Raik, der in der sozialistischen Arbeiterbewegung seine Erfüllung findet, Hilde Harkenfeld, die gegen ihren Willen mit einem Kollegen ihres Vaters verheiratet wird und daraufhin in die Frauenbewegung eintritt. Svantje, die alles gibt, um zu helfen. Rebecca Maly hat einen ersten fesselnden Teil geschaffen, der eindrücklich zeigt, wie es zu dieser Zeit gewesen sein muss.