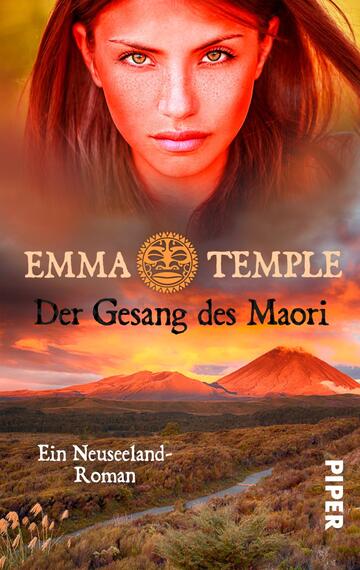
Der Gesang des Maori (Im Land der tausend Wolken 2)
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Der große Traum vom Glück am anderen Ende der Welt in Neuseeland: Ein uraltes Geheimnis, das bis heute über Liebe und Hass, über das Schicksal vieler Menschen bestimmt - für alle Fans von Sarah Lark
Die Journalistin Katharina soll für ihre Zeitschrift eine Reportage über Neuseeland schreiben. Sie ist begeistert: Endlich kann sie ihre Freundin Sina wieder treffen, die mit ihrer Familie glücklich in Christchurch lebt. Doch kurz nach Katharinas Ankunft überschlagen sich die Ereignisse: Ein Erdbeben verwüstet die Stadt und Sinas kleine Tochter erkrankt schwer. Auf der Suche nach Hilfe begegnet…
Der große Traum vom Glück am anderen Ende der Welt in Neuseeland: Ein uraltes Geheimnis, das bis heute über Liebe und Hass, über das Schicksal vieler Menschen bestimmt - für alle Fans von Sarah Lark
Die Journalistin Katharina soll für ihre Zeitschrift eine Reportage über Neuseeland schreiben. Sie ist begeistert: Endlich kann sie ihre Freundin Sina wieder treffen, die mit ihrer Familie glücklich in Christchurch lebt. Doch kurz nach Katharinas Ankunft überschlagen sich die Ereignisse: Ein Erdbeben verwüstet die Stadt und Sinas kleine Tochter erkrankt schwer. Auf der Suche nach Hilfe begegnet Katharina einem jungen Mann, der sie auf Anhieb fasziniert – und der ein mysteriöses altes Lied singt, das Katharina nicht mehr aus dem Kopf geht. Auf ihrer Reise taucht sie tief ein in die Geschichte der Pazifikinsel und kommt einem uralten Geheimnis auf den Grund, das bis heute über Liebe und Hass, über das Schicksal vieler Menschen bestimmt …





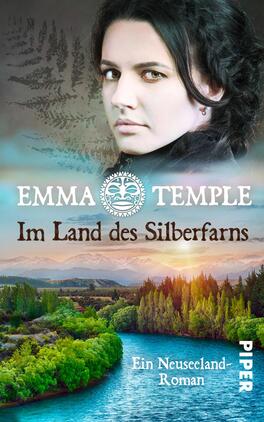
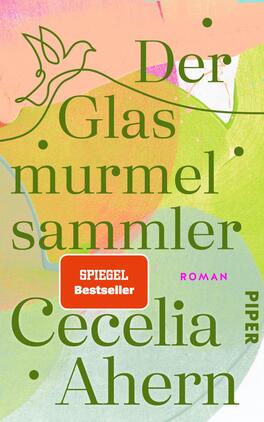












Die erste Bewertung schreiben