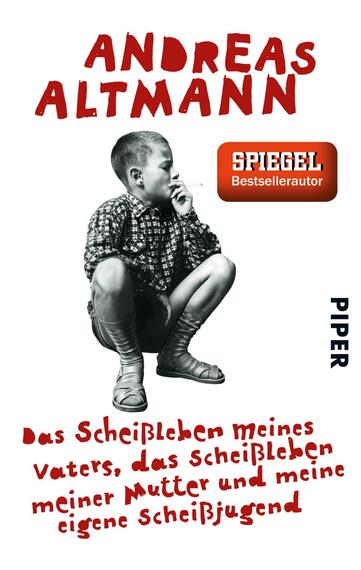
Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Ein wichtiges Buch, in dem der preisgekrönte Reporter, der sonst meist die Menschengeschichten anderer sammelt, sich selbst unter die Haut geht.“
rbb InforadioBeschreibung
Eine Geschichte aus der beschaulichen deutschen Provinz voller Misshandlungen, Demütigungen, bigotter, tätlicher Pfarrer und verkappter Nazis. Andreas Altmann erzählt von seiner Kindheit und Jugend. Und wie am Ende aus einem Opfer ein freier Mensch wird.
Medien zu „Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend“
Über Andreas Altmann
Aus „Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend“
Für meinen Bruder, den einen, den Tapferen.
DER KRIEG / Teil eins
1
Als ich zum ersten Mal in Paris lebte, hatte ich meine Wohnung in Deutschland vermietet. Ich war mir nicht sicher, ob mein Umzug nach Frankreich endgültig sein würde. Eines Morgens bestieg ich panikartig den Zug zurück nach M. Meine Untermieterin, so hatte ich nachts per Albtraum erfahren, war dabei, mein Hab und Gut zu ruinieren.
Bis auf wenige Details war alles wahr. Ich klingelte und da stand die junge Frau. Wie immer schön und, wohl zufällig, nackt. Ich sah die Nackte und die Verwüstung. Die [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Ein furioses Buch. (...) Selten war ein Titel weniger übertrieben (...). Dieser Widerspruchsgeist und sein Sinn für alles Skurrile, sein intelligenter Blick und seine Humanität, machen Altmanns Buch zu einer großartigen und bewegenden Selbstbehauptung.“
ZDF Aspekte„Ein bitteres, ein lesenswertes Buch.“
Thüringische Landeszeitung„Altmann beschreibt erbarmungslos, gnadenlos und schonungslos.“
Tagesanzeiger„Altmann präsentiert auf beiläufig 250 Seiten eine Abrechnung mit dem Vater, wie sie in der an Vaterabrechnungen nicht eben armen Literatur selten ist. Ein menschlich, wie literarisch beeindruckender, ja betäubender Amoklauf (…).“
Süddeutsche Zeitung„Die Lektüre ist schwer erträglich, obwohl der Autor sich einer wunderbar präzisen und reflektierten Sprache bedient.“
Sächsische ZeitungDas Faszinierende an Altmanns 'Scheißleben' ist (...) die Sprache, in die der renommierte Reporter seine Jugenderlebnisse gekleidet hat.«
Spiegel Online„Dieses Buch ist grauenhaft, abstoßend, bestialisch und zugleich überwältigend, poetisch, wahrhaftig und so verdammt richtig, dass es kaum auszuhalten ist.“
Schwäbische Post„Eine gnadenlose Abrechnung mit dem gewalttätigen Vater, der hilflosen Mutter und einer verlogenen, bigotten Kleinbürgerwelt.“
STERN„Einer der brillantesten Reiseautoren unserer Tage.“
ORF 3 - erLesen„Das sprachgewaltige Buch verbirgt unter der derben Oberfläche aber das zarte Geheimnis von einem, der der Hölle gerade noch entkommen konnte.“
Münchner Merkur„In Schilderungen, die eine solche sprachliche Wucht entfalten, dass sie schon beim Lesen fast psychischen Schmerz verursachen, lässt Altmann seine Kindheit und Jugend wieder aufleben.“
Münchner Abendzeitung„Das Buch ist anders, als der brachiale Titel vermuten lässt, und der Autor ist sensibler, als sein Arbeiterführer- Leder- Look suggeriert. Die Schilderungen der väterlichen Gewalt und des mütterlichen Verrats sind erschütternd. Am ergreifendsten aber sind Buch und Lesung, wo er den Abgesang auf die Ehe der Eltern anstimmt.“
Münchner Abendzeitung„Altmanns Buch enthält viel schwarzen Humor- und die Erkenntnis: Sogar mit einer verkorksten Kindheit kann man noch was werden.“
Myself„Ein schmerzendes Buch (…).“
Main-Post Kitzingen„Ein großes Buch. Ein poetisches Buch. Eine bittere Abrechnung: mit Krieg und provinzieller Borniertheit, mit Bigotterie und Gewalt. Eine Streitschrift gegen die Lieblosigkeit der Welt. Von einem, der auszog, nachdem er das Fürchten gelernt hatte.“
MDR TV artour„Ein eindrucksvoller Roman über eine schmerzhafte Menschwerdung und eine Liebeserklärung an die Sprache.“
Kulturspiegel„Der Kisch-Preisträger ist sprachlich auf einem Höhepunkt, selbst die schaurigsten Momente schildert er mit großer Poesie. Demütigung und Selbstironie schließen einander nicht aus. Tief berührend ist auch das Nachwort, in welchem der Autor die mühevolle Auferstehung aus dem Hades seiner Jugend beschreibt. Fazit: Ein Buch, das einen Seite für Seite atemlos macht.“
Kleine Zeitung„Altmann schreibt direkt, klar und einfach. Er beschönigt nichts. “
Fränkischer Tag„Etwas Besseres lässt sich aus einer Scheißkindheit kaum machen.“
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung„Das Buch ist das Beste und Böseste, was seit Thomas Bernhards ›Auslöschung‹, Franz Xaver Kroetz ›Stallerhof‹ und Martin Sperrs ›Jagdszenen aus Niederbayern‹ auf Alpenländisch zu lesen war über die Abgründe des Menschseins. (…) Sein ›Scheißleben…‹ ist ein Politikum, denn es zeigt den Menschen in der Revolte, der sich gegen das Schweigen behauptet. “
Die Zeit„Eine Biografie aus Nachkriegsdeutschland: derb, abrechnend, fesselnd. (…) Unterhalb der rauen Wortoberfläche zeugt ›Scheißleben‹ von Feinfühligkeit, Menschen- und Selbsterkenntnis. (...) Ein gutes Buch übers Schlechte. Und darüber, wie einer gerade noch davonkam. “
Deutschlandradio Kultur„Andreas Altmann schreibt in einer Sprache, die sinnlich und reflektiert zugleich ist.“
Deutschlandradio„Altmanns Buch ist keineswegs nur eine Abrechnung mit seinem Vater (…), sondern auch eine Anklage an die katholische Kirche. (…) Das Buch lebt nicht zuletzt von seinem Nachwort, dem Epilog eines Mannes, der noch einmal davongekommen ist.“
Der Tagesspiegel„Auch Andreas Altmann – Kischpreisträger und reichlich begnadeter Reisereporter – hat lange gebraucht, bis Sprache werden konnte, was seine Scheißjugend war, hat sich gut 20 Jahre therapieren lassen, ist weit weg in die Welt gefahren, um dann doch an den Tatort eines Seelenmordes zurückzukehren.“
Berliner Morgenpost„Ein mitreissendes Buch!“
Bayern 2/Kulturwelt„Diese Lektüre tut weh. Vom ersten Satz an. Geht unter die Haut. Ans Herz. Mehr noch an die Nieren.“
Badische Zeitung„Ein schonungsloser Rückblick auf eine deutsche Nachkriegskindheit.“
BR Lebenslinien„Eine fesselnde Anklageschrift – rücksichtlos gegen sich selbst und andere.“
Augsburger Allgemeine„Andreas Altmann schreibt so intensiv und rotzig, so voller Wut und Leidenschaft, im nächsten Atemzug extrem witzig und schön pointiert. Was er schreibt, berührt, verstört und rührt zu Tränen. Ein tolles Buch!“
Antenne Bayern„Andreas Altmann hat darüber einen furiosen, blitzgescheiten und anrührenden Text geschrieben, eine Abrechnung mit dem Vater und dem bigotten Altötting, der zeigt, dass es die Sprache und das Schreiben waren, die ihm letztendlich das Leben retteten.“
3sat„Andreas Altmann erzählt von Mißhandlungen, Demütigungen, bigotten Pfarrern und verkappten Nazis. Und wie am Ende aus einem Opfer ein freier Mensch wird.“
(CH) Berner Zeitung„Erschütternd- und beglückend, denn Altmann befreit sich aus dieser Kindheit und Jugend mit der Magie der Bücher und der Kraft des Reisens und Schreibens.“
(CH) Annabelle„Ein wichtiges Buch, in dem der preisgekrönte Reporter, der sonst meist die Menschengeschichten anderer sammelt, sich selbst unter die Haut geht.“
rbb Inforadio





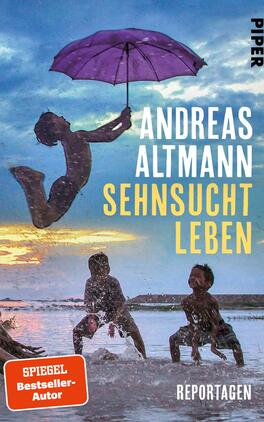








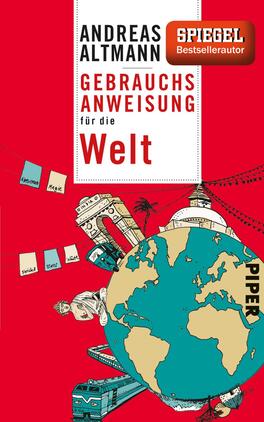




Die erste Bewertung schreiben