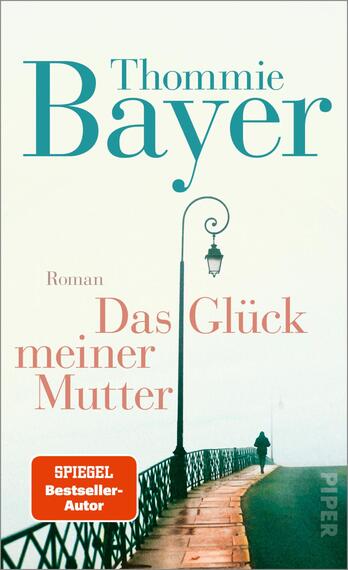
Das Glück meiner Mutter - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Eine Lebenskrise, ein Ferienhaus in Italien, eine fremde Frau und endlich: Antworten
Der Schriftsteller Phillip Dorn nimmt sich eine Auszeit und fährt über die Alpen nach Norditalien. In der Abgeschiedenheit seines Ferienhauses, bei Espresso und Rotwein, lässt er die Gedanken schweifen. Zu Brigitte und nicht zuletzt zu seiner Mutter, der er so nahestand und der er doch den größten Schmerz ihres Lebens zufügte. Eines Nachts reißt eine Fremde ihn aus seinen Erinnerungen, als sie heimlich seinen Pool benutzt. Die beiden kommen ins Gespräch, kommen einander näher - was Phillip nicht weiß, ist,…
Eine Lebenskrise, ein Ferienhaus in Italien, eine fremde Frau und endlich: Antworten
Der Schriftsteller Phillip Dorn nimmt sich eine Auszeit und fährt über die Alpen nach Norditalien. In der Abgeschiedenheit seines Ferienhauses, bei Espresso und Rotwein, lässt er die Gedanken schweifen. Zu Brigitte und nicht zuletzt zu seiner Mutter, der er so nahestand und der er doch den größten Schmerz ihres Lebens zufügte. Eines Nachts reißt eine Fremde ihn aus seinen Erinnerungen, als sie heimlich seinen Pool benutzt. Die beiden kommen ins Gespräch, kommen einander näher - was Phillip nicht weiß, ist, dass sie der Schlüssel zu seiner drängendsten Frage ist.
„Thommie Bayers Romane trösten. Sie sind Balsam für die Seele.“ SWR 2
Über Thommie Bayer
Aus „Das Glück meiner Mutter“
Prolog
Wie oft hatte ich mir als Kind gewünscht, meine Mutter würde diesen kalten, schweigenden Mann verlassen, wie oft versucht, sie dazu anzustiften, aber als sie eines Tages den Mut aufbrachte, kam er mir abhanden.
Ich war in Kathrin aus meiner Klasse verliebt, die mich zwar nicht beachtete, aber das würde sich ändern, wenn ich erst mit meiner Band beim Schulball aufgetreten wäre. Wir probten im Keller unseres Bassisten, dem auch die Gesangsanlage gehörte, weil sein Vater Bauunternehmer war und ihm jeden Wunsch von den Augen ablas. Mitten in More than this von [...]







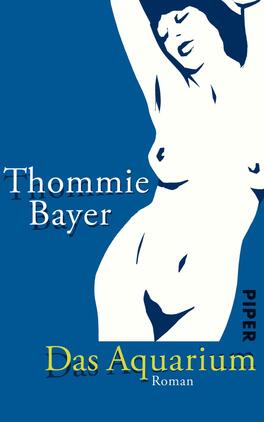




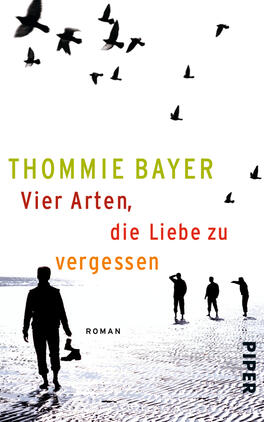

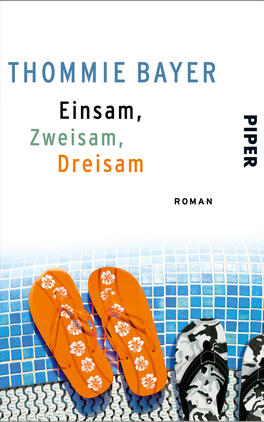
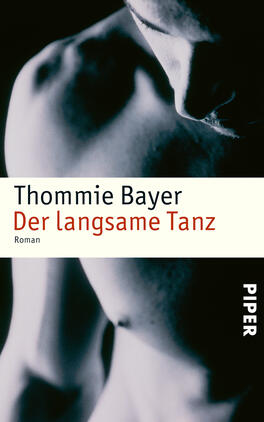



Bewertungen
Lesen Sie dieses Buch, und Sie gehen verändert an den Grabstein Ihrer Mutter.