
Auf eine Zigarette am Mont Blanc - eBook-Ausgabe
Wie ich den höchsten Gipfel der Alpen bestieg, obwohl ich dort nichts zu suchen hatte
„Wahnsinnig komisch!“ - Frau im Spiegel
Auf eine Zigarette am Mont Blanc — Inhalt
Ein unsportlicher Lektor, eine Krise und ein ziemlich hoher Berg
Ludovic Escande ist eingefleischter Großstadtmensch und eher in Cafés und Literatursalons als im Hochgebirge zu Hause. Als Lektor hat er höchstens vom Schreibtisch aus mit steilen Felswänden zu tun. Dies ändert sich, als er eine persönliche Krise durchlebt. Während einer langen feuchtfröhlichen Nacht gesteht er seinem Freund und Autor Sylvain Tesson, dass er ihn um seine Freiheit beneidet. Kurzerhand schlägt dieser vor, gemeinsam den Montblanc zu besteigen - und Escande sagt zu, obwohl er untrainiert ist, an Höhenangst leidet und leidenschaftlicher Raucher ist. Aus der Schnapsidee wird ein Berg-Abenteuer der anderen Art. Und eines der wohl unkonventionellsten und humorvollsten Bücher, die je über das Bergsteigen geschrieben worden sind.
Leseprobe zu „Auf eine Zigarette am Mont Blanc“
Flamme. Ich mag dieses Wort. Ich stelle mir ein Feuer vor und einen Mann, der in den Flammen auftaucht, sein Körper als Fackel wie bei dem Superhelden aus „Die Fantastischen Vier“. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, schaue ich mir im Wohnzimmer allein auf YouTube Videos von röhrenden Motorrädern an, deren Hinterreifen auf dem Asphalt Feuer fangen. Ihre ungestüme Kraft fasziniert mich. Tagsüber, im Büro, schwebe ich über allem, habe ich alles im Griff. Was ich für Stärke halte, ist jedoch nur Leichtsinn. Meine Gleichgültigkeit gegenüber den Dingen ist [...]
Flamme. Ich mag dieses Wort. Ich stelle mir ein Feuer vor und einen Mann, der in den Flammen auftaucht, sein Körper als Fackel wie bei dem Superhelden aus „Die Fantastischen Vier“. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, schaue ich mir im Wohnzimmer allein auf YouTube Videos von röhrenden Motorrädern an, deren Hinterreifen auf dem Asphalt Feuer fangen. Ihre ungestüme Kraft fasziniert mich. Tagsüber, im Büro, schwebe ich über allem, habe ich alles im Griff. Was ich für Stärke halte, ist jedoch nur Leichtsinn. Meine Gleichgültigkeit gegenüber den Dingen ist das Opium meiner Tage. Ich merke nicht, dass meine Ehe in Flammen aufgeht.
Als es in dieser merkwürdigen Zeit besonders turbulent zugeht, esse ich mit Sylvain Tesson zu Abend. Ich habe gern Schriftsteller um mich. Ein Universitätsprofessor hat mir einmal erklärt, dass Jazzmusiker anders seien als andere Menschen. Dieser Satz ist mir lange nachgegangen. Ich glaube tatsächlich, dass Künstler, Schriftsteller nicht so sind wie wir, die Norm hat weniger Macht über sie. An ihrer Seite kann man getrost verrücktspielen, man riskiert keine Rote Karte.
Wir haben Ende Oktober, die Tage sind kurz und grau, die Dunkelheit bricht schnell herein. Sylvain hat eine kleine Kneipe beim Jardin du Luxembourg ausgesucht. Wir wollen über seine Buchprojekte sprechen. Seltsamerweise ist mein Beruf als Lektor der einzige Aufgabenbereich, in dem ich noch einen freien Kopf habe. Sonst lasse ich nichts an mich heran. Die Aufmachung des Restaurants ist folkloristisch, man könnte glauben, man sitze im Gasthaus aus dem Film „Die große Sause“.
„Hier fühlt man sich wohl“, sagt Sylvain mit einem Lächeln zu mir.
„Die Küche macht mir ein wenig Sorgen.“
„Abgesehen von der Erdbeertorte aus der Tiefkühltruhe ist das Essen, glaube ich, nicht schlecht.“
„Warum hast du gerade dieses Restaurant ausgewählt?“
„Weil es zwanghafte Stadtmenschen wie uns auf andere Gedanken bringt.“
Eine üppige Dame in Tiroler Tracht kommt an den Tisch, einen Notizblock in der Hand.
„Was darf ich Ihnen bringen, meine Herren?“
Aus Vorsicht bestellen wir das Tagesgericht …
„Etwas Wein dazu?“, fragt sie.
„Was möchtest du lieber, Ludovic, alter Knabe, weiß oder rot?“
„Für mich lieber Weißwein.“
„Weißwein trinken, Farbe bekennen. Ausgezeichnete Wahl. Eine Karaffe, bitte.“
„Lieber eine Flasche.“
Sylvain wirft mir einen halb überraschten, halb neugierigen Blick zu.
„Ja, natürlich, entschuldigen Sie bitte, Madame, ich meinte natürlich eine Flasche! Ganz nach der Devise: Das Essen begießen, den Abend genießen!“
Mit dem Chablis und dem gut gelaunten Sylvain wird mir leichter ums Herz, aber noch immer spüre ich den dumpfen Widerhall, den die ungewisse Situation in mir erzeugt. Ich zögere, ihm von dem Chaos in meinem Leben zu erzählen. Es ist eine heikle Sache, private Dinge anzusprechen, wenn die Beziehung auf beruflichem Austausch gründet.
„Seit ein paar Monaten läuft es nicht besonders gut zu Hause. Ich glaube, wir werden uns scheiden lassen.“
„So ein Mist …“, sagt er traurig. „Man merkt, dass es dir schon mal besser gegangen ist. Bleib stark.“
„Wir haben nicht gemerkt, wie sehr wir uns auseinandergelebt haben. Vor allem ich nicht, denn das Problem liegt offensichtlich mehr auf meiner Seite.“
Ich nehme einen großen Schluck Chablis.
„Fährst du heute Abend mit dem Motorrad nach Hause?“, fragt mich Sylvain.
„Wenn du in der Banlieue wohnst, hast du keine andere Wahl, es ist praktischer als mit der Bahn.“
„Es ist heute einfacher, im Eurostar nach London zu kommen als mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Cergy-Pontoise. Wie lange brauchst du?“
Ich denke an die flammenden Superhelden, die durch die Lüfte rasen, ohne sich um irgendetwas zu scheren, und die Nacht hell erleuchten, wenn alles in Dunkelheit versinkt.
„Keine Ahnung, ich fahre sehr schnell, da kann ich mir die Frage sparen.“
„Oje, ich weiß, Geschwindigkeit ist eine starke Droge.“
„Ich wäre gern wie du, nicht in meinem Leben gefangen und frei wegzugehen, wann ich will.“
„Und wo würdest du hingehen?“
„Hoch hinauf, ganz weit nach oben, um andere Luft zu atmen. Ich wünschte, ich wäre in der Lage, Gipfel zu besteigen. Aber das ist unmöglich, ich stecke hier unten fest.“
„Warum unmöglich?“
„Weil ich kein Bergsteiger bin und einen Mordsbammel vor dem Abgrund habe. Ich bin nicht so stark wie du in diesen Dingen.“
„Das ist keine Frage von Stärke.“ Er schweigt kurz, dann fährt er fort: „Ludovic, mein Guter, ich werde dich auf den Gipfel des Mont Blanc mitnehmen!“
Er greift nach seinem Glas, um einen Toast auszusprechen.
„Du machst Witze!“
„Keineswegs. Ich meine es ernst. Es wird viel Tamtam um den Mont Blanc gemacht, aber ein wenig Training und gutes Schuhwerk genügen, um hinaufzukommen. Ich leihe dir die Ausrüstung. Welche Schuhgröße hast du?“
„Ähm … Größe 41.“
„Ich habe Größe 43, wenigstens musst du deine Füße nicht in zu enge Schuhe zwängen. Und wie Goethe schon sagte, es kommt darauf an, sich wohl zu fühlen.“
„Das hat Goethe gesagt?“
„Absolut. Ich bin sicher, der alte Goethe hat mindestens einmal in seinem Leben diesen Kultspruch rausgehauen.“
„Sylvain, ich kann nicht klettern. Ich habe Höhenangst.“
„Vertrau mir. Ich kenne sehr wirksame Mittel, um gegen Schwindelgefühle anzukämpfen. Und ich kann dir zwei oder drei Ratschläge von Männern geben, die den Mount Everest bezwungen haben. Der erste lautet, das Seil des Vordermanns gut festhalten. Der zweite, nicht nach unten schauen.“
„Ach … Und der dritte?“
„Augen schließen, wenn man Angst hat.“
Die Flasche ist fast leer. Der Augenblick ist da, in dem der Alkohol alles möglich macht, die Hindernisse sind beiseitegeräumt, und die Zeit ist aufgehoben. Der Abend hätte sich noch endlos ausdehnen und, befeuert vom Kraftstoff des Rausches, in diesem Tempo weitergehen können. Sylvain streckt mir über dem Tisch die Hand entgegen, und wir besiegeln unseren Pakt. Sein starker Bergsteiger-Händedruck quetscht meine Finger zusammen. Er wirft einen Blick auf die protzige sowjetische Armbanduhr, die er aus Moskau mitgebracht hat.
„Wir haben Donnerstag, den 11. Oktober, es ist 23 Uhr. Bis zum nächsten Sommer bist du so weit, mit mir den Mont Blanc zu besteigen. Hier dein Trainingsplan: In Sachen Alkohol und Zigaretten belässt du es, wie es ist. Es wurde nichts Besseres erfunden als Wein und Tabak, um die Arterien gesund zu halten. Du baust lediglich zwei oder drei Joggingrunden von einer Stunde in dein Wochenprogramm ein. Und zur Ergänzung machst du jeden Morgen Liegestütze und Klimmzüge.“
„Einverstanden. Aber bist du sicher, dass das ausreicht? Ich muss doch einiges aufholen.“
„Ja. Ich für meinen Teil werde meinen Kumpel Du Lac rekrutieren, der Bergführer ist. Er wird dein Scherpa sein. Ideal wäre es, wenn wir eine Woche vor dem Aufstieg ankämen, damit du dich in der Höhe akklimatisierst und an den Fels gewöhnst. Ich muss mal mit dem Kameraden Rufin sprechen, ob er uns in seinem Chalet in Saint-Gervais beherbergen kann.“
______
Ein Schriftsteller hat einmal in einer Fernsehsendung erzählt, dass er während seiner Scheidung nur noch ein halber Kerl gewesen sei. Ich merke, dass ich nur noch ein Drittel meiner selbst bin. Dieses Drittel macht seine Arbeit und zieht um in eine Zweizimmerwohnung, die ich in der Nachbarstadt von Enghien-les-Bains gemietet habe, wo wir ein kleines Haus besitzen. Trotz des trostlosen Eindrucks, den die kleine Gemeinde im Val-d’Oise macht, bringt meine neue Adresse meist jeden zum Lachen, dem ich sie mitteile. Denn ich wohne hier in der „Rue de l’Avenir“ in „Deuil-la-Barre“, also in der „Zukunftsstraße“ in „Trauerpfosten“. Wenn ich studierter Psychoanalytiker wäre, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Ort für den Absturz gewählt, denn ich muss zugeben, dass ich mich in dem Augenblick, als ich dort einziehe, im freien Fall befinde.
Ich habe kein Möbelstück mitgenommen, alles ist neu in diesem Appartement in einem Wohnblock zwei Schritte entfernt vom Bahnhof für die Vorortzüge im Pariser Speckgürtel. Das Mobiliar habe ich an einem einzigen Nachmittag bei Ikea gekauft – ich ließ mich vom Musterappartement im Möbelhaus inspirieren. Ich kann bestätigen, dass Ikea mein Lieferant für alles geworden ist. Von der Gabel bis zum Sofa tragen alle Gegenstände Vornamen, die aus „Der Herr der Ringe“ stammen könnten. Doch das stört mich nicht, denn ich vermeide es, längere Zeit zu Hause zu sein. Die Stille in meinem neuen Heim stürzt mich in einen Zustand tiefer Traurigkeit. Ich verbringe viel Zeit im Büro oder auf dem Motorrad, da ich täglich zweieinhalb Stunden nach Paris und zurück pendle. In meiner verbleibenden Freizeit widme ich mich dem Laufen und der Gymnastik. Ich jogge am Wochenende, und um nicht fünf Tage am Stück ohne Sport zu sein, halte ich mir den Mittwochabend frei. Mitten im Winter ist es um siebzehn Uhr bereits stockdunkel, sodass ich eine Stirnlampe trage, wenn ich in den Wald von Montmorency aufbreche – es ist der einzige Ort, an dem ich das Joggen nicht entmutigend finde. Eine peinliche Begegnung mit einem Paar, das sich, an einen Baumstumpf gelehnt, vergnügt, überzeugt mich allerdings davon, dass ich die Laufzeit ändern muss.
Das Training, das Sylvain mir vorgeschlagen hat, erfordert es, meinen Alkohol- und Tabakkonsum zumindest in den ersten Wochen einzuschränken, um das Tempo des Trainingsplans einzuhalten, denn die Änderung des Lebensrhythmus strengt meinen Organismus an. Wegen der Trennung finde ich schlecht in den Schlaf. Selbst wenn ich vom Sport erschöpft bin, wache ich jede Nacht zwischen drei und vier Uhr morgens auf und mache bis zum Morgengrauen kein Auge mehr zu. Ich überlege mir verschiedene Entspannungsmethoden, versuche es zuerst damit, einen Film anzuschauen, doch keine Geschichte kann mich wirklich fesseln. In meinem Kopf läuft ein anderer Trailer, in dem ich eine schlechte Rolle spiele und der Übeltäter bin, der die familiäre Katastrophe verursacht hat. Ich denke an meine Kinder, an ihre offenkundige Trauer und an die Unruhe, die diese endlose Trennungsphase stiftet. Ich versuche auch, mich auf andere Gedanken zu bringen, indem ich im Internet surfe. Ich besuche verschiedene Länder, doch die Erde vom All aus gesehen verstärkt letztlich nur meine Schwermut, so unmenschlich sind die grünen und flach gedrückten Bilder unserer Kontinente. In meinem Kummer zieht mich das Netz wie ein ungesunder Strudel in sich hinein. Je mehr Seiten ich besuche, desto mehr fesseln mich morbide Videos von Flugzeugabstürzen und Luftbombardements. In einer besonders beklemmenden Nacht stoße ich auf grauenhafte Bilder von Tierschlachtungen, die mich in einen so eigentümlichen Angstzustand versetzen, dass ich gezwungen bin, einen Freund per Telefon zu wecken, um wieder mit der Welt der Lebenden in Verbindung zu treten.
Die Wochen gehen vorbei, ich komme durch den Winter, indem ich an meinem Sportprogramm festhalte. Ich habe gelernt, dass ich bei kaltem Wetter eine Mütze, Handschuhe und einen Halswärmer aus Fleece tragen sollte, um mich nicht zu erkälten. Morgens um sieben Uhr, wenn ich von Deuil-la-Barre in den Wald von Montmorency starte, laufe ich lange Autoschlangen entlang, die zur Arbeit nach Paris fahren. Ich trabe in die entgegengesetzte Richtung der Staus und fühle mich so schuldig, als schwänzte ich den Gymnasialunterricht. Lange habe ich mich auf zwanzig Minuten Laufen beschränkt, denn meine Lunge brennt und mein Herz gerät außer Takt. Zudem beschäftigen mich die Schmerzen beim Abwinkeln meiner Knie. Eines Morgens beschließe ich, einen Fachmann zu konsultieren, den ich mit einer App der Gelben Seiten auf meinem Handy suche. Ich finde eine Ärztin ganz in der Nähe meines Appartements. Der unvorhergesehene Ausflug hebt meine Stimmung, zumal es bald Frühling ist. Die Frau mir gegenüber ist ungefähr fünfzig, sie hat eine raue Stimme und einen schönen braunen Blick, mit dem sie mich misstrauisch mustert. Hinter ihr, an die Wand gepinnt, ein Poster von Pink Floyd.
„Nun, Herr Escande, wo tut’s denn weh?“
„Ich habe Schmerzen in den Knien. Ich trainiere, um diesen Sommer auf den Mont Blanc zu steigen, seit einiger Zeit laufe ich viel.“
„Haben Sie zuvor Sport gemacht?“
„Nicht richtig.“
„Was machen Sie dagegen, nehmen Sie Medikamente?“
„Ich nehme Doliprane gegen die Schmerzen.“
„Sonst nichts?“
Ich gerate in eine Verwirrung, die unerklärlich ist angesichts dieser einfachen Frage. Ich spüre Angst in mir aufsteigen, als hätte man mich beim Schwindeln ertappt, und ich beginne zu stammeln.
„Ich nehme täglich Doliprane. Aber ich nehme auch … Aspirin … Advil und Voltaren … damit es besser wirkt. Wissen Sie, manchmal schmerzt es wirklich sehr …“
„Schlafen Sie gut?“
„Nein, nicht besonders. Ich kann schlafen, wenn ich Fervex nehme.“
„Sind Sie auch erkältet?“
„Nein … es ist nur so, dass ich festgestellt habe, dass Fervex mich einschlafen lässt …“
„Prima. Rauchen Sie?“
„Ja, etwa sechzehn Zigaretten am Tag …“
„Also eine Packung. Und Alkohol?“
„Wein. Wie jeder.“
„Sicher. Wie viele Gläser ungefähr?“
„Nicht mehr als fünf … Das ist ganz normal, denke ich.“
Ich sehe, wie sie sich Notizen macht, als würde sie bereits die Sprechstunde des künftigen Patienten vorbereiten.
„Ich hoffe, ich habe mir keine Bänder oder den Meniskus gerissen“, sage ich albern, „das wäre mit Blick auf den Sommer sehr ärgerlich. Schlimmstenfalls, nehme ich an, könnte man mir Injektionen geben. Ein Alpinist, mit dem ich befreundet bin, hat mir gesagt, das hätte ihm gut geholfen, und Sie verstehen sicher …“
„Nein, Herr Escande, ich verstehe nicht“, sagt sie plötzlich und hebt den Arm, um mich zu unterbrechen. Sie legt ihren Stift weg und lehnt sich auf ihrem Stuhl zurück.
„Muss ich mich röntgen lassen?“
„Hören Sie, wir setzen Sie jetzt auf null. Zuerst nehmen Sie eine große Plastiktüte und sammeln all die Medikamente ein, die Sie besitzen. Dann bringen Sie den ganzen Kram mit Grüßen von mir in die Apotheke an der Ecke. Anschließend werde ich Ihnen ein Schlafmittel verschreiben, Stilnox, das Sie abends direkt vor dem Zubettgehen einnehmen.“
„Einverstanden, und meine Beine?“
„Sie müssen etwas sehr Wichtiges verstehen. Aus medizinischer Sicht bereitet man seinen Organismus auf diese Weise ganz und gar nicht auf einen Aufenthalt im Hochgebirge vor. Also Schluss mit dem Rauchen, Schluss mit dem Trinken. Was Ihre Beine angeht, werden wir sehen, aber ich denke, es handelt sich um Muskelkater. Wenn Sie Ihr Training besser ausrichten, wird das genügen.“
Der Vorteil des Verlagshauses, bei dem ich arbeite, sind die zahllosen Treppen, denn die Anzahl der Büros nahm in dem Maße zu, wie der Verlag wuchs, und so ist das Innenleben des Gebäudes heute auf komplizierte Weise verschachtelt. Mein Büro liegt im dritten Stock, es bietet eine friedvolle Aussicht auf den Garten, wo jede Jahreszeit sich mit ihren Farben an den Bäumen und Blumen austobt. Ich nehme den längsten Weg, um einen Brief im Erdgeschoss abzugeben. Ich steige die Stockwerke hinauf und hinunter, durchquere die verschiedenen Abteilungen, um nach zwanzig Minuten in der Presseabteilung anzukommen. Zufällig begegne ich Jean-Christophe Rufin. Ich weiß immer, wenn er im Haus ist, weil er mit dem Klapprad kommt, seinem Fortbewegungsmittel in Paris. Er parkt es unter dem Minitel-Gerät, das wir aus irgendeinem rätselhaften Grund aufbewahren wie eine Reliquie aus dem 20. Jahrhundert. Ich gehe ins Büro seiner Pressereferentin. Er steht da, lehnt am Fenstersims, das zum Garten hinausgeht. Im Gegenlicht zeichnet sich seine hohe Gestalt scharf ab. Er trägt einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd.
„Ich weiß noch nicht, ob ich mit euch mitkommen kann“, sagt er. „Ich habe zugesagt, im Juni zum Salon du Livre nach Nizza zu fahren, um Bücher zu signieren. Und außerdem fühle ich mich zu alt, ich werde euch nicht folgen können. Betagte Herren wie ich machen Thalassotherapie und Strandspaziergänge im Dufflecoat.“
„Hör auf, du bist besser trainiert als ich. Als würdest du gerade von den Olympischen Spielen zurückkommen. Wir haben das Datum jedenfalls noch nicht festgelegt. Wir besteigen den Mont Blanc zusammen, wie wir es von Anfang an geplant haben.“
„Von wegen! Von all diesen Abendessen in Paris bin ich fett geworden wie ein Schwein. Habt ihr schon entschieden, welche Route ihr nach oben nehmen wollt?“
„Sylvain und Daniel wollen einen Weg auf der italienischen Seite gehen. Die Route ist anscheinend herrlich. Kennst du sie?“
„Ja, sie ist vor allem herrlich bescheuert … es sei denn, ihr wollt euch alle zusammen umbringen. Ich erklär’s dir: Die Arête des Italiens, wie wir die Route nennen, sehe ich von der Terrasse meines Chalets in Saint-Nicolas aus. Das ist ein langer, verschneiter Grat, so breit wie ein Fahrradsattel mit 800 Metern Luft zu beiden Seiten.“
„Mist … die haben keine Ahnung, ich werde krepieren.“
„Aber nein, du riskierst lediglich einen epileptischen Anfall oder einen Herzinfarkt. Schade, denn der Grat ist nicht breit genug, um sich für eine Herzmassage draufzulegen.“
„Hör auf mit dem Quatsch …“
„Eigentlich gibt es nur eine Art, sich auf dem Grat zu sichern: Wenn einer abstürzt, muss man auf die andere Seite springen, um ein Gegengewicht herzustellen. Das ist eine ziemlich grundlegende Technik. Dann kannst du zu Petrus beten, dass die Bergwacht schnell kommt, denn wenn du erst hängst wie ein Würstchen, bleibt dir nichts anderes übrig, als dich zu gedulden.“
„Meine Güte, ich muss Sylvain sagen, dass das nicht meinem Können entspricht. Kannst du nicht auch mit ihm sprechen, auf dich hört er?“
„Das Problem ist, dass er nur jedes dritte Mal auf mich hört, sonst würde er nicht so viele Dummheiten machen. Dieser Irrsinn mit der Arête des Italiens, das ist wieder mal typisch für ihn und Daniel. Wenn sie zusammen sind, kann nichts sie aufhalten, die beiden sind echte Kamikaze. Aber gut, ich spreche mit Sylvain, ich sehe ihn diese Woche, er kommt zum Essen zu mir.“
______
Donnerstag, 27. Juni. Es ist der Abend vor unserer Abreise nach Chamonix. Jean-Christophe zögert noch immer, den Aufstieg mit uns zu machen. Er behauptet, er sei müde vom Erscheinen seines letzten Buchs und der Promotion dafür. Doch ich habe den Verdacht, dass er das Können seiner Kumpels überschätzt, und besonders meines. Ich bin nicht in bester körperlicher Verfassung, obwohl ich mich minutiös an Sylvains Sportprogramm gehalten habe und ein bisschen weniger an das der Ärztin. Ich rauche ein Päckchen Zigaretten am Tag, ich schlafe mithilfe von Arzneimitteln, ich dämpfe meine Ängste mit Beruhigungsmitteln, und ich trinke mehr, als vernünftig ist. Mein Körper ist ein medizinisches Experimentierfeld, mein Blut ein unzuverlässiger, mit Chemie und Alkohol vollgepumpter Fluss.
Der Plan ist, morgen mit Sylvain in meinem Renault Clio loszufahren. Ich soll ihn in seiner Wohnung bei der Kirche Saint-Séverin im Zentrum des Quartier Latin abholen. Da ich keine Bergsteigerklamotten besitze, will er seinen Fundus plündern, um mich auszustatten. Dann fahren wir in einem Rutsch zum Chalet von Jean-Christophe an den Hängen von Saint-Gervais.
Bei einem Cocktail in den Räumen von Gallimard unterhalte ich mich mit Patrick Modiano. Ich weihe ihn in mein Projekt der Mont-Blanc-Besteigung ein. Plötzlich wird er lebhaft, stellt mir genaue Fragen zu Planung, Ausrüstung und Umsetzung. Am Ende unseres Gesprächs bittet er mich mit einer Begeisterung, die mich rührt, ihm eine Postkarte aus Chamonix zu schicken. Daraufhin wendet er sich zum Garten hin, streckt den Arm aus in Richtung des Pavillons der Pléiade am anderen Ende und deutet mit dem Finger aufs Dach: „Dort oben wollen Sie also hin?“ Ich erwidere, wir hätten vor, bis zum Gipfel aufzusteigen, wenn das Wetter es erlauben würde. Er drückt mir herzlich die Hand und wiederholt: „Denken Sie daran, mir eine Postkarte von dort oben zu schicken?“
Freitag, 28. Juni, neun Uhr früh. Vom Stadtrand kommend fahre ich zwischen Wolkenkratzern, in denen die größten französischen Unternehmen ihren Firmensitz haben, auf dem Ring um das Stadtviertel La Défense. Mein Handy klingelt, es ist Sylvain. Ich höre eine schwache und atemlose Stimme. Er erklärt mir, über Nacht habe sich sein Gaumenzäpfchen stark entzündet, es sei dick wie ein Tischtennisball, der in seiner Kehle stecke. Er kann schwer atmen, muss in die Notaufnahme des Cochin-Hospitals. Ich bräuchte nur bei ihm zu warten, bis der Arzt ihn untersucht habe.
In seiner Wohnung finde ich den Fußboden übersät mit Spezialkleidung, Seilen, Karabinern und Kletterschuhen vor. Unter den merkwürdigen Objekten, die er von seinen Reisen mitgebracht hat, entdecke ich einen napoleonischen Dreispitz. Gegen elf Uhr, als er den Schlüssel im Schloss umdreht, sitze ich gerade mit dem Dreispitz auf dem Kopf und einer Pistole in der Hand an seinem Schreibtisch. Trotz seiner Müdigkeit lacht er über meine Verkleidung.
„Jetzt trinken wir erst mal einen richtig heißen Tee, Kamerad, das bringt mich auf andere Gedanken! Der Arzt hat mir Kortison verschrieben, mein Zäpfchen müsste im Laufe des Tages abschwellen.“
„Aber was ist dir denn schon wieder passiert?“
„Och, nichts Besonderes! Ich war gestern Abend mit dem Motorrad unterwegs, mit nacktem Oberkörper, und das hat mir mein Organismus nicht richtig verziehen. Gefällt dir der Film ›Easy Rider‹?“
„Ja, aber er ist etwas in die Jahre gekommen, finde ich. Wird es gehen mit deinem Hals?“
„Keine Sorge, morgen früh können wir starten. Das reicht noch gut und gibt uns Zeit, dir im Vieux Campeur Schneegamaschen zu kaufen.“
Das Kortison hat gewirkt. Sylvain ist wieder bester Stimmung, wir spazieren durch die belebten Straßen des Quartier Latin.
Am Abend feiern wir seine Genesung und unsere Abfahrt. Marianne, Sylvains Lebensgefährtin, stößt um achtzehn Uhr zu uns. Eine junge, schlanke Frau, in deren großen schwarzen Augen ich eine fiebrige Unruhe bemerke. Sie legt ein Buch auf den niedrigen Wohnzimmertisch, das Tagebuch von Mireille Havet, die in den Zwanzigerjahren in literarischen Kreisen verkehrte – eine unabhängige, faszinierende Persönlichkeit mit unglücklich plumpen Gesichtszügen. Versunken in einer gewaltigen Liebessehnsucht ohne Objekt, blutete ihr das Herz unaufhörlich. Sie bahnte sich einen Weg zwischen Worten und Kokain, zwischen Vormittagen, die wie Dämmerungen waren, und aufregenden Abendstunden, in denen sie mit ihren Künstlerfreunden hitzig diskutierte. Marianne erzählt voller Leidenschaft davon, ich überfliege einige Seiten und bin überrascht von der Verzweiflung in Havets Texten, in denen sie ihrem zerstörerischen Taumel Worte gab. Mireille Havet starb mit 33 Jahren an Erschöpfung.
Als meine Freundin kommt, ein hübsches, neckisches Mädchen, das ich einige Tage zuvor kennengelernt habe, entkorkt Sylvain eine Flasche Champagner. Nachdem wir uns rasch beschnuppert haben, werfen wir Musik an und tanzen. In Hochstimmung durch dieses improvisierte Fest bekommen wir Lust, uns zu kostümieren. Marianne verkleidet sich als Schiffskapitän, meine Freundin als Jockey, Sylvain als Polospieler, und ich setze wieder Napoleons Hut auf. Der Geräuschpegel steigt, wir gestikulieren lachend in unseren bizarren Aufmachungen auf der Terrasse.
Tanzen macht Appetit. Als die Glocken von Saint-Séverin zehn Uhr läuten, haben wir gerade eine zweite Flasche Champagner geleert. Sylvain schlägt vor, in einer Bar um die Ecke Tapas zu essen. Bevor wir die Wohnung verlassen, überzeugt er mich davon, uns umzuziehen, damit wir gekleidet sind wie Hinz und Kunz. Er leiht mir ein weißes Hemd, eine Clubkrawatte und eine Smokingjacke, die modrig und nach Patschuli riecht. Mit meiner Drillichhose und den orangefarbenen Basketballschuhen sehe ich noch grotesker aus als mit dem Napoleonhut. Wir schwanken zu einer Bar, wo die Bedienung, nachdem sie Sylvain erkannt hat, auf Anhieb Mojitos und einen Teller Tortillas auf den Tresen stellt. Bei mir ist der alte Kitzel der Trunkenheit wieder da mit den Erinnerungen, die damit verknüpft sind. Ich habe die letzten Juninächte vor Augen, in denen ich nach dem Abendessen aus einer Laune heraus mit dem Motorrad losfuhr über die A11 zum Landhaus meiner Eltern im Perche, 140 Kilometer von Paris entfernt.
Während wir uns zum Essen an den Tresen setzen, ziehen die atemberaubenden Bilder von der Autobahn im Scheinwerferlicht meiner Maschine wieder an mir vorüber. Ich sehe mich, wie ich mit Höchstgeschwindigkeit über die Straße jage und, hypnotisiert vom Tempo und dem Funkeln der reflektierenden Straßenmarkierungen, den Oberkörper auf den Tank gepresst, Lastwagen überhole.
Die Bar leert sich, in unserer kleinen Gesellschaft steigt das Fieber. Ganz hinten im Raum, an der Wand, steht ein altes Klavier. Sylvain wirft eine Art Polka hin. Meine Freundin ist nach draußen gegangen, um eine Zigarette zu rauchen, wo sie, als ich ihr nachkomme, drei jungen Typen im Anzug lauscht, die auf Playboy machen. Ich nähere mich lächelnd und frage, ob alles in Ordnung sei. Sie packt mich am Arm und zieht mich ein Stück weiter.
Um zwei Uhr früh verlassen wir die Bar und gehen entlang des Jardin du Luxembourg durch die ruhigen Straßen zu Fuß zurück. In fünf Tagen nimmt unsere Seilschaft den Mont Blanc in Angriff, aber ich bin schon hier vollkommen berauscht.
Samstag, 29. Juni. Endlich fahren wir mit dem Auto nach Saint-Gervais. Wir laden vier riesige Rucksäcke und zwei fünfzig Meter lange Seile in den Clio. Gaffer beobachten neugierig das malerische Durcheinander von Pickeln und Karabinern, die auf dem Gehweg klingeln wie Glöckchen.
Während der Fahrt auf der Autobahn sprechen wir über die Autoren und Bücher, die bei unserer Entdeckung der Literatur eine wichtige Rolle gespielt haben. Sylvains Vorlieben überraschen mich durch ihre Vielfalt und ihren bisweilen unvereinbaren Charakter. Er erzählt von Homer, von dem er die „Odyssee“ gelesen hat, von Gaston Rébuffat und seinen Bergsteigergeschichten und von Jean Lorrain, einem Schriftsteller des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der durch seine Lebensführung Aufsehen erregte und dessen Werk nahezu vergessen ist. Als wir die A6 verlassen und auf die A40 Richtung Genf abbiegen, fangen wir schließlich an, über die Frauen zu sprechen, die wir geliebt haben, aber auch über Unbekannte wie diese Miss Nantua oder jene Miss Oyonnax, an deren Städten wir vorbeibrausen, als wir über die gigantischen Hängebrücken der weißen A40 fahren. Wir versuchen uns das Liebesleben dieser jungen Frauen in der postindustriellen, zwischen Bergen eingeklemmten Gegend vorzustellen.
Um sechs Uhr abends kommen wir in Saint-Gervais an. Jean-Christophes Chalet liegt hoch über einem kleinen Dorf in 1500 Metern Höhe. Ein Panoramablick tut sich auf: Man sieht aneinandergereiht den Grat der Aiguille de Bionnassay, den Dôme du Goûter und den Mont Blanc. Da Jean-Christophe noch nicht da ist, werfe ich gemäß den Anweisungen, die er auf einen Zettel gekritzelt hat, den Heizkessel an. Offenbar ist es nicht so einfach wie auf der Zeichnung, es funktioniert nicht. Ich suche Hilfe bei Google, bekomme aber nur deutsche Ergebnisse. Nachdem ich mich lange genug abgemüht habe, werde ich schließlich mit dem tiefen Fauchen einer Flamme im gusseisernen Ofen belohnt.
Jetzt kommt auch Daniel, der Bergführer, an. Er stellt zwei mit Seilen, Gurten und Expresssets behangene Rucksäcke in den Flur. Der Kühlschrank ist leer, wir fahren ins Dorf hinunter auf der Suche nach einer Gaststätte. In der ersten weist man uns ab, weil die Bewirtung um 21.30 Uhr endet, wir haben schon 21.35 Uhr … Die zweite ist eine Pizzeria, die wie ein holländisches Käsegeschäft dekoriert ist, mit einer Wirtin, die in Endlosschleife eine Sammlung von George-Michael-Songs abspielt. Auf den Regalen sind dutzendweise Plüschbären aufgereiht. Außer einem Typen an der Theke sind wir die einzigen Gäste. Die Wirtin dieser ausgestorbenen Gaststätte ist ungefähr sechzig, hat blondes Haar, ernste Gesichtszüge, aber ein freundliches Lächeln, das einen die Trostlosigkeit einer Frau erahnen lässt, die zu oft verlassen wurde. Am Tresen lehnt Gérard. Wenn die Wirtin zu uns an den Tisch kommt, spricht Gérard für sich allein weiter. Er hat weder alle seine Zähne noch seinen Verstand beisammen. Sein vom Schnaps betäubter Mund brabbelt in einer Art Savoyer Kauderwelsch, das wir erst entschlüsseln können, nachdem wir selbst einige lokale Schnäpse probiert haben.
Schlag Mitternacht sind wir wieder auf dem Parkplatz. Mich überkommt ein eisiges Gefühl, morgen wird es ernst. Wir werden die Pointe Percée hochklettern, einen Gipfel der Aravis-Kette. Ich weiß nichts über diese Berge, habe ihre Namen erst jetzt auf den Autobahnschildern gelesen. Daniel und Sylvain versprechen mir, es würde eine einfache Tour werden, eine schöne Feuertaufe für einen Novizen, der seine ersten Erfahrungen am Berg machen will. Morgen soll ich eine nahezu perfekte Einführung erhalten. Mich beschleicht die Befürchtung, die Angst könnte die Oberhand gewinnen und mich am Fels lähmen.
Der Abend ist noch nicht zu Ende, meine Freunde wollen das Gespräch fortsetzen. Die letzten Cocktails helfen mir dabei, in einen traumlosen Schlaf zu gleiten und Ruhe zu finden.
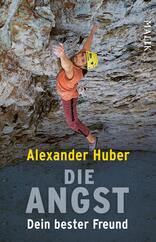

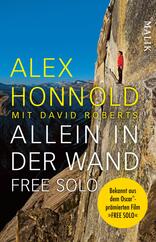




DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.