
Sommerfalle
Thriller
„In diesem Thriller bleibt die Spannung trotz Zeitsprüngen konstant erhalten.“ - Ruhr Nachrichten
Sommerfalle — Inhalt
Tu das nicht, mach dies nicht, sitz still, komm her – Regeln über Regeln bestimmen den Alltag von Eddie. Er wächst mit seiner Mutter auf, zerrissen zwischen Sehnsucht und Hass. In der Schule beachtet ihn niemand. Darum bemerkt auch niemand sein besonderes Interesse an Rebecca. Um sie ganz für sich zu haben, entführt er sie und versteckt sie in einer Waldhütte, um mit ihr nach seinen Regeln zu spielen. Damit beginnt für Rebecca ein wahrer Albtraum. Sie kann sich befreien und fliehen. Doch dann begeht sie einen Fehler und wird wieder gefangen. Je öfter Rebecca glaubt, ihrem Peiniger entkommen zu sein, desto tiefer gerät sie in seine Fallen. Und selbst als sie bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert wird, scheinbar gerettet, wartet er schon an ihrem Bett, um da zu sein, wenn sie aufwacht …
Leseprobe zu „Sommerfalle“
1. KAPITEL
Mmm. Schlafen. Sie atmete tief durch die Nase ein und seufzte dann so laut, dass sie fast vollständig erwachte aus diesem seltsamen Traum. Ein Albtraum, nicht wirklich furchterregend, aber verstörend. Eigenartig, so wie Träume eben manchmal sind. Sie rollte sich auf die rechte Seite und war mit einem Ruck ganz wach.
Im Zimmer war es stockdunkel. Ihr linkes Handgelenk schien ans Bettgestell gefesselt zu sein. Sie befühlte es mit ihrer Rechten und ertastete neben ihrem Handgelenk einen kalten Bettpfosten aus Metall.
Sie trug eine Handschelle.
Pa [...]
1. KAPITEL
Mmm. Schlafen. Sie atmete tief durch die Nase ein und seufzte dann so laut, dass sie fast vollständig erwachte aus diesem seltsamen Traum. Ein Albtraum, nicht wirklich furchterregend, aber verstörend. Eigenartig, so wie Träume eben manchmal sind. Sie rollte sich auf die rechte Seite und war mit einem Ruck ganz wach.
Im Zimmer war es stockdunkel. Ihr linkes Handgelenk schien ans Bettgestell gefesselt zu sein. Sie befühlte es mit ihrer Rechten und ertastete neben ihrem Handgelenk einen kalten Bettpfosten aus Metall.
Sie trug eine Handschelle.
Panisch riss sie an dem Bettpfosten und begann zu schreien. Die Schreie wurden zum lauten Stöhnen, während sie gegen die Fessel kämpfte. Dann hielt sie still, um zu lauschen. Doch nichts. Nur absolute Dunkelheit. Dann begann sie, in weiter Ferne leise Geräusche wahrzunehmen. Vielleicht eine Schnellstraße; Wind, der durch hohe Bäume wehte; etwas näher das Zirpen von Grillen. Aber nicht die üblichen Geräusche eines Hauses, kein brummender Kühlschrank, kein Knarzen von Holz, keine tickende Uhr.
Sie versuchte, sich zu beruhigen, und blickte an sich hinunter. Vollständig angezogen, aber barfuß. Die Armbanduhr fehlte.
Sie zog die Beine an, um sich aufzurichten und so ihren Arm aus der metallenen Fessel zu winden. Die Kette der Handschelle hielt sie mit der linken Hand und packte den Metallreif mit der rechten. Mit aller Kraft spannte sie ihre Muskeln an, hob den Kopf und streckte die Beine durch. Dabei stieß sie mit dem Kopf so fest an die unerwartet niedrige Decke, dass sie mit einem Schlag in ihren Albtraum zurückgeworfen wurde.
„Ist sie wach?“, fragte die Krankenschwester. Ein gut aussehender Jugendlicher saß neben dem Bett der Patientin, starrte immer wieder auf die Monitore und küsste sanft die Wange des Mädchens.
„Vorhin hat sie aufgestöhnt. Ihre Lider flatterten. Ich habe ihre Hand gedrückt, aber darauf hat sie nicht reagiert.“ Wieder strich er über ihr Gesicht. „Na komm schon, Becca, wach auf.“
Die Schwester überflog noch einmal das Patientenblatt. Rebecca McPherson, 18 Jahre alt. Und was für ein attraktiver Kerl an ihrer Seite. Die Schwester bewunderte seine Hingabe. Er war in den letzten rund sechsunddreißig Stunden, die sie hier lag, nicht von ihrer Seite gewichen. Ihre Verletzungen schienen nicht allzu schlimm zu sein, auch wenn ihr linkes Handgelenk verbunden war. Auf der Stirn prangte ein großer Bluterguss, doch momentan spürte die Patientin keinen Schmerz und nahm auch ihre Umgebung nicht wahr. Die Schwester studierte die Monitore und runzelte die Stirn. Inzwischen hätte Rebecca wach sein müssen. Aber sie wollte nicht, dass der Junge sich noch mehr sorgte. Also lächelte sie und zeigte ihm zur Ermutigung ihren hochgereckten Daumen. „Sie wird bald aufwachen. Sieht alles gut aus.“
Als sie zur Tür ging, blickte sie sich kurz noch einmal um. Was für ein attraktiver junger Mann, dachte sie. Egal, welches Alter, die Hübschen waren immer schon vergeben.
Rebecca war ohnmächtig gewesen, aber sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Im Raum mit der niedrigen Decke herrschte immer noch Dunkelheit. Diesmal war sie vorsichtiger. Sie tastete erst mit ihren Füßen und dem freien Arm herum, dann streckte und drehte sie sich, um eine Vorstellung von ihrer Lage zu bekommen. Rechts war der Rand des Bettes, über den sie ihre Füße hängen lassen und seitwärts ausstrecken konnte, aber sie stieß auf nichts als Leere. Am Kopfende befanden sich Stäbe wie bei einem Gitterbett, und als sie ihren rechten Arm hindurchschob, war auch dort keine Wand. Also befand sich das Bett mitten im Raum. Das war ihr unheimlich. Sie schnippte mit den Fingern, um durch das Geräusch die Größe ihres Gefängnisses abschätzen zu können. Dabei kniff sie die Augen zusammen, konzentrierte sich ganz auf ihr Gehör. Das Zimmer konnte nicht besonders groß sein. Doch was half ihr das?
Schließlich tastete sie die niedrige Decke ab. Rebecca war nur einen Meter achtundfünfzig groß und daher nicht geübt im Analysieren von Deckenstrukturen, aber die hier fühlte sich wie nackter Beton an. Eher eine Keller- als eine Zimmerdecke. Kein Wunder, dass ich mich daran gestoßen habe, dachte sie und befühlte ihre Stirn. Über der Augenbraue bildete sich bereits eine schmerzhafte Beule.
Sie setzte ihre blinde Suche fort. Unterhalb des linken Bettpfostens war eine waagrechte Stange unter der Matratze, dann nichts mehr. Sie konnte den Boden nicht erreichen. Mit beiden Händen hielt sie sich am Bettpfosten fest und ließ sich daran herab. Immer noch kein Fußboden. Sie hing da wie an einer Turnstange. Als sie anschließend einen nackten Fuß gegen den Pfosten stemmte, gelang ihr mit dem anderen eine Drehung um hundertachtzig Grad. Dabei stieß ihr großer Zeh gegen etwas Hartes, Glattes. Beton. Kein Fenster, nichts. Verzweifelt trat sie gegen die Wand, bis ihre Muskeln schmerzten und ihr gefesseltes Handgelenk erst zu schmerzen, dann zu bluten begann.
Erschöpft zog sie sich zurück auf die Matratze. Sie versuchte fieberhaft, nachzudenken. Wie war sie hierhergekommen? Das letzte Bild in ihrem Kopf war das von ihr und ihrer Freundin Sarah in der Shoppingmall. Sie hatten ein Eis-Shake getrunken, von dem ihr schlecht geworden war. Sie war den Flur zu den Toiletten hinuntergegangen, als … ja, was? Entführt.
Auch wenn sie es hatte verdrängen wollen, stand das Wort jetzt unerbittlich deutlich vor ihren Augen. Rebecca war stärker, als ihre zierliche Statur vermuten ließ, körperlich und mental. Sie war üblicherweise eine selbstbewusste junge Frau mit eisernem Willen, die immer alles unter Kontrolle haben und stets im Mittelpunkt stehen wollte.
Ihr Magen rumorte, und sie bemerkte etwas, das ihr in dieser Lage gar nicht gefiel. Sie musste auf die Toilette. Sie versuchte es zu ignorieren, weigerte sich, die kalte Angst wahrzunehmen, die ihr den Rücken hinaufkroch.
Sie drehte sich so weit herum, dass ihr Kopf über den Bettrand hinausragte, und übergab sich. Der Frust und die Angst, die Handschellen und die Dunkelheit waren einfach zu viel.
Rebecca brach in Tränen aus.
„Hey, sieh mal!“ Sarah griff nach einem Paar Ohrringe und hielt sie Rebecca hin. „Sind die nicht cool? Sonderangebot! “
„Klar, nimm sie doch“, bestätigte Rebecca ihre Freundin. Sie hatten schon den ganzen Nachmittag in der Shoppingmall verbracht, jede Menge Klamotten anprobiert und zu viel Junkfood gegessen. Sarah konnte essen und essen und nahm bei ihrem knapp einem Meter siebzig kein Gramm zu, während Rebecca schon aufpassen musste, was sie zu sich nahm. Sie hielt ihr Gewicht zwischen vierundvierzig und sechsundvierzig Kilo und wog sich täglich. Doch da die Waage heute Morgen nur knapp vierundvierzig Kilo angezeigt hatte, konnte auch sie sich etwas gönnen, fand sie. Sie hatten mit Zimtschnecken angefangen, danach gab es Salzbrezeln mit Käsesauce und jetzt zwei große Cookies mit Schokostückchen. Rebecca beschloss, sich ein paar Tage lang nicht zu wiegen. Hauptsache, die Jungs blickten ihr immer noch nach. Heute hatte sie ein paarmal bemerkt, wie sich Köpfe in ihre Richtung gedreht hatten, Blicke hatten sie bewundernd von den blonden Haaren bis zu den Zehenspitzen gemustert. Einmal meinte sie, eine männliche Stimme gehört zu haben: „Die ist heiß.“ Sie trug eine gemütliche Khakihose, die trotzdem am Po eng genug saß und ihre Figur perfekt zur Geltung brachte. Beim Gehen wippte ihr schulterlanges Haar. Sie fand, dass sie gut aussah heute.
Sarah trat mit ihrer Beute an die Kasse und winkte Rebecca, näher zu kommen. „Schau dir den mal an“, flüsterte sie und deutete hinter Rebecca.
„Ich habe bereits einen Freund. Schon vergessen?“
„So meine ich das nicht. Der hat dich so angestarrt. Aber nicht einfach so. Irgendwie … unheimlich.“
Rebecca sah sich um. „Schon weg. Wie hat er denn ausgesehen? “
„Eigentlich nicht schlecht. Nur … ein bisschen krass. Manche Mädchen hätten ihn wahrscheinlich scharf gefunden. Aber“, sie suchte nach den richtigen Worten, „ich weiß nicht, es fühlte sich seltsam an. Weißt du, so, wie wenn man plötzlich weiß, dass man besser die Autotüren verriegeln sollte.“ Sarah sah auf ihre Geldbörse und schüttelte dann den Kopf. „Ach, eigentlich brauche ich die hier nicht wirklich. Lass uns lieber ein Eis essen gehen. “
Mit ihren vierzehn Jahren war Rebecca alles andere als schüchtern. Sie schrieb gute Noten, wenn sie sich anstrengte, gehörte zur beliebtesten Clique, war die Erzfeindin von Tiffany Reynolds und ignorierte ihre Eltern, so gut es eben ging. Sie fand sich selbst cool und ziemlich schlau und den meisten anderen, die an ihrer Bushaltestelle einstiegen, überlegen. Ha, sie kicherte in sich hinein, vor allem Eddie oder, besser gesagt, Eddie-Spasti. Keines der Kinder dachte auch nur daran, leiser zu sprechen, wenn es diesen Spitznamen benutzte. Eddie Burling besuchte seit der dritten Klasse zusätzlich den „Unterricht für Kinder mit besonderem Förderbedarf“. Manchmal wirkte er völlig normal und, nun ja, durchschnittlich intelligent, dann wieder verhielt er sich aus heiterem Himmel ganz eigenartig. Rebecca erinnerte sich unangenehm daran, dass Eddie in der Sechsten einmal losweinte, weil ein Vogel gegen ein Fenster des Klassenzimmers geflogen war. Sechstklässler waren zum Heulen eindeutig zu groß. Aber er schien ernstlich besorgt um den armen Vogel und bat die Lehrerin, ihm helfen zu dürfen. Mrs. Marks erlaubte ihm, aus dem Fenster im Erdgeschoss zu steigen und den Vogel aufzuheben. Doch während sich kein anderer dafür interessierte, was Eddie tat, beobachtete Rebecca ihn, nachdem er das erbärmliche Federbüschel aufgesammelt hatte. Er hob den Vogel in beide Hände. Doch er legte ihn nicht behutsam wieder zurück. Es sah so aus, als … nein, sie war sich sicher, dass er den letzten Rest Leben aus ihm herausquetschte. Dann hob er das schmutzige Tier an seine Lippen und rief: „Flieg, Vogel, flieg!“ Er warf das Tier nach rechts in die Luft, aus Rebeccas Blickfeld. Eddie starrte anschließend zwar in den Himmel und lächelte, doch Rebecca wusste, dass der tote Vogel auf den Boden gestürzt war. Sie nahm sich vor, nach dem Unterricht nachzusehen. Doch später hatte sie den Vorfall schon fast wieder vergessen, und Tiffany begann wieder, sie zu ärgern, also ging sie stattdessen lieber schnell zum Bus.
Das war vor zwei Jahren gewesen, und jetzt stand sie an der Bushaltestelle und spähte zu Eddie hinüber. Er starrte auf seine Schuhspitzen. Sein Gesicht war so ver- pickelt, dass man nicht sagen konnte, ob sich jemals etwas Attraktives daraus entwickeln könnte. Seine Mutter fand ihn wahrscheinlich trotzdem süß. Aber, hey, warum machte sie sich überhaupt Gedanken über ihn? Er war praktisch zurückgeblieben. Obwohl, nicht richtig, nur „ein besonderes Kind“. Eddie-Spasti. Plötzlich sah er hoch und lächelte sie an. Rebecca drehte ihm schnell den Rücken zu und konzentrierte sich darauf, unbeteiligt zu wirken. Der Bus musste jeden Moment kommen. Eddies Lächeln vergaß sie so rasch wie das Wetter von gestern.
Eddie war verknallt. Becky war das tollste Mädchen der Schule. Er konnte sich nicht erinnern, wann er begonnen hatte, sie zu mögen. Alle seine Katzen hatte er nach ihr benannt. Da gab es Rebbie, Becker und Lil Beck. Manchmal beobachtete er sie draußen beim Werkzeugschuppen, wo sie Mäuse jagten und mit ihnen spielten. Er konnte ebenso still sitzen wie sie, und er imitierte ihre Bewegungen, schnappte nach Phantasieopfern, schlug sie mit seinen Klauen tot und verschlang die hilflosen Nager genüsslich. Eddie aß natürlich keine Mäuse, sondern er stellte sich dabei vor, dass er einem bestimmten Mädchen auflauern und es festhalten würde, um es zu küssen.
An der Bushaltestelle starrte er zwar immer nur auf seine Schuhe, aber er konnte aus seinen Augenwinkeln außergewöhnlich gut beobachten, was um ihn herum geschah. So bemerkte er jetzt, dass Becky zu ihm hersah, aber auch, dass der staubige, gelbe Bus sich bereits näherte. Sein Herz begann heftig zu klopfen. Er stellte sich vor, eine Katze zu sein. Was würden Rebbie oder Becker jetzt tun? Wenn Becky seine Maus wäre, könnte er dann lange genug stillhalten, um sie zu überraschen? Sie zu fangen? Die Grinse-Katze bei Alice im Wunderland lächelte dauernd, also sollte er das vielleicht auch tun. Er hob den Blick, drehte den Kopf in ihre Richtung und grinste Becky an.
Für Eddie stand plötzlich die Zeit still. Er sah fest in ihre Augen und wusste einfach, dass sie eines Tages zusammen sein würden. Vor seinem inneren Auge liefen all die Momente ab, in denen Becky ihn nicht ignoriert hatte. In der darauffolgenden Sekunde jedoch fiel Eddies Herz wie ein Stein zu Boden, weil Becky sich abwandte, ohne zurückzulächeln.
Eddies Glück war zerbrochen. Wieder einmal.
Rebecca hatte lange geweint, bis ihr die Tränen ausgingen. Sie musste immer noch auf die Toilette, und jetzt hatten sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt, sodass sie die Umrisse des Bettes erkennen konnte - und die eines Eimers, der am Fußende von der Decke hing. Trotz ihrer an den Bettpfosten geketteten linken Hand gelang es ihr, auf die Knie zu kommen und die rechte in Richtung Eimer auszustrecken. Ihr Bewegungsradius war gerade groß genug, um den Eimer von seinem Haken herunterzustoßen, sodass er auf die Matratze fiel. Er landete weich und rollte auch nicht herunter.
Plötzlich kamen ihr noch schlimmere Ängste: Was, wenn jemand hereinkam, sobald sie versuchte, sich mit einer Hand die Hose herunterzuziehen, sich über den Eimer zu hocken und danach wieder anzuziehen? Sie lauschte. Sie traute sich nicht zu rufen, fürchtete sich davor, den Eimer zu benutzen, aber auch davor, es nicht zu tun. Sie dachte an das Märchen Die Prinzessin auf der Erbse. Tja, sagte sie sich, diese Prinzessin muss jetzt jedenfalls pinkeln.
Sie brauchte bestimmt fünf Minuten, aber danach war sie zumindest ein bisschen erleichtert. Den Eimer schob sie ans äußerste Ende des Bettes. Bald würde es hier drin wie auf einem Plumpsklo stinken. Mal ganz abgesehen von dem Erbrochenen, das auf dem Boden unter ihr verteilt liegen musste.
Rebecca fixierte sich auf die Handschellen. Es gab immer noch zu wenig Licht, um Details zu erkennen, daher befühlte sie jeden Zentimeter mit Daumen und Zeigefinger. Da war ein kleiner Schließmechanismus, den es zu knacken galt. Sie befühlte den Metallzug am Reißverschluss ihrer Hose. Nein, das würde nicht funktionieren. Ihr Fingerring? Nein. Sie tastete den Bettpfosten und die Stäbe am Kopfende ab. Dann die Matratze. Nichts. Der Eimer? Vielleicht der Haken, an dem er gehangen hatte? Zu weit oben, um ihn zu erreichen. Aber der Eimer selbst? Der Henkel? Vielleicht.
Sie zog den Behälter an sich und rutschte mit ihm so nah wie möglich an den Bettpfosten heran. Dann klemmte sie den Eimer zwischen ihre Knie, damit sie den Henkel mit beiden Händen untersuchen konnte. Es war ein Stück gebogenes Metall mit einem kleinen runden Endstück, das sie bestimmt abreißen könnte. Konzentriert machte sie sich an die Arbeit. Sie wollte den Eimer bloß nicht ausschütten und sich vollspritzen. Erst hatte sie blind gearbeitet, aber nun wurde ihr klar, dass sie inzwischen immer besser sehen konnte, was sie tat. Ihre Umgebung bot aber nicht mehr, als sie bereits ertastet hatte. Der Raum maß wenige Meter zu jeder Seite, und bis auf das Bett war er leer, die Wände kahl.
Rebecca bog den Henkel in die andere Richtung und löste ihn schließlich vom Rand des Eimers. Mit einem unterdrückten Freudenschrei schob sie den Eimer zurück ans andere Ende des Bettes. Danach machte sie sich daran, das Schloss der Handschellen zu knacken.
Vier Jahre zuvor, mit vierzehn, war Becky zwar nicht extrem über die Stränge geschlagen, hatte aber die üblichen Dinge angestellt, die auch mal mit Hausarrest bestraft wurden. Einmal hatte ihre Mutter sie und ihre Freundin Alyssa beim Einkaufszentrum abgesetzt, weil sie ins Kino gehen wollten. Doch sobald ihre Mutter außer Sicht war, waren sie zu einer anderen Freundin gegangen, deren Eltern nicht zu Hause waren. Dort tauchten noch mehr aus der Clique auf. Zwei Jungs hatten Bier mitgebracht und ließen es rumgehen. Becky trank wie alle anderen auch davon, obwohl ihr die bittere Flüssigkeit gar nicht schmeckte. Irgendwann tat sie dann nur noch so, als würde sie weitertrinken. Als das Ganze immer mehr ausuferte, fühlte sie sich zunehmend unwohl und flüsterte Alyssa zu, dass sie zum vereinbarten Treffpunkt zurückmüssten, damit ihre Mutter sie dort abholen könnte.
„Ha, Leute, für Becky ist gleich Zapfenstreich“, lachte ihre Freundin. „Sie muss schnell zurück zur Mall, damit ihre Mami nichts merkt.“
Die anderen kicherten, und Becky fühlte sich mit einem Mal ausgestoßen. „Quatsch, Zapfenstreich!“, protestierte sie. Sie stand auf, sah ihre Freundin an und fragte: „Aber wie willst du denn nach Hause kommen?“ Dann stiefelte sie los.
Sie hatte erwartet, dass Alyssa ihr folgen würde, aber später erfuhr sie, dass diese mit jemand anderem mitgefahren war. Jedenfalls marschierte Becky zum Einkaufszentrum zurück und zerbrach sich den Kopf über eine plausible Begründung dafür, warum ihre Freundin nicht mehr dabei war. Damit wäre sie auch durchgekommen, wenn Alyssas Mutter nicht am Abend angerufen und gefragt hätte, ob es Becky auch so schlecht ginge wie ihrer Tochter. Es brauchte nicht viel elterlichen Spürsinn, um herauszufinden, was wirklich passiert war. Dafür bekam Rebecca Hausarrest. Und sie wurde nicht nur in ihr Zimmer verbannt. Ihr Vater tauschte auch noch den Türknauf gegen den des Gästebads. An jenem Abend sperrten ihre Eltern sie tatsächlich ein.
Damals hatte Rebecca zum ersten Mal versucht, ein Schloss zu knacken. Es dauerte nicht sehr lange, bis sie aus ihrem Schreibtisch eine Büroklammer geholt, aufgebogen und damit den Mechanismus geöffnet hatte. Schlösser waren simpler aufzubekommen, als sie gedacht hatte. Später wurde es eine Angewohnheit von ihr, zu probieren, was sie alles knacken konnte.
Rebecca kämpfte mit der Mechanik. Diese Handschellen waren nicht so dankbar wie der Türknauf eines Badezimmers, aber ihr blieb ja gar nichts anderes übrig, als es weiter zu versuchen.
Plötzlich hörte sie ein dumpfes Geräusch. Ein Motor. Ein Wagen näherte sich, und ihr Herz klopfte immer heftiger, je lauter es wurde. Retter oder Folterer?
Das Adrenalin schärfte all ihre Sinne. Letztlich waren alle Schlösser ähnlich. Sie versuchte, sich das Innere des winzigen Schlosses deutlich vorzustellen und sah jeden Millimeter der Metallteile vor ihrem geistigen Auge. Sie zwang sich dazu, tief zu atmen. Ihr Puls beruhigte sich. Das Auto war jetzt sehr nah, sehr laut. Dann rumpelte etwas so heftig, dass das Bett erzitterte. Einen Moment lang wollte sie aufgeben. Sie wusste, dass in dem Auto kein Polizist, nicht ihr Vater und auch kein Freund saß, der ihr zu Hilfe kam.
Der Motor lief noch, aber sie hörte keine Autotür zuschlagen.
Sie konzentrierte sich so sehr sie konnte, aber dieses Schloss blieb stur.
Edward saß bei laufendem Motor im Wagen.
Tränen liefen über sein Gesicht.
Und jetzt? Was sollte er tun? Er war praktisch ein erwachsener Mann, betrieb recht erfolgreich seine Geschäfte und verdiente damit jede Menge. Und er hasste es, wenn er sich so benahm. So emotional und wie ein Baby. Was für eine Heulsuse er doch war. Aber sein Leben war ja auch die Hölle gewesen. Die einzigen glücklichen Erinnerungen stammten aus der Zeit, als sein Vater noch gelebt hatte.
Dessen Tod war ein furchtbarer Unfall gewesen. Edward ging damals in die zweite Klasse und war richtig gut in der Schule. Er war zwar ein Einzelkind, hatte aber zwei beste Freunde. Gerade war er Wölfling bei den Pfadfindern geworden, und sein Vater hatte sie auf ihrer ersten Fahrt begleitet. Sie kamen von dem Wochenende in den Wäldern zurück und setzten noch einen anderen Jungen zu Hause ab. Edwards Vater trug ihm den Schlafsack zum Haus und ging dann zurück zum Auto, dessen Motor er hatte laufen lassen, als Edward, der währenddessen auf dem Fahrersitz gespielt hatte, die Automatik auf „Drive“ umschaltete. Der Wagen machte einen Sprung in dem Moment, als Edwards Vater die Einfahrt überquerte. Die Augen des Vaters trafen die des Sohnes mit einem fassungslosen Ausdruck. Dies war der letzte Blick, der Edward von seinem Vater in Erinnerung blieb. Seit damals hatte er nicht mehr glücklich sein können.
Jetzt saß Edward in dem laufenden Wagen und träumte vor sich hin. Das tat er oft: sich Szenen ausdenken, die ihn ruhiger und zufriedener werden ließen. Er konnte längere Zeit so vor sich hin denken und darüber seinen Gesprächspartner, den Straßenverkehr, das Fernsehen, die Arbeit oder Schule völlig vergessen. In diesen Träumen tauchten immer sein Vater und immer Rebecca auf.
Rebecca.
Was sie wohl gerade da unten machte?
Es gelang ihr. Das war unglaublich. Das Schloss war offen, vorsichtig zog sie ihr verletztes Handgelenk heraus. Es schmerzte und blutete heftiger, als ihr lieb war. Rebecca wollte den Henkel des Eimers weglegen, behielt ihn dann aber doch bei sich. Sie könnte ihn als Waffe benutzen, dachte sie, oder vielleicht brauchte sie ihn noch mal als Werkzeug. Jetzt aber nichts wie herunter von dem Bett und raus ins Freie.
Sie suchte den kleinen Raum nach Ausgängen ab. Von allen vier Seiten des Bettes spähte sie herunter. Nichts.
Draußen lief immer noch der Motor des Wagens, sie fand es seltsam, dass ihr Entführer noch nicht aufgetaucht war.
Nirgends konnte sie einen Weg nach draußen entdecken, und so richtete sie ihren Blick auf die Zementdecke. Der Haken, an dem der Eimer gehangen hatte, war in ein dunkleres Viereck geschraubt. Sie stand jetzt gebeugt darunter und untersuchte es akribisch. Es war eine Sperrholzplatte, die etwa sechzig mal sechzig Zentimeter maß und an einer Seite mit Scharnieren an der Decke befestigt war. Vorsichtig klopfte sie die Platte ab, laut schlagen wollte sie nicht, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.
Was, wenn sie diese Klappe öffnete und er sie direkt erwartete?
Was blieb ihr übrig, als es zu versuchen?
Mit ihren Fingernägeln versuchte sie, unter das Holz zu gelangen. Verzweifelt blickte sie sich nach etwas um, das ihr dabei helfen konnte. Der Henkel des Eimers war zu schmal. Sie brauchte irgendein anderes Werkzeug. Ein Messer wäre gut gewesen.
Draußen lief weiterhin der Motor.
Rebecca zog sich ihren Ring vom Finger und versuchte, ihn in den kleinen Zwischenraum zu stecken. Und was brachte das nun? Tränen stiegen ihr in die Augen, und sie war nahe dran, alle Hoffnung aufzugeben. Sie wollte den Ring schon zurück an ihren Finger stecken, als ihr die flachen, geschlitzten Schrauben an den Scharnieren auffielen. Sie waren alt und konnten nicht besonders fest sitzen. Ihr Peiniger hatte sicherlich nicht damit gerechnet, dass sie es bis zu dieser Klappe schaffen könnte. Ihr Ring hatte eine schmale, gerade Verzierung, und vielleicht konnte sie … Sie setzte ihn auf die Schraube und drehte mit aller Kraft gegen den Uhrzeigersinn. Es war eine langsame, schweißtreibende Arbeit, aber schließlich löste sich das erste Scharnier. Sie ließ es auf die Matratze fallen, dann machte sie sich an das zweite. Das war leicht, es fiel ab, und die Sperrholzplatte sackte ein paar Zentimeter nach unten. Das Motorengeräusch war jetzt lauter zu hören. Graues, schwaches Licht fiel durch den Spalt. Es musste Morgen sein. Das Licht schmerzte ein wenig in ihren Augen, aber zugleich verschaffte es ihr neue Energie. Rebecca verrenkte sich, um unter der Klappe hindurch nach draußen zu spähen. Sie konnte einen bewölkten Himmel erkennen, eine Bretterwand und, was am wichtigsten war, einen langen Stock, der durch zwei Ringe geschoben über ihr lag, um die Falltür sicher zu verschließen.
So einfach hatte man es ihr also doch nicht machen wollen.
Rebecca schob eine Hand durch die Öffnung und versuchte, den Stock zu greifen, aber auch wenn ihr Arm sehr schlank war, reichte sie nicht an ihn heran. Sie sank zurück auf die Matratze und fischte wieder nach dem Henkel des Eimers. Mit dieser Verlängerung schob und zog sie, ruckte und rüttelte an dem Stock herum. Schließlich gelang es ihr, ein Ende davon näher an die Öffnung zu schieben. Nun langte sie mit beiden Händen durch den Spalt. Mit einem Fuß wollte sie sich gegen die Decke stemmen, um mehr Schwung zu bekommen, doch sie hatte ihn kaum angehoben, als unter dem Gewicht ihres Körpers die Holzplatte in zwei Teile zerbrach. Überrascht fiel sie auf die Matratze zurück, und das Krachen des Holzes hallte in ihren Ohren wider. Der Eimer stürzte um, sein Inhalt ergoss sich auf die Matratze.
Atemlos lag Rebecca da.
Immer noch lief draußen der Motor des Autos. Keine Tür wurde geöffnet, keine zugeschlagen.
Rebecca zog den Stock heraus und hob den Rest der Platte aus der Verankerung. Sie konnte jetzt aufrecht stehen und ihre Arme und Schultern durch die Öffnung strecken. Der laufende Wagen musste hinter der vielleicht eineinhalb Meter hohen Holzwand stehen. Vor dieser Wand entdeckte sie Turnschuhe. Geräuschlos kletterte sie aus dem Verlies und nahm sich die Schuhe. Sie zog sie an und stellte dankbar fest, dass sie nahezu perfekt passten. Dann schlich sie an der Wand entlang.
Nur weg von dem Auto.
Edward genoss seinen Tagtraum, schloss die Augen und schlief tatsächlich ein. Wegen der geschlossenen Fenster und dem eintönigen Brummen des Motors hörte er nicht das Zersplittern der Klappe, nur wenige Meter entfernt. Er war heute keine sehr wachsame Katze. Er sah nicht, wie die Maus aus ihrem Loch entwischte. Er sah auch nicht, wie sie um die Holzwand herum schlich. Er sah Rebecca nicht, als sie geduckt auf den schützenden Wald zulief. Er träumte. Er schlief. Und während die Katze ein Nickerchen machte, verschaffte sich die Maus einen Vorsprung.
„Eddie, lass das!“, schrie seine Mutter aus vollem Hals. Sie schlug auf seine Hand, die sie ihm aus dem Mund gerissen hatte. „Nägelkauen ist widerlich.“ Sie packte ihn bei den schmalen Schultern und schüttelte ihn heftig. „Ich warne dich, wenn du so weitermachst, wird Daddy nie zurückkommen.“
Eddie sah zum Küchenfenster hinaus auf die Spielzeuglaster im Garten. Wie gerne würde er zum Spielen nach draußen gehen, aber gestern hatte sie ihm eröffnet, dass er von nun an zu alt dafür sei. Tatsächlich hielt sie ihn für zu groß zum Spielen, aber für zu klein, um die Wahrheit auszuhalten. Er wusste, dass sein Vater tot war. Er war schließlich dabei gewesen.
Der Sommer war zu Ende, und er würde bald in eine neue Klasse kommen. Als Halbwaise.
Ohne dass es ihm bewusst gewesen wäre, wanderten die Finger wieder zum Mund, und er kaute weiter.
Klatsch!
„Eddie, lass das! Wie oft muss ich dir das noch sagen?“ Seine Mutter stemmte die Hände in die Taille und starrte ihn kalt an. Eddie sah zu Boden und antwortete nicht. Genau genommen hatte er den ganzen Sommer über kaum etwas gesagt, aber ihr schien das gar nicht aufzufallen.
Er trat ans Spülbecken und nahm sich ein Glas Wasser. Das stürzte er hinunter und stellte danach das leere Glas in die Spülmaschine, wie sie es ihm beigebracht hatte. Dann, als sich seine Mutter endlich nicht mehr mit ihm beschäftigte, verschwand er in den Garten hinterm Haus.
Auf dem Weg zu seinen Spielzeuglastern blieb er stehen und starrte in den Himmel. Den Blick nach oben gerichtet, behielt er den Kopf im Nacken, schielte aber in Wirklichkeit an seiner Nase entlang zum Haus, um zu sehen, ob seine Mutter ihn beobachtete. Sie räumte offenbar auf, hatte ihm den Rücken zugekehrt. Sehr gut! Rasch hob er seine Fahrzeuge auf und verzog sich damit hinter den Werkzeugschuppen, außer Sichtweite.
Eddie ließ sich gegen die Bretterwand sinken und steckte sofort einen Fingernagel in den Mund. Mit der freien Hand schob er einen riesigen Truck herum. Dann spuckte er den Nagel aus und nahm sich G. I. Joe von einem anderen Laster. Er stellte die Spielfigur vor die Schuppenwand und ließ den Truck langsam auf das stumme Opfer zurollen. Im letzten Moment jedoch tat es ihm leid, und er flüsterte: „Ich werde dich retten.“ Er bückte sich und schleuderte die Puppe weg. Dann beschimpfte er den Truck mit allen schlimmen Wörtern, die ihm einfielen.
Er spielte die Szene noch ein paarmal, bis er hörte, dass seine Mutter ihn zum Abendessen rief. Er ließ seine Spielsachen liegen, lief um die Ecke und weiter in die Küche.
Seine Mutter schien immer verärgert. Sie lächelte nie. Wie üblich schickte sie ihn bloß zum Händewaschen, und als er in die Küche zurückkam, schenkte sie ihm wortlos Kakao ein. Eddie setzte sich und starrte auf den leeren Stuhl, auf dem sein Vater immer gesessen hatte. Unbewusst begann er wieder, an seinen Nägeln zu knabbern.
„ Eddie! “






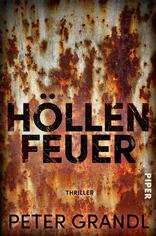



DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.