
Patient ohne Verfügung
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Thöns hofft, dass sich angesichts der großen Resonanz auf das Buch auch die Politik bewegt.“
Ärzte ZeitungBeschreibung
Ein Plädoyer gegen Übertherapie am Lebensende
In deutschen Kliniken wird operiert, katheterisiert, bestrahlt und beatmet, was die Gebührenordnung hergibt – ein durchaus rentables Geschäft. Dr. Matthias Thöns berichtet aus seiner jahrelangen Erfahrung von zahlreichen Fällen, in denen alte, schwer Kranke mit den Mitteln der Apparatemedizin behandelt werden, obwohl kein Therapieerfolg mehr zu erwarten ist.
Finanzieller Profit steht im Fokus des Interesses vieler Ärzte und Kliniken. Thöns' Appell lautet deshalb: Wir müssen in den Ausbau der Palliativmedizin investieren, anstatt das Leiden alter…
Ein Plädoyer gegen Übertherapie am Lebensende
In deutschen Kliniken wird operiert, katheterisiert, bestrahlt und beatmet, was die Gebührenordnung hergibt – ein durchaus rentables Geschäft. Dr. Matthias Thöns berichtet aus seiner jahrelangen Erfahrung von zahlreichen Fällen, in denen alte, schwer Kranke mit den Mitteln der Apparatemedizin behandelt werden, obwohl kein Therapieerfolg mehr zu erwarten ist.
Finanzieller Profit steht im Fokus des Interesses vieler Ärzte und Kliniken. Thöns' Appell lautet deshalb: Wir müssen in den Ausbau der Palliativmedizin investieren, anstatt das Leiden alter Menschen durch Übertherapie qualvoll zu verlängern.
„Dieses Buch ist überfällig! Unbedingt lesen!“Deutschlandfunk
Über Matthias Thöns
Aus „Patient ohne Verfügung“
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Ehrlich gesagt – mit so viel strengem Gegenwind hatte ich nicht gerechnet, als „Patient ohne Verfügung“ im September 2016 erschienen ist. Viele Kollegen waren aufgebracht, vor allem in meiner Heimatstadt Witten. Ich wurde zu einem Krisengespräch in die örtliche Zeitungsredaktion zitiert – es waren mit die unangenehmsten 60 Minuten in meinem Leben. Das Buch diffamiere Ärzte, die Kritik sei zu pauschal, übertrieben, polemisch oder populistisch, hieß es. Der Ärzteschaft sei das Buch sauer aufgestoßen. Es entspreche nicht den Tatsachen, [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Thöns kritisiert die seiner Meinung nach ausufernde Apparatemedizin, legt niederschmetternde Zahlen und Studien zur Geschäftsmacherei mit Apparatemedizin, Krebsbehandlungen und Operationen vor.“
Westdeutsche Allgemeine„Ein Arzt, der Klartext redet.“
Pforzheimer Zeitung„In seinem Buch ›Patient ohne Verfürgung‹ schildert er drastische Fälle einer qualvollen Überversorgung. Von den Hausärzten erhofft er sich Unterstützung für sein Anliegen: Menschen vor Übertherapie zu bewahren und einen würdevollen Tod zu ermöglichen.“
MMW Fortschritte der Medizin„Das sehr verständlich formulierte Buch macht dem Leser Mut, den eigenen Willen klar zum Ausdruck zu bringen und zu bestimmen, wie und mit welchem medizinischen Ziel er behandelt werden will.“
Kölner Leben„Die Beispiele, die Thöns beschreibt, machen seine Anklage anschaulich: Sie berühren und machen auch wütend. Folgerichtig findet man am Ende dieses ausgezeichneten Buchs die Vorlage für eine Patientenverfügung.“
Gesundheitstipp„Hier verschafft Thöns dem Leser Einsichten in Bestechungsversuche, die bisher kaum bekannt wurden. So rechnen ihm findige Ernährungsberater vor, dass die Provisionen von Firmen für zwei bis drei Patienten, denen man die künstliche Ernährung mittels Magensonde andient, schon geeignet sind, eine Stelle für eine weitere Mitarbeiterin zu finanzieren, von persönlichen Annehmlichkeiten als Sahnehäubchen ganz abgesehen. Dass überall eine Menge Geld im Spiel ist, argwöhnen inzwischen viele, Thöns’ Beispiele beglaubigen, dass es nicht nur Verschwörungstheoretiker sind.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung„Thöns empfiehlt, rechtzeitig eine möglichst konkrete Patientenverfügung zu verfassen und eine nahe Person mit einer Vollmacht auszustatten.“
Focus„Palliativmediziner Dr. Matthias Thöns prangert dieses ›Geschäft mit dem Lebensende‹ an und appelliert an Pflegende, sich für das Patientenwohl stark zu machen.“
Die Schwester Der Pfleger„Das vorliegende Buch ist ein wichtiger beitrag. Mit großer Detailkenntnis schreibt Matthias Thöns vom ›Geschäft mit dem Lebensende‹, das mit ›Patient(en) ohne Verfügung‹ in den deutschen Kliniken gemacht wird. (...) Dem Buch ist eine weite Verbreitung, eine innerärztliche Diskussion und ihr folgende Veränderungen zu wünschen.“
Deutsches Ärzteblatt„Dr. Matthias Thöns schildert in seinem Buch ›Patient ohne Verfügung‹ viele Leidensgeschichten und Beispiele einer palliativen Betreuung der Patienten und deren Angehörige. Er spricht aber auch klipp und klar die gängige Praxis der Lebensverlängerungen an, die in Wahrheit nur eine Leidensverlängerung sind.“
Carpe Vitam„Der Arzt schildert nicht nur das Schicksal der leidenden Menschen und die Gründe für Übertherapie. Er zeigt auch auf, wie man individuell und gesellschaftlich gegensteuern kann. Ein sehr lesenswertes Buch zu einem elementaren Thema, das oft verdrängt wird.“
Bild der Wissenschaft„Thöns zeigt eindringlich, dass im Interesse schwer Kranker das allseitige Schweigen ein Ende haben muss.“
Badische Zeitung„Das vorliegende Buch ist ein wichtiger Beitrag in der Diskussion um das Problem der Übertherapie am Lebensende. (...) Insgesamt handelt es sich um ein Werk, das insbesondere Ärzten aber auch Juristen wichtige Impulse geben kann.“
ArztRecht„Thöns hofft, dass sich angesichts der großen Resonanz auf das Buch auch die Politik bewegt.“
Ärzte ZeitungVorwort zur Taschenbuchausgabe
Einleitung
1 Lungenversagen: Der letzte Atemzug ist kein Grund zu sterben
2 Chemotherapie ohne Wenn und Aber
3 Chirurgische Eingriffe: Deutschland als OP-Weltmeister
4 Herzversagen: Paradedisziplin für teure Hightechmedizin
5 Wehrlos im Wachkoma
6 Dialyse: Lohnende Blutwäsche
7 Demenz: Vergessen und abkassiert
8 Strahlentherapie: Quelle strahlender Gewinne
9 Künstliche Ernährung: Lukrativ, aber oft sinnlos
10 Schmerzen: Weniger ärztliches Eingreifen ist mehr
11 Notarztdienst: Vom Nicht-sterben-Lassen
12 Palliativversorgung: Mehr Lebensqualität, weniger Umsatz
13 Reden wir über Geld
14 Das Sterbeverlängerungskartell
15 Ausblick oder Lichtblick
Anhang I: Patientenverfügung
Anhang II: Schriftliche Stellungnahme vor dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages
Danke
Anmerkungen
Stichwortverzeichnis







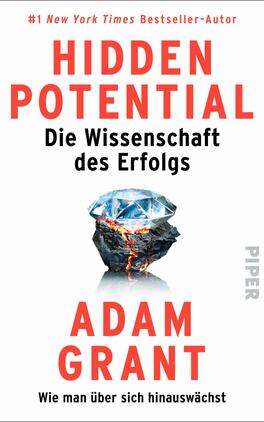


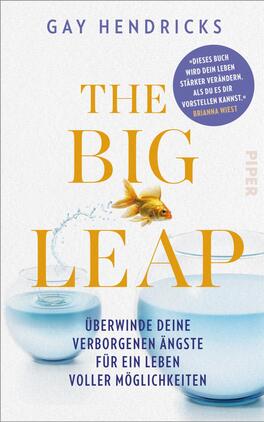
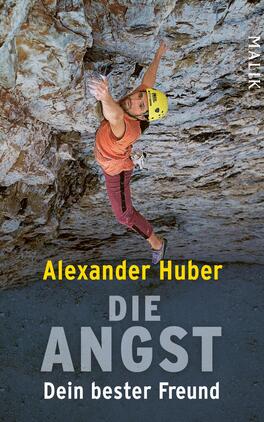




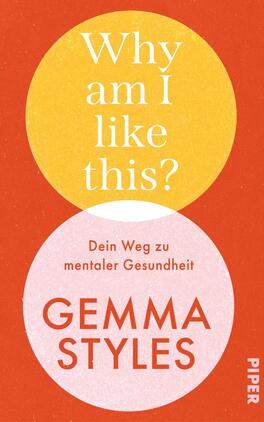



Bewertungen
Patient ohne Verfügung
ich kann dieses Buch unbedingt empfehlen,
auch wenn es stellenweise sehr schwer zu verdauen und ernüchternd ist,
die Konsequenz kann nur eine Patientenverfügung sein,
ich werde mein Exemplar im Bekanntenkreis jedem anbieten und zur Verfügung stellen,
abschließend b…
ich kann dieses Buch unbedingt empfehlen,
auch wenn es stellenweise sehr schwer zu verdauen und ernüchternd ist,
die Konsequenz kann nur eine Patientenverfügung sein,
ich werde mein Exemplar im Bekanntenkreis jedem anbieten und zur Verfügung stellen,
abschließend bleibt die Erkenntnis, dass dieses Buch offenbart, dass in unserer Gesellschaft so auch im Gesundheitswesen einiges in Schieflage geraten ist und dringender bzw umfassender Reformen bedarf