
Gebrauchsanweisung fürs Reisen mit Kindern - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Zwei plus Vier macht Sechs: Die Globetrotterin Jana Steingässer erkundet mit ihrem Mann und ihren vier Kindern von Australien bis Grönland, von den Alpen bis Südafrika regelmäßig die Welt. Ansteckend schildert sie, wie man in einer pulsierenden Großstadt, der arktischen Wildnis oder einer Sandwüste zusammen die schönsten Abenteuer erlebt und Kinder von ihren Erfahrungen mit fremden Kulturen profitieren. Sie verrät, welches Spielzeug in den Koffer gehört. Mit welchen Tricks jeder Einzelne auf seine Kosten kommt, obwohl man Entscheidungen gemeinsam als Familie trifft. Dass Not überaus…
Zwei plus Vier macht Sechs: Die Globetrotterin Jana Steingässer erkundet mit ihrem Mann und ihren vier Kindern von Australien bis Grönland, von den Alpen bis Südafrika regelmäßig die Welt. Ansteckend schildert sie, wie man in einer pulsierenden Großstadt, der arktischen Wildnis oder einer Sandwüste zusammen die schönsten Abenteuer erlebt und Kinder von ihren Erfahrungen mit fremden Kulturen profitieren. Sie verrät, welches Spielzeug in den Koffer gehört. Mit welchen Tricks jeder Einzelne auf seine Kosten kommt, obwohl man Entscheidungen gemeinsam als Familie trifft. Dass Not überaus erfinderisch macht, wenn mal beide Eltern krank werden sollten. Und dass man auf Reisen vom unverstellten Blick seiner Kinder eine ganze Menge lernen kann.
Über Jana Steingässer
Aus „Gebrauchsanweisung fürs Reisen mit Kindern“
1+1=2, 2+1=?
Fragen Sie mich! Bitte, tun Sie mir den Gefallen und fragen mich: nach einem der schönsten aller Erlebnisse, das das Reisen mit Kindern für mich auf den Punkt bringt. Die Antwort wird Sie vielleicht überraschen, denn sie ist auffällig unspektakulär, aber sie bewegt mich trotzdem noch heute, etwa fünf Jahre später.
Sermiligaaq, Ostgrönland. Das Holzhüttchen, das auf nacktem Fels über dem Fjord thront, ist für einige Tage unser Zuhause. Fließendes Wasser gibt es hier nicht – in keinem der Häuser. Während Jens mit Kanistern über die Felsen absteigt zu dem [...]









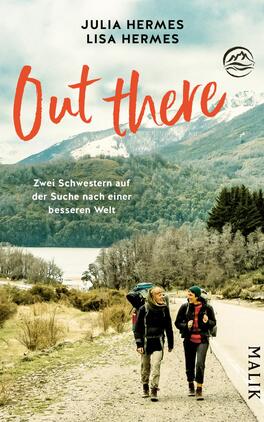
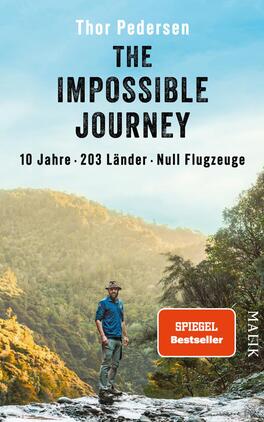


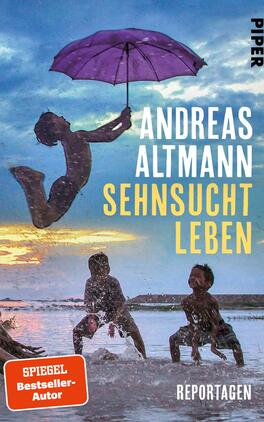
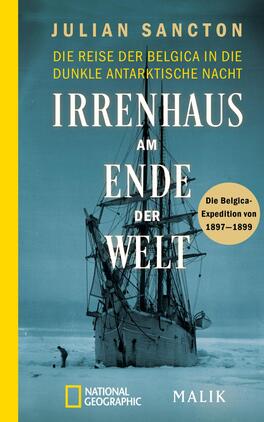




Die erste Bewertung schreiben