
Gebrauchsanweisung für Tirol - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Schuchter nimmt seine Leser an die Hand, wird persönlich, wenn er aus seinem Tiroler Leben und seinen Erlebnissen erzählt, und er weiß unheimlich viel.“
reisebuecherwanderfuehrer.blogspot.deBeschreibung
Von Landeck bis Lienz, Zillertal bis Kufstein: Bernd Schuchter, waschechter Tiroler, begibt sich jenseits der gängigen Werbeslogans auf die Suche nach dem Mythos seiner Heimat. Vorbei an Almwiesen und steilen Hängen zieht es ihn in die Universitätsstadt Innsbruck – seit dem Mittelalter wichtiger Knotenpunkt zwischen Nord und Süd. Er ergründet seine Landsleute, diese seltsamen Wesen, die so gerne schweigen und dabei stolz sind auf ihre Berge und tausend Kirchen, auf Krimiautoren wie Bernhard Aichner und Erfolgsunternehmen wie Swarovski. Und er geht selbstironisch den brisantesten Fragen nach:…
Von Landeck bis Lienz, Zillertal bis Kufstein: Bernd Schuchter, waschechter Tiroler, begibt sich jenseits der gängigen Werbeslogans auf die Suche nach dem Mythos seiner Heimat. Vorbei an Almwiesen und steilen Hängen zieht es ihn in die Universitätsstadt Innsbruck – seit dem Mittelalter wichtiger Knotenpunkt zwischen Nord und Süd. Er ergründet seine Landsleute, diese seltsamen Wesen, die so gerne schweigen und dabei stolz sind auf ihre Berge und tausend Kirchen, auf Krimiautoren wie Bernhard Aichner und Erfolgsunternehmen wie Swarovski. Und er geht selbstironisch den brisantesten Fragen nach: Kennen sich hier alle fünfhunderttausend Einwohner wirklich persönlich? Beginnen amouröse Abenteuer immer noch mit einer Leiter, die am Fenster der Angebeteten angelegt wird? Und was bewegt Jahr für Jahr Millionen von Menschen dazu, hier ihren Urlaub zu verbringen?
Über Bernd Schuchter
Aus „Gebrauchsanweisung für Tirol“
Tirol isch lei oans,
Isch a Landl a kloans,
Isch a schians, isch a feins,
Und dås Landl isch meins.
Tirol ist nur eines,
Ist ein Ländchen ein kleines,
Ist ein schönes, ist ein feines,
Und das Ländchen ist meines.
Inoffizielle Landeshymne Tirols, verfasst
von Reimmichl, d. i. Sebastian Rieger,
heute bekannt durch den Reimmichl-Kalender
Ich bin Tiroler.
Wenn ich meiner Mutter sage: „Ich gehe nach Deutschland“ oder „Ich gehe nach Frankreich“ oder „Ich gehe nach Schweden“, dann sagt sie nichts, sondern zuckt nur mit den Schultern. Das soll heißen, ich werde schon wissen, was [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Schuchter ist ein guter Beobachter, ein kundiger Erzähler und verfügt über die nötige Portion Selbstironie.“
kultur.tirol.at„Bernd Schuchter, legt eine ›Gebrauchsanweisung für Tirol‹ vor, in welcher er ebenfalls in subjektiver Manier Phänomenen wie dem ›Kaspressknödelfaktor‹ oder der Trias ›Leder, Loden und Polyester‹ leserfreundlich auf der Spur ist und sich dabei weniger als klassischer Reise- denn mehr als kulturhistorischer Mentalitätsführer durch sein Heimatbundesland erweist.“
Wiener Zeitung (A)„Bernd Schuchter erzählt mit Genauigkeit und Leichtigkeit über Tirol (…) Dabei erfährt man auf amüsante Weise, was Tirol zu dem macht, was es ist: Ein liebenswertes, stolzes und gleichzeitig kontroverses Land.“
StadtBlatt Innsbruck (A)„Als waschechter Tiroler versucht Schuchter auf eine lockere Art, die Bräuche des Landes für andere Europäer, Urlauber und Touristen verständlich zu machen. (...) Die Leser dürfen sich über einen kleinen, kompakten Einblick in die Lebensgewohnheiten und kulinarischen Spezialitäten der Tiroler freuen.“
Rundschau Ausgabe Telfs (A)„Humorvoll und durchaus auch kritisch richtet der Autor einen subjektiven Blick auf das Land. (...) Mit seinem Reiseführer präsentiert Schuchter eine sprachlich gut verständliche, amüsante und alltags-taugliche ›Gebrauchsanweisung für Tirol‹.“
Rundschau Ausgabe Landeck (A)„Wenn es an einem nicht mangelt in der Einschätzung der Tiroler, dann an einer beachtlichen Vielzahl von Klischees über Land und Leute. (...) Bernd Schuchter lässt in seiner ›Gebrauchsanweisung für Tirol‹ keines dieser Klischees aus, schaut aber hinter die Kulisse, liebevoll, kritisch, mit einem gewissen Maß an Respekt und Humor gleichermaßen.“
RegionalMagazin Schwaz (A)„Bernd Schuchter begibt sich jenseits der gängigen Werbeslogans auf die Suche nach dem Mythos seiner Heimat.“
Märkischer Sonntag„Schuchter nimmt seine Leser an die Hand, wird persönlich, wenn er aus seinem Tiroler Leben und seinen Erlebnissen erzählt, und er weiß unheimlich viel.“
reisebuecherwanderfuehrer.blogspot.deWo sind die Tiroler?
Von Grüß Gott bis Tschüü-hüss
Da wo die Heimat ist
Leder, Loden und Polyester
Der Sandwirt aus dem Passeiertal
Der Kaspressknödelfaktor
Landvermessung
Ein alter Schmerz – Provokation und Skandal
Schneesicherheit und großes Theater
Lebenserhaltende Maßnahmen – das Dorfzentrum
Teufellaufen, Wampelerreiten und Skizirkus
Schlecht frisierte Rebellen
Der berühmteste Tiroler
Patriarchen, Chauvinisten und eine legendäre Rote
Mein Tirol
Ausflugsziele
Literatur
Dank




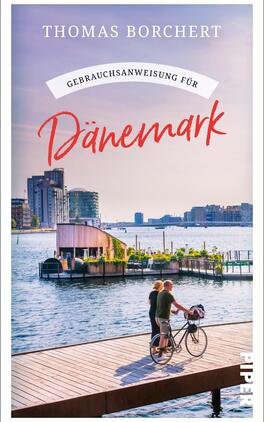
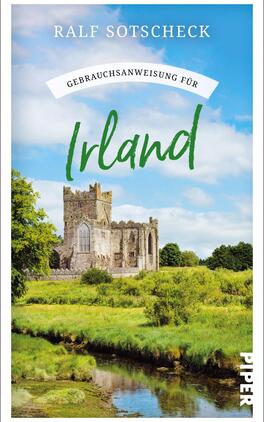
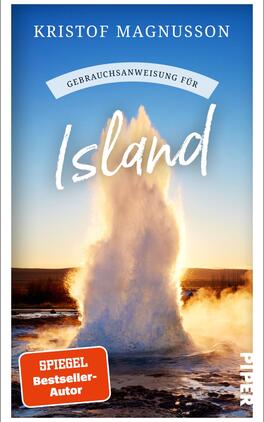
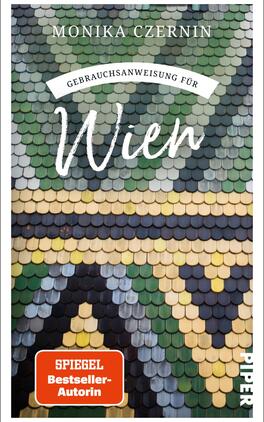
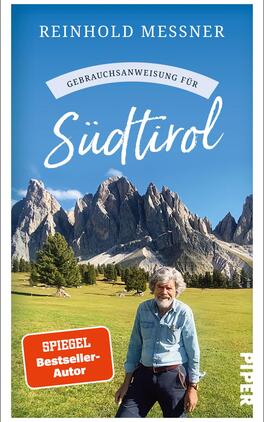
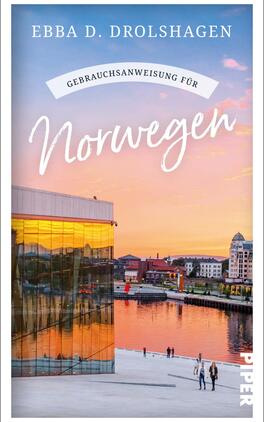
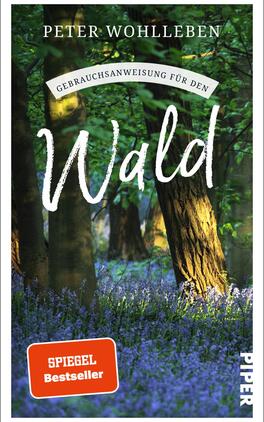
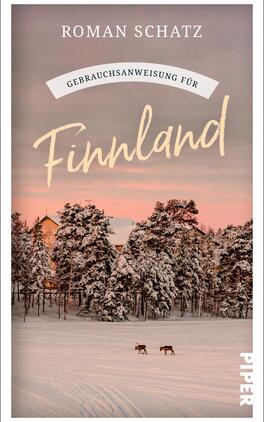
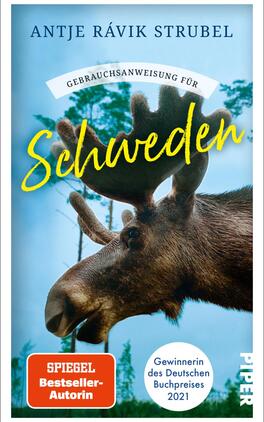
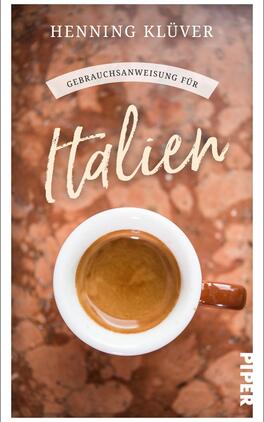
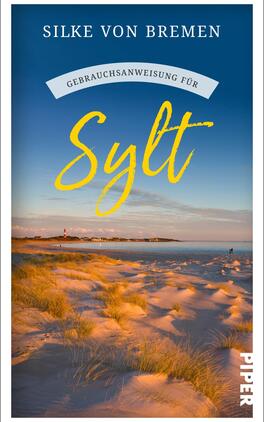
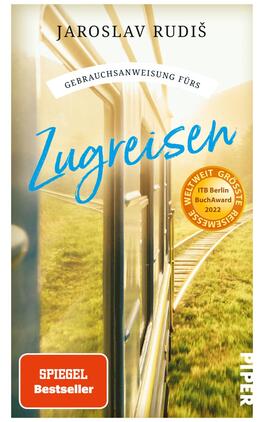



Die erste Bewertung schreiben