
Für den Rest des Lebens - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Die Botschaft dieses literarisch und psychologisch so kunstvollen wie süffig zu lesenden Textes: So schwierig das Leben auch insgesamt sein mag, so große Fehler wir auch machen, so viele Wiedersprüche wir aushalten und so viele Schläge und Niederlagen wir einstecken müssen: Nichts ist starr in diesem Leben; Veränderung ist möglich. Und damit die Hoffnung.“
Süddeutsche Zeitung ExtraBeschreibung
Chemda Horovitz liegt in ihrem Bett und blickt mit schwindendem Bewusstsein auf ihr Leben zurück. Sie denkt an ihre Kindheit im Kibbuz, an ihre Ehe und ihre zwei Kinder, von denen sie eines zu sehr und das andere zu wenig liebte. Ihr geliebter Sohn Avner ist zu einem Mann herangewachsen, dessen Erfolg als Anwalt ihn nicht von seiner tiefen Verbitterung erlösen kann. Er verfällt einer geheimnisvollen Frau, die seine Liebe nicht erwidert. Chemdas Tochter schenkt alle Liebe und Aufmerksamkeit ihrer Tochter. Als diese sich immer weiter von ihr entfernt, entsteht in ihr das mächtige Verlangen, ein…
Chemda Horovitz liegt in ihrem Bett und blickt mit schwindendem Bewusstsein auf ihr Leben zurück. Sie denkt an ihre Kindheit im Kibbuz, an ihre Ehe und ihre zwei Kinder, von denen sie eines zu sehr und das andere zu wenig liebte. Ihr geliebter Sohn Avner ist zu einem Mann herangewachsen, dessen Erfolg als Anwalt ihn nicht von seiner tiefen Verbitterung erlösen kann. Er verfällt einer geheimnisvollen Frau, die seine Liebe nicht erwidert. Chemdas Tochter schenkt alle Liebe und Aufmerksamkeit ihrer Tochter. Als diese sich immer weiter von ihr entfernt, entsteht in ihr das mächtige Verlangen, ein Kind zu adoptieren und noch einmal von vorne zu beginnen. Doch der Widerstand ihrer Familie treibt sie in eine Sackgasse. Sie kann den Traum nicht überwinden, der das zu sprengen droht, was er eigentlich retten soll: ihre Familie. In Für den Rest des Lebens erzählt Zeruya Shalev von den elementaren Kräften zwischen Eltern und Kindern, von Wut, Enttäuschung und Sehnsucht, von Verletzungen und Liebe und davon, wie sich die Familienbande als stärker und beständiger erweisen als alles Sehnen und Streben, diese zu zerschneiden, und stärker als alle Kräfte, die uns trennen.
Über Zeruya Shalev
Aus „Für den Rest des Lebens“
Erstes Kapitel
Ist das Zimmer gewachsen oder ist sie es, die geschrumpft
ist? Schließlich ist es doch das kleinste Zimmer in einer
Wohnung, klein wie eine Handfläche, und nun, da sie von
morgens bis abends im Bett liegt, kommt es ihr vor, als
hätte sich das Zimmer ausgedehnt, als wären Hunderte
von Schritten nötig, um zum Fenster zu kommen, und
wer weiß, ob ihr Leben ausreichen würde. Der Rest ihres
Lebens, besser gesagt, die letzte Frist des Lebens, die
ihr zusteht, kommt ihr absurderweise wie eine Ewigkeit
vor, denn weil ihr jede Bewegung fehlt, scheint sich die
Zeit endlos [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„In ihrem neuen Roman 'Für den Rest des Lebens' errichtet die israelische Autorin Zeruya Shalev das Denkmal einer Mutter.“
Süddeutsche Zeitung„Gnadenlos konfrontiert Shalev ihre Figuren mit den Trümmern eines Lebens, das sie zu lange irgendeiner Idee geopfert haben: der Idee, einen neuen Menschen zu schaffen, eine ideale Gesellschaft oder eine harmonische Familie. Suggestiv erzählt die Autorin davon. Mit atemlosen, absatzlosen Sätzen. Sie reißen beinahe körperlich spürbar, von Miriam Pressler großartig übersetzt, den Leser in psychische Tiefen, doch weisen kraftvoll und bildreich immer auch über die Protagonisten dieses Romans hinaus.“
Radio Bremen„Jedes Wort das Zeruya Shalev anbietet ist wertvoll. Dieser Roman ist ein bewegendes, vielleicht auch erschütterndes Zeugnis von der Tiefe der Gefühle, die uns ein Leben lang begleiten und bestimmen können. Familienbande über Generationen und Umstände hinweg, die Kraft und Einfluss besitzen.“
NDR 1 "Bücherwelt"„Die Botschaft dieses literarisch und psychologisch so kunstvollen wie süffig zu lesenden Textes: So schwierig das Leben auch insgesamt sein mag, so große Fehler wir auch machen, so viele Wiedersprüche wir aushalten und so viele Schläge und Niederlagen wir einstecken müssen: Nichts ist starr in diesem Leben; Veränderung ist möglich. Und damit die Hoffnung.“
Süddeutsche Zeitung Extra




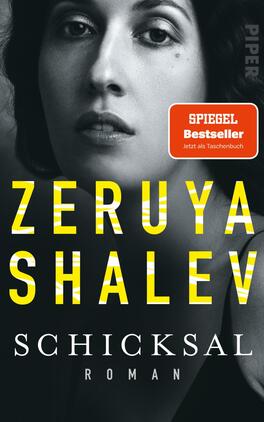
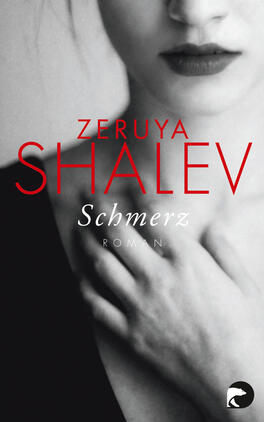
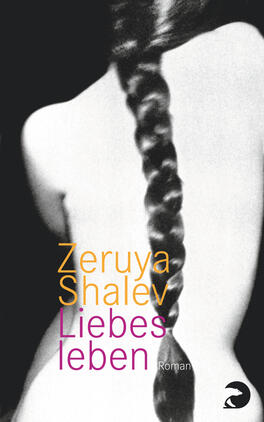



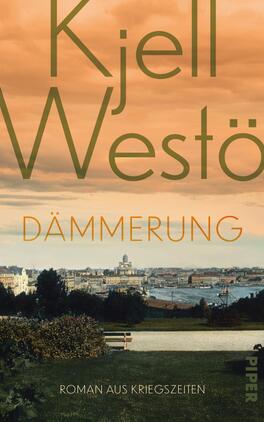

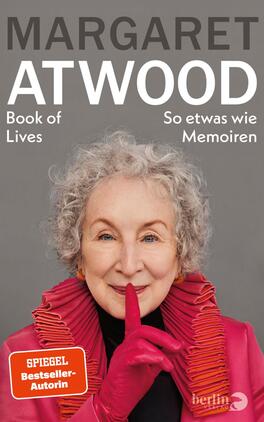

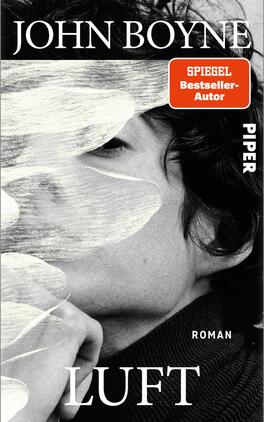



Die erste Bewertung schreiben