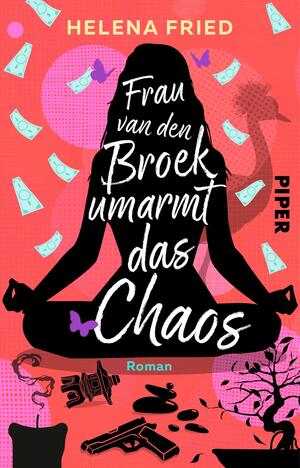
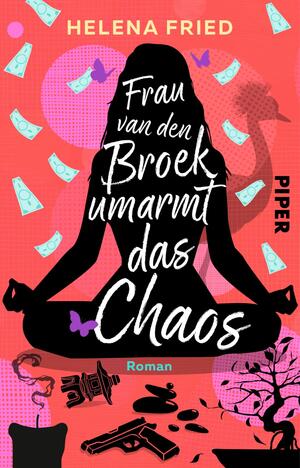
Frau van den Broek umarmt das Chaos Frau van den Broek umarmt das Chaos - eBook-Ausgabe
Roman
— Ein humorvoller Roman rund um Achtsamkeit und Entschleunigung„Leichte Wohlfühllektüre“ - Badische Zeitung
Frau van den Broek umarmt das Chaos — Inhalt
Eine Frau auf der dringenden Suche nach Entschleunigung. Ihr auf den Fersen: zwei Bankräuber auf der Suche nach ihrem Geld – da ist Chaos vorprogrammiert!
Als die von Künstlern und Kulturbetrieb genervte Galeristin Vera van den Broek eine Auszeit nimmt, ahnt sie nicht, wie turbulent ihre Suche nach Entschleunigung werden wird. Schnell ist ihre To-do-Liste länger denn je: Qigong, für die alte Mutter sorgen, Mal- und Sprachkurs, einen Hund aus dem Tierheim holen – nicht gerade entspannt. Und dazu ziemlich teuer! Dann gerät sie auch noch in einen Bankraub, wird zur Geisel und nimmt einen Teil der Beute an sich. Geld hat Vera jetzt genug, aber dafür sind ihr ein cholerischer Bankräuber und eine undurchschaubare Kommissarin auf den Fersen …
Auszeit mal anders: Helena Frieds humorvoller Blick auf die Themen Achtsamkeit und Selbstverwirklichung
Für die Leser:innen von Monika Bittl, Franka Bloom und Steffi von Wolf
Leseprobe zu „Frau van den Broek umarmt das Chaos“
„Das werden Sie bereuen“, hatte die Kunstkritikerin mir ins Gesicht gezischt, nachdem sie sich an jenem verhängnisvollen Abend vom Boden aufgerappelt hatte.
Natürlich war mir in diesem Moment nicht bewusst, dass diese unbedachte Tat mein ganzes bisheriges Dasein buchstäblich auf einen Schlag verändern sollte. Der Ort des Geschehens war meine Galerie, in der gerade eine Ausstellung des Bildhauers Franz Aschenbrenner eröffnet wurde, dessen Skulpturen sich trotz seines nicht einmal durchschnittlichen Talents sehr gut verkauften. Er hatte sich zu Beginn [...]
„Das werden Sie bereuen“, hatte die Kunstkritikerin mir ins Gesicht gezischt, nachdem sie sich an jenem verhängnisvollen Abend vom Boden aufgerappelt hatte.
Natürlich war mir in diesem Moment nicht bewusst, dass diese unbedachte Tat mein ganzes bisheriges Dasein buchstäblich auf einen Schlag verändern sollte. Der Ort des Geschehens war meine Galerie, in der gerade eine Ausstellung des Bildhauers Franz Aschenbrenner eröffnet wurde, dessen Skulpturen sich trotz seines nicht einmal durchschnittlichen Talents sehr gut verkauften. Er hatte sich zu Beginn seiner Karriere den Künstlernamen Elvis Esposito verliehen, der mir nur mit viel Mühe über die Lippen kam, bei unserer kleinstädtischen Kunstszene jedoch einen Hauch von Weltläufigkeit verströmte. Obschon die Objekte, fünfzehn aufblasbare Riesenkraken, in ihrer grellen Farbigkeit und Dominanz den Ausstellungsraum meiner Galerie vollkommen beherrschten, wurden sie von der Arroganz ihres Erschaffers noch überstrahlt. Denn die Kraken stellten allesamt verflossene Liebschaften von Esposito alias Aschenbrenner dar und trugen Titel, die zugleich verdeutlichten, wo er schon überall sein Unwesen getrieben hatte: von Silvana – Minsk und Pilar – Barcelona bis hin zu Debbie – Chicago.
Als meine Hand sich wie von selbst in Bewegung setzte, standen wir gerade vor einer Krake namens Gisèle – Paris, und ich versuchte, das Kunstwerk einem wichtigen Sammler nahe zu bringen, indem ich von seiner „brutalen Authentizität“ schwärmte, wofür ich mich im gleichen Augenblick selbst verachtete.
Auch dies mochte ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass ich keine drei Minuten später den Verlauf des Abends empfindlich störte, indem ich Elvis Esposito ein Glas Champagner, meiner Meinung nach übrigens eine vollkommen überschätzte Vernissagenbrause, ins Gesicht goss. Ich werde nie vergessen, wie er mich ungläubig ansah, während das Getränk im Kragen seines teuren Hemdes versickerte. Doch bevor sich seine Sprachlosigkeit in Wut verwandeln konnte, erhob sich wie ferngesteuert meine Hand, bewegte sich zielstrebig auf Esposito zu und stieß ihn mit einer erstaunlichen Heftigkeit in besagtes Machwerk.
Gisèle – Paris umschlang seinen verdutzten Erschaffer mit einem ergebenen Seufzen und spuckte ihn danach voller Ekel wieder aus. Dabei prallte er auf die vor ihm stehende Kunstkritikerin, riss sie mit sich zu Boden und verwickelte sich dort mit ihr zu einem absurden Knäuel.
Dabei hatte Esposito an jenem Abend, an dem die ganze städtische Prominenz in meiner Galerie versammelt war, keineswegs etwas besonders Unverschämtes von sich gegeben, was meine Tat in der Rückschau hätte entschuldigen können. Zumindest nichts, was über sein normales Maß an Unverschämtheiten hinausging, zu denen unter anderem der Titel der Ausstellung zählte: Alle Frauen, die mich abgöttisch liebten, ohne die geringste Chance zu haben, von mir zurückgeliebt zu werden. Abgesehen von der Überheblichkeit, die diesem Titel zu eigen war, hatte seine Länge dazu geführt, dass ich größere und somit teurere Einladungskarten drucken lassen musste.
Letztlich aber führte die Gesamtheit der Begegnungen mit den vielen egomanischen und aufgeblasenen Künstlern und Künstlerinnen in den über zwanzig Jahren meiner Galerietätigkeit dazu, dass es an jenem Abend nur noch einer Winzigkeit bedurfte, um das berühmte Fass zum Überlaufen zu bringen. Dabei will ich nicht bestreiten, dass es durchaus auch bescheidene und anständige Künstler geben mag. Ganz bestimmt. Nur bin ich ihnen einfach nicht begegnet.
Ohne jegliche Vorstellung davon, was mich erwarten würde, hatte ich die Galerie übernommen, als sich nach einem Praktikum eine günstige Gelegenheit ergab. Ich hätte schlichtweg nicht gewusst, was ich ansonsten mit einem Kunstgeschichtsstudium anfangen konnte, das ich allein nach meinem schulischen Lieblingsfach ausgewählt hatte.
Warum nur hatte ich nicht wie viele meiner Kommilitonen eine Tätigkeit in einem Museum angestrebt, wo man sich nur mit Kunst, weniger aber mit deren Erschaffern beschäftigen musste? Denn diese waren, wenn ihre Werke endlich den Weg ins Museum fanden, meist selbst schon Geschichte. Zumindest, wenn man als Kurator nicht den unverzeihlichen Fehler machte, sich auf Werke der Gegenwart zu spezialisieren.
Nein, ich hatte diese Galerie naiv in dem Glauben übernommen, begabte Künstler fördern zu können, indem ich sie in ihrer künstlerischen Entwicklung unterstützte. Ich hatte ja keine Ahnung, wie selbstbewusst die Schöpfer der von mir verehrten Werke bereits waren. Als ich es merkte, musste ich längst einen Schuldenberg an den vorherigen Besitzer der Galerie abzahlen und konnte nicht mehr zurück.
Ein Kunstgeschichtsstudium kann jeder absolvieren, ohne jemals einem einzigen lebenden Künstler begegnet zu sein. Was ungefähr das Gleiche ist, als würde ein Medizinstudent während seiner Ausbildung keinerlei Kontakt zu Patienten haben.
Es ist hinreichend bekannt, dass manche Künstler wie zum Beispiel Pablo Picasso charakterlich nicht gerade mit der Größe ihrer Werke mithalten können. Ich weiß, ich
bin ungerecht. Sicherlich habe ich mit meiner jahrelangen Duldsamkeit ebenfalls dazu beigetragen, dass meine Klientel ihre schlechtesten Eigenschaften ungehindert ausleben konnten. Vermutlich aus der Furcht heraus, dass mir ausgerechnet der eine zukünftige Star durch die Lappen gehen könnte, der am Ende berühmt werden würde. Ja, auch ich habe meine Seele für ein gutes Geschäft verkauft, das ist schon wahr.
Doch nicht nur die Künstler raubten mir den Verstand, sondern auch die Kunden meiner Galerie: Überraschend zu Wohlstand gekommene, kunstbeflissene Ehepaare, die ihren Kauf nach endlosen Beratungen lieber doch noch einmal überdenken wollten, weil das entsprechende Bild nicht zu ihrer Einrichtung passte. Einfältige Influencerinnen,
denen es auf der Vernissage nur um einen guten Fotobackground ging und die sofort wieder verschwanden, sobald sie sich den kostenlosen Champagner einverleibt hatten. Und auch die Sammler raubten mir den letzten Nerv, da sie meist versuchten, die Preise für ein Kunstwerk herunterzuhandeln, als ob sie sich auf einem orientalischen Basar befinden würden.
Und letzten Endes, auch das ist ein Teil der Wahrheit, ertrug ich mich selbst nicht mehr, wie ich auf den Vernissagen verkrampft lächelnd all diese Zumutungen ertrug, um die drei verhängnisvollen Ks des Galeriewesens – Künstler, Käufer und Kritiker – bei Laune zu halten, obwohl ich für die Kunst der Verstellung überhaupt nicht geeignet war.
Als ich nach einigen Jahren den Irrtum meiner Berufswahl bemerkte, war es bereits zu spät: Ich hatte zwar meine Schulden beglichen, dafür aber mittlerweile einen anspruchsvollen Sohn, Kosten für die Seniorenresidenz meiner Mutter und einen Kredit für ein Haus abzubezahlen.
Jenem Abend in der Vernissage waren ermüdende Diskussionen mit Esposito über die richtige Platzierung seiner Krakenskulpturen in meinen Ausstellungsräumen vorausgegangen. Jede einzelne Figur wurde vom Künstler höchstpersönlich unzählige Male um wenige Millimeter nach rechts oder links, vorn oder hinten verrückt, bis sie schließlich so „im Licht“ standen, dass ihre überwältigende Pracht perfekt zur Geltung kam. Meist hatten die Skulpturen nach diesem enervierenden Prozess wieder genau die Position inne, an der ich sie anfangs platziert hatte, was Esposito natürlich nicht zugeben wollte.
Ich bin mir sicher, dass keine der armen Frauen, die ihren Namen für die Kraken hergeben mussten, von ihm jemals so pfleglich behandelt worden ist wie ihre unsäglichen Abbilder.
Darüber hinaus hatte Esposito mich in der Vorbereitung seiner Ausstellung zu jeder Tages- und Nachtzeit angerufen, egal, ob ich gerade schlief, Geburtstag hatte oder mit der Familie unterm Weihnachtsbaum saß. Und das nur, um mir Bedeutungslosigkeiten wie ein seiner Meinung nach fehlendes Komma auf den Einladungskarten mitzuteilen. Ein einziges Mal unter hundertsiebenunddreißig Anrufen hatte ich es gewagt, nicht an mein Mobiltelefon zu gehen, da ich vollkommen erledigt in der Badewanne lag und das Handy absichtlich auf lautlos gestellt hatte.
Keine halbe Stunde später hatte Esposito persönlich an der Tür meines Hauses Sturm geläutet und war, von meinem überlisteten Sohn hereingebeten, bis in mein Badezimmer vorgedrungen. Dort teilte er mir vollkommen ungerührt auf dem Wannenrand mit, dass er die Vernissage am nächsten Tag lieber eine Stunde früher beginnen wolle, um noch die Abendmaschine nach New York zu erreichen, da ein „wirklich wichtiger“ Galerist ihn am nächsten Morgen kennenlernen wolle.
Also hatte ich, die nicht wirklich wichtige Galeristin, die Nacht und den ganzen nächsten Tag mit Unterstützung meiner Assistentin damit zugebracht, allen Eingeladenen mitzuteilen, dass die Vernissage vorgezogen wurde. Die rettende Idee dabei war, den Gästen weiszumachen, es würde vor dem eigentlichen Ausstellungsbeginn ein außergewöhnliches Pre-Opening geben, zu dem nur ein ganz exklusiver Kreis eingeladen sei, nämlich sie.
Und dann hatte Esposito sich auch noch bestätigt gefühlt, da mehr Besucher denn je in die Galerie geströmt waren, um seine lachhaften Frauenkraken bevorzugt sehen zu können. Keinem fiel auf, dass diese Exklusivität allein aufgrund der Masse an Galeriegästen eine gewisse Beliebigkeit hatte. Es genügte wohl, Menschen das Gefühl zu geben, sie wären aus irgendeinem nicht weiter benannten Grund Auserwählte, um sie vollkommen leichtgläubig werden zu lassen.
Derart in seiner Großartigkeit bestätigt, hatte mir Esposito, als ich gerade meine verlogene Eröffnungsrede beendet hatte, mit selbstsicherem Grinsen zugeflüstert: „Bei diesem Erfolg müssen wir noch mal über deine Provision reden, Darling.“
Allein dieses selbstzufriedene Grinsen einen Moment lang auszuschalten und seine verdutzte, mit Champagner begossene Mimik genießen zu können, war es wert, mich vor der ganzen Kunstszene der Stadt unmöglich zu machen.
Die mit zu Boden gerissene Kunstkritikerin war eine Art Kollateralschaden, den ich natürlich nicht beabsichtigt hatte. Doch aufgrund ihrer jahrelangen Schmähartikel,
die oft genug nichts anderem als der Unterstreichung ihrer eigenen kulturellen Überlegenheit dienten, bedauerte ich dies auch nicht weiter.
Ein paar Galeriebesucher, mit allen Wassern des Kunstkennertums gewaschen, witterten sofort eine gezielte Kunstaktion, eine Art Performance, für die sie eigens vorab eingeladen worden waren. Der eine oder andere hob schon die Hände, um Beifall zu klatschen, um zu zeigen, dass er oder sie den Kunstgriff schneller verstanden hatte. Alle anderen warteten, wie ich diese Performance letztlich auflösen würde.
Die Kunstkritikerin verstand jedoch sofort. Sie schob den vor Schreck wie gelähmten Künstlerballast von sich herunter, klopfte den Staub der Straßenschuhe von ihrem sicher sehr teuren Kleid und zischte mir besagte Worte zu, dass ich meine Tat schon noch bereuen werde.
Ich war selbst am meisten überrascht von meiner Kühnheit. Daher nickte ich nur, stellte mein leeres Glas nachdenklich auf einer Vitrine ab und blickte die Kunstkritikerin und den immer noch wie ein lahmes Insekt am Boden liegenden Künstler gleichgültig an.
Die Galeriegesellschaft stand wie erstarrt da und wartete auf eine Erklärung für das ungeheuerliche Geschehen. Doch die hatte ich ja selbst nicht.
Ich sah mich noch einmal im Raum um, diesem Ort, an dem ich zwanzig Jahre lang meinen Rücken und meine Seele verbogen hatte, räusperte mich und ging gemächlichen Schrittes zur Garderobe. Ohne Hast nahm ich meinen Mantel vom Haken, drückte meiner konsternierten Assistentin Konstanze den Schlüssel für die Galerie in die Hand und sagte: „Schließen Sie dann bitte ab, wenn das hier …“ – ich zeigte auf den sich gerade vom Boden aufrappelnden Esposito – „… vorbei ist.“
Dann nickte ich den Besuchern noch ein letztes Mal zu und verließ festen Schrittes die Galerie.
Und auf einmal wusste ich: Nein, bereuen würde ich meine Tat ganz sicher nicht.
Auf der Straße schlug mir der klamme Hauch eines Januarabends entgegen, der mir auf einen Schlag verdeutlichte, dass ich gerade in wenigen Sekunden meine über zwanzig Jahre lang mühsam aufgebaute Existenz vernichtet hatte.
Es war großartig! Schon lange hatte ich mich nicht mehr so wahrhaftig gefühlt. Dieser unüberlegte Stoß war die Erlösung aus all der Falschheit und Erstarrung in meiner Arbeit als Galeristin.
Ich stellte den Kragen meines Mantels hoch und lenkte meine Schritte rasch weg von der Galerie, bevor womöglich jemand auf die Idee kam, mich zurückzuholen. Oder bevor ich feststellen konnte, dass niemand mich zurückholen wollte. Ich wusste nicht, was schlimmer war.
Kein Mensch war um diese Uhrzeit draußen, wenn es nicht unbedingt notwendig war. Vor ein paar Tagen hatte es heftig geschneit, und noch immer lagen am Straßenrand die Reste der Schneeberge, die vom Freischippen der Gehsteige übrig geblieben waren. Fröstelnd ging ich in völlig ungeeignetem Schuhwerk über den eisverkrusteten Asphalt. Meine Atemluft formte kleine Eiswolken in der klirrenden Nachtkälte, und meine Beine fühlten sich in den dünnen Strümpfen schon bald steif an. Ich musste schnell ins Warme, wenn ich mich nicht erkälten wollte.
Doch wohin konnte ich in diesem gloriosen Moment gehen?
Es gab niemanden, mit dem ich meine Befreiung teilen wollte. Mein Ex-Mann, von dem ich immerhin den wohlklingenden Namen van den Broek übernommen hatte, lebte längst wieder in Groningen und hatte mit seiner neuen Frau eine neue Familie mit einem neuen Kind gegründet.
Unser Sohn, der aus der Verbindung mit ihm entstanden war, hatte vor einiger Zeit verkündet, dass er nun endlich seinen künftigen Traumjob gefunden habe, und war unter großem Getöse zu einem Studium der Angewandten Freizeitwissenschaften in den Norden gezogen. Ich hatte gleich geahnt, dass die Studieninhalte nicht mit seiner Wunschvorstellung vom lebenslangen Nichtstun übereinstimmen würden, aber ich war froh gewesen, dass er überhaupt mit irgendetwas anfing, nachdem er monatelang nur auf der Wohnzimmercouch herumgelegen und erklärt hatte, dass er sich Zeit lassen wolle, das wirklich Richtige zu finden, und ich mich doch auch mal entspannen solle. Meine ketzerische Frage, woher dann das Geld für die Unmengen an Pizza und Cola kommen würde, die er verzehrte, hatte er nur mit einem gleichgültigen Schulterzucken beantwortet.
Meine wenigen Freundinnen würden ohnehin nicht verstehen, was mich zu diesem schonungslosen Schritt bewogen hatte, beneideten sie mich doch seit Jahren unbeirrt um meine scheinbar so großartige Arbeit, ganz gleich, welche Horrorgeschichten ich ihnen darüber erzählte.
In mein großes, kaltes, dunkles und mir jetzt sehr leer erscheinendes Haus zurückzukehren, war ebenfalls keine Option. Ich befürchtete, dass mein Triumphgefühl sich dort sehr schnell in nagende Zweifel verwandeln würde. Dies galt es unter allen Umständen zu verhindern. Ich wollte meinen Sieg möglichst lange auskosten. Die Reue würde schon noch früh genug kommen, wenn ich am nächsten Morgen alles im kalten Licht der Vernunft betrachtete.
Allerdings konnte ich jetzt keinesfalls in die mir bekannten Bars und Restaurants einkehren, da die konkrete Gefahr bestand, dort jemanden zu treffen. Womöglich würden sogar Galeriebesucher ihren außergewöhnlichen Abend in den entsprechenden Lokalen ausklingen lassen, um noch ein wenig über die offenbar verrückt gewordene Galeristin herzuziehen. Ich musste also unbedingt an einen mir vollkommen unbekannten Ort flüchten.
Die Straßen waren immer noch menschenleer und glänzten. Nur die Laternen spiegelten sich schief in den kleinen halb gefrorenen Pfützen. Ich fror erbärmlich, obwohl ich rasche Schritte machte. Bei der Wahl meiner Kleidung hatte ich nicht voraussehen können, dass sie der Flucht durch eine eisige Winternacht würde standhalten müssen.
Also enterte ich einfach das nächstbeste Lokal, ohne mir genauer anzusehen, was für eine Art von Kneipe es war.
Alle Gespräche verstummten, als ich den schummrigen Gastraum betrat. Drei Augenpaare musterten mich feindlich. Die dazugehörigen Gestalten hafteten derart unlöslich auf ihren Barhockern, dass sie bei einer hier stattfindenden Inventur zweifellos mitgezählt werden würden.
Der Geruch von abgestandenem Zigarettenrauch, Bier und seltsamerweise auch Schuhcreme kroch mir in die Nase. An der Wand hinter der Theke war ein altes Steuerrad aus Holz angebracht, während die rauchgeschwärzte Holzdecke wohl seit Menschengedenken ein verstaubtes Fischernetz zierte, in dem traurige Plastikfische und Seesterne gefangen waren. Das nur spärlich erleuchtete Lokal hätte eine Hafenkneipe sein können, nur war hier weit und breit kein Meer. Wahrscheinlich stammte der Wirt, der missmutig vom Zapfhahn zu mir herblickte, aus einer Hafenstadt und hatte sich hier sein persönliches Stück Heimat erschaffen. Die drei Gestalten an der Theke wirkten in dieser Umgebung wie verlorene Seemänner, deren Schiff längst ohne sie weitergefahren war.
So etwas wie mich, eine komplett in teures Schwarz gekleidete Endvierzigerin mit dunkel umrandeter, das halbe Gesicht bedeckender Künstlerbrille, hatte dieser Ort zweifellos noch nie gesehen. Entsprechend groß war die Bereitschaft, das störende Subjekt möglichst schnell wieder auszuspucken. Ich war mir noch nie so fehl am Platz vorgekommen.
Das Beste wäre nun gewesen, auf dem Absatz kehrtzumachen, um das Lokal schnellstmöglich zu verlassen. Doch hier drinnen war es wenigstens warm, und die Aussicht, wieder in den frostigen Winter hinauszutreten, war nicht gerade verlockend.
Also nahm ich meinen ganzen Mut zusammen, atmete tief durch, durchschritt das Lokal mit festen Schritten und stellte mich wie selbstverständlich neben die drei an die Theke. Der Wirt, ein beleibter Mann Mitte sechzig mit dünn gewordenem Pferdeschwanz und einer zu eng sitzenden Lederweste, sah mich wenig begeistert an.
Ich war ein Fremdkörper. Also musste ich jetzt schnell etwas bestellen, um diesen Eindruck zu verwischen.
»Ein Moët & Chandon, bitte«, sagte ich.
Die Köpfe meiner ungewollten Thekennachbarn fuhren herum. Geballte Ablehnung schlug mir entgegen. Warum ich ausgerechnet an diesem Ort die verhasste Galeristenbrause bestellte, war mir selbst unerklärlich. Nicht, dass ich körperlich von den schwächlichen Gestalten an der Theke etwas zu befürchten hatte. Doch auch mit emotionaler Ablehnung konnte ich schon immer schlecht umgehen.
Der Wirt blickte dumpf vor sich hin und überhörte meine Bestellung einfach.
Mir schoss die Schamröte ins Gesicht. Es war vollkommen klar, dass es hier allenfalls einen billigen Wein für eine Schorle geben würde. Rotwein, wie ich ihn früher selbst aus Kanistern an einem einsamen Strand in Südfrankreich getrunken hatte, damals, als ich die Welt hatte umkrempeln wollen, dabei aber glücklich gewesen war. Heute trank ich Moët & Chandon und hasste mein Leben.
Ich wollte mir an diesem Abend keinesfalls weiteren Ärger einhandeln. Das Einzige, was ich wollte, war, hier im Stillen meine Befreiung von anderen Champagnertrinkern zu feiern. Prompt fing ich an zu stottern wie ein Teenager.
„Also, ich … äh … Ein Bier … und einen Schnaps, bitte.“
Aus etwas weniger schmalen Lidschlitzen musterte der Wirt mich nun prüfend, schien mir die plötzliche Wandlung jedoch abzunehmen, nickte also kaum merklich, ging gemächlich zum Zapfhahn und begann, in aller Ruhe ein Bierglas zu befüllen. Ich warf einen bangen Seitenblick auf die drei Stammgäste und stellte fest, dass ihre Augen mich fast noch feindlicher musterten als zuvor. Alle drei waren bemerkenswert blass, was sicher nicht nur dem häufigen Aufenthalt in geschlossenen Räumen geschuldet war. Ihre abgetragene Kleidung ließ erahnen, dass das Leben es mit ihnen nicht immer gut gemeint hatte. Sie hatten sicher ganz andere Probleme, als gerade die städtische Kunstszene verprellt zu haben. Ich schämte mich nun fast noch mehr.
„Und drei Schnäpse für die Herren“, fügte ich hastig hinzu.
Das verschaffte mir immerhin ein Lächeln aus einer schlecht gepflegten Zahnreihe, ein anerkennendes, knappes Nicken und einen zumindest neutralen Gesichtsausdruck.
Ich verspürte ein leises Aufatmen neben mir. Diese Fremde war doch keine von denen, die sich für etwas Besonderes hielt. Und wenn, dann war sie wenigstens spendabel. Immerhin ein Anfang.
Der Wirt, plötzlich wieder ungeahnt agil, wischte sich beflissen die Hände an der Weste ab, die an dieser Stelle schon ziemlich abgenutzt aussah, ließ das Bier einen Augenblick lang stehen und befüllte vier Schnapsgläser bis knapp an den Rand. Diese schob er mit einem jahrelang eingeübten Schwung über die Theke, wo sie mit erstaunlicher Bereitwilligkeit in Empfang genommen wurden. Zum ersten Mal an diesem Abend war so etwas wie Leben in die Bewohner dieser Trinkerhöhle gekommen.
Ich nahm mein Schnapsglas ebenfalls entgegen, prostete den blassen Seemännern beflissen zu, doch sie hatten schneller ausgetrunken, als ich das Glas erheben konnte, und musterten mich neugierig.
Mit einer entschlossenen Armbewegung leerte ich das Glas in einem Zug und stellte es danach hart auf der Theke ab. Das Zeug schmeckte wie der Schwarzbrand eines sibirischen Bauern, der längst von seinem eigenen Erzeugnis erblindet ist und trotzdem stetig weitertrinkt.
Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, blickte betont gleichmütig auf die Gläserreihe in der Vitrine hinter der Theke und schloss die Lider. Dennoch konnte ich nicht verhindern, dass mir die Tränen in die Augen schossen. Die drei bemerkten es natürlich, stießen sich gegenseitig an und begannen schadenfroh zu grunzen.
„Möjeh Eh Schang … Schang …“ Die Zahnlücke bekam vor Lachen das Wort nicht zu Ende.
Vor einer halben Stunde war ich noch die hochgeschätzte Inhaberin einer angesehenen Galerie für Gegenwartskunst gewesen, jetzt machten sich drei rettungslose Trinker ganz unverhohlen über mich lustig. Das war ein rasanter Abstieg, der aber alles in allem recht komisch war. Ich musste selbst lachen, so lange, bis meine Tränen nichts mehr mit der Schärfe des Schnapses zu tun hatten.
Durch den karg eingerichteten Gastraum schwang eine leise Sinfonie der alkoholisierten Eintracht. Selbst der Wirt rang sich ein kleines Grinsen ab. Ich wollte ihm ebenfalls einen Schnaps spendieren, was er aber vehement ausschlug. Er kannte offenbar die Qualität seiner Ware.
Nach vier weiteren Runden waren Locke, Adam, Francesco und ich nicht nur per Du, sondern im weiteren Verlauf des Abends auch so etwas wie schicksalhaft zusammengeführte Kameraden der schweren See.
Es stellte sich heraus, dass die drei tatsächlich früher einmal Matrosen gewesen waren und viele abenteuerliche Geschichten zu erzählen hatten. Und alle drei träumten davon, noch einmal auf große Fahrt zu gehen. Aber das erfuhr ich erst sehr viel später.
Eine ganze Brigade arbeitswütiger Zwerge war im Bergwerk meines Gehirns mit Hacken und Eisen zugange und verrichtete zermürbende Abbauarbeiten. Was konnte ich ihnen anbieten, um sie davon zu überzeugen, ihre Tätigkeit unverzüglich einzustellen? Ich stöhnte auf, ohne mich zu bewegen, da auch die kleinste Positionsänderung das ganze System ins Wanken gebracht hätte.
Was war am Vorabend passiert? Schlaglichtartig blitzten Erinnerungen durch mein Gehirn. Vier volle Schnapsgläser, ich schwankend auf dem Nachhauseweg, während ich mich immer wieder an Laternen festklammerte … Und war nicht etwas Einschneidendes bei dieser Vernissage geschehen?
Schlagartig wurde ich wach, hob die schweren Lider und ließ sie sofort wieder zufallen, denn das grelle Licht der Morgensonne gleißte wie eine Signalrakete durch die Schlitze der Jalousie. Meine Finger krallten sich Halt suchend in die Matratze. SOS. Ich war zwar nicht in Seenot, aber es war doch eindeutig ein Notfall. Sobald ich versuchte, mich aufzurichten, schaukelte mein Bett wie eine Jolle auf schwerer See. Ich beschloss, vollkommen ruhig liegen zu bleiben. Leider konnte ich nicht verhindern, dass sich die Erinnerungen an den gestrigen Abend allmählich präzisierten.
Hatte ich tatsächlich meinem nervigsten, aber eben auch erfolgreichsten Künstler ein Glas Champagner ins Gesicht gegossen und ihn danach in sein Kunstwerk geschubst?
War ich aus meiner eigenen Galerie geflüchtet wie eine Diebin und hatte die entgeisterte Kulturprominenz einfach stehen lassen?
Und war ich anschließend in eine miese Spelunke eingekehrt und hatte drei wildfremden Männern diverse Lokalrunden spendiert?
Ja, ja und nochmals ja.
Ich musste unbedingt herausfinden, was für eine Resonanz mein Auftritt in der Öffentlichkeit hervorgerufen hatte und wie der weitere Abend in der Galerie ohne mich verlaufen war. Dafür musste ich allerdings zuerst das Bett verlassen, unten im Erdgeschoss die Zeitung aus dem Briefkasten ziehen und schließlich das Telefon finden, um meine Assistentin anzurufen.
Nachdem drei Versuche, direkt in die Vertikale zu gelangen, gescheitert waren, bewältigte ich diese erste Hürde, indem ich mich zunächst aus dem Bett auf den Boden fallen ließ, der zum Glück von einem hochflorigen Teppich bedeckt war. Dort blieb ich eine Weile liegen und studierte das Teppichmuster, um das nicht enden wollende Kreisen im Kopf in den Griff zu bekommen, woraufhin ich schließlich auf allen vieren in Richtung Badezimmer kroch.
Nachdem ich mich meines Mageninhalts entledigt hatte, kletterte ich völlig entkräftet in die Duschkabine, schaffte es, mich mithilfe eines vorausschauend für das Alter angebrachten Haltegriffs einigermaßen aufzurichten, und stellte die Armatur todesmutig auf kalt.
Ich war nicht darauf vorbereitet, was für eine Wirkung das eisige Wasser auf meinen alkoholgeschwächten Körper haben würde. Einer Ohnmacht nahe klammerte ich mich an der Duschstange fest und nahm mir vor, zumindest so lange durchzuhalten, bis ich mich im Kopf ein wenig klarer fühlte.
Fünf Sekunden später sah ich ein, dass dies in meiner derzeitigen Verfassung ein zu hoch gestecktes Ziel war, und stellte den Wasserstrahl ab. Zitternd kletterte ich aus der Duschkabine und langte nach einem Handtuch für die Haare und meinem Frotteebademantel, der mir zumindest ein Gefühl des Aufgehobenseins vermittelte.
So traute ich mir den Weg nach unten, wo mit der Kaffeemaschine eine weitere Stärkungsmaßnahme auf mich wartete, schon eher zu.
Die Treppe ins Erdgeschoss meines Hauses war gepflastert mit Kleidungsstücken, derer ich mich wohl in der Nacht Stück für Stück entledigt hatte. Leider war es dem Architekten beim Bau des Hauses gelungen, mich zu überreden, kein Geländer an der schwebenden Holztreppe anzubringen,
da dies den optischen Gesamteindruck empfindlich stören würde.
Nun störte es den optischen Gesamteindruck jedoch weit empfindlicher, als ich aufgrund des fehlenden Geländers nur nach unten kam, indem ich mich hinsetzte, um die Treppe Stufe für Stufe auf dem Hintern hinunterzurutschen. Zum Glück musste ich mir über die optische Wirkung keinerlei Gedanken machen, da außer mir niemand da war. Ein Vorteil des Alleinlebens ist, dass einen niemand bei derart peinlichen Handlungen beobachten kann.
Nach einer großen Tasse schwarzen Kaffees fühlte ich mich stark genug, mich nach draußen zum Briefkasten zu begeben. In meinem desolaten Zustand kam ich seltsamerweise überhaupt nicht auf die Idee, auf meinem Handy nachzusehen, was in der Onlineausgabe der Zeitung stand, sondern war offenbar über Nacht technisch auf den Stand der Neunzigerjahre zurückkatapultiert worden.
Unglücklicherweise hatten wir es einmal für eine gute Idee gehalten, die Zeitungsbox nicht am Haus anzubringen, sondern vorne am Gartentor, um gleich morgens eine kleine Frischlufteinheit genießen zu können. Der Gang zum Briefkasten verschaffte mir einen derart starken Restalkoholeinschuss, dass ich mich zunächst Rettung suchend an das hässliche schmiedeeiserne Tor klammern musste, auf das mein Ex-Mann beim Hausbau bestanden und wofür er sich zusätzlich verschuldet hatte. Natürlich kam genau in diesem Moment Frau Dr. Klingenberg zu ihrer morgendlichen Joggingrunde an meinem Haus vorbei, eine Ärztin für Ästhetische Zahnheilkunde, die mit ihrer Familie auf der anderen Straßenseite wohnte und eine der niederträchtigsten Personen war, die diese Stadt zu bieten hatte.
„Ach, Frau van den Broek! Sind Sie gar nicht bei der Arbeit heute?“
Frau Dr. Klingenberg vermutete aufgrund meines Nachnamens, dass ich adliger Herkunft war, und versuchte daher hartnäckig, mich in den illustren Kreis ihrer Bridgedamen aufzunehmen. Es wurde wirklich Zeit, dass ich wieder meinen eigenen Nachnamen annahm.
Die Nachbarin war auf der Stelle joggend stehen geblieben, präsentierte mir ihre gebleichte Zahnreihe und verlangte eine Erklärung für meine morgendliche Anwesenheit.
Für gewöhnlich hätte ich nun geantwortet, dass ich mich etwas unwohl fühle und daher erst später zur Galerie fahren würde, doch für irgendetwas musste der gestrige Abend ja gut gewesen sein. Außerdem würde sie es vermutlich ohnehin bald aus der Zeitung erfahren.
„Nein, ich habe gestern meinen erfolgreichsten, aber auch nervigsten Künstler mit Champagner übergossen, ihn dann in seine grässliche und zutiefst frauenfeindliche Krakenkunst gestoßen und mich danach bis zur Besinnungslosigkeit betrunken.“
Ich prüfte die Wirkung meiner Worte in ihrem Gesicht, doch Frau Dr. Klingenberg lächelte mich vollkommen unbeirrt an. „Ach, Sie Arme, das tut mir leid. Dann gute Besserung.“ Während sie weiterjoggte, winkte sie mir fröhlich zu und rief: „Sie müssen unbedingt mal in unsere Bridgerunde kommen, Frau van den Broek!“
Ich sah ihr verdutzt nach und bewunderte ihre Fähigkeit, unliebsame Wahrheiten einfach an sich abperlen zu lassen. Umso mehr reizte es mich, auszuprobieren, wie stabil der Wall ihrer Wirklichkeitsverleugnung an diesem Morgen tatsächlich war.
„Übrigens“, rief ich ihr nach, „was ich Ihnen schon längst mal sagen wollte: Mein Nachname ist überhaupt nicht adlig! Das van den verweist einzig und allein auf eine geografische Herkunft. Ich heiße also lediglich Frau vom Sumpf. Blöd, was?“
Meine Nachbarin bremste so abrupt, dass sie beinahe über ihre eigenen Joggingschuhe gestolpert wäre. Eine Zeit lang blieb sie wie angewurzelt stehen und dachte vermutlich darüber nach, was sie mit dieser neuen, bedauerlichen Information anfangen sollte. Ganz offensichtlich hatten meine Worte dieses Mal ihren Verdrängungswall überwunden, doch sie hatte noch nicht entschieden, wie sie angemessen darauf reagieren sollte. Würde sie mich aus dem illustren Kreis ihrer potenziellen Bridgepartnerinnen entfernen wie einen in Ungnade gefallenen Verwandten, den man fortan totschweigt?
Wie in Zeitlupe drehte Frau Dr. Klingenberg ihren Kopf zu mir, musterte mich kühl, zuckte leicht mit dem rechten Mundwinkel und zischte: „Pink steht Ihnen gar nicht. Es macht Sie blass.“
Dann joggte sie überambitioniert zu ihrer Hofeinfahrt und verschwand hinter einem ähnlich imposant-geschmacklosen Eingangstor.
„Danke, da haben Sie völlig recht“, rief ich ihr nach. „Toll, dass es jemand mal ausspricht.“ Aber ich war nicht sicher, ob sie es noch gehört hatte. Jedenfalls würde sie mich in Zukunft in Ruhe lassen.
Langsam begann es mir Spaß zu machen, auf nichts mehr Rücksicht zu nehmen und mit allem Unliebsamen in meinem Leben aufzuräumen. Ich sah an mir herunter. Der pinke Bademantel war ein Geschenk meines Mannes gewesen, der sich nie die Mühe gemacht hatte, darüber nachzudenken, was mir gefallen könnte oder zumindest einigermaßen gut an mir aussah. Und Pink stand mir definitiv nicht.
Stattdessen hatte Bart versucht, mich zu der Frau zu machen, die in einen pinkfarbenen Bademantel mit Rüschenkante passte. Irgendwann hatte er jedoch einsehen müssen, dass das ein vergebliches Unterfangen war, und sich lieber gleich das perfekte Rüschenkanten-Model gesucht. Es wurde Zeit, auch diese Altlast auf die Deponie der endgelagerten Irrtümer zu bringen.
Die Straße war vollkommen leer. Aber bestimmt beobachtete Frau Dr. Klingenberg mich durch das Küchenfenster. Mit diebischer Freude streifte ich den scheußlichen Bademantel ab, stopfte ihn in die Mülltonne, nahm noch rasch die Zeitung aus dem Briefkasten, winkte dem Küchenfenster meiner Nachbarin zu und ging mit nichts weniger als meiner wiedergewonnenen Würde wieder ins Haus zurück.
Drinnen schlüpfte ich in Hochstimmung in einen gelben Arbeitsoverall, den ich mir für Gartenarbeiten gekauft, aber nie benutzt hatte und der seitdem geduldig wartend im Flur hing. Jetzt schien er die passende Uniform für meine weiteren Kamikazetaten zu sein.
Dann bereitete ich mir in der überdimensionierten Küche, die ebenfalls dem großspurigen Charakter meines Ex-Mannes geschuldet und mit allerlei teurem, aber unsinnigem Schnickschnack ausgestattet war, einen weiteren Kaffee zu. Auch mein körperliches Befinden hatte sich durch die Reduktion meiner Altlasten erheblich gesteigert. Ich fühlte mich nun sogar stark genug, mich dem Artikel der Kunstkritikerin zu stellen.
Hastig arbeitete ich mich durch die Zeitung zum dünnen Kulturteil vor.
GALERISTIN ZERSTÖRT IHR LEBENSWERK
lautete die theatralische Überschrift. Ich atmete tief durch, nahm einen Schluck von meinem Kaffee und las weiter.
Ein Eklat der besonderen Art ereignete sich gestern Abend in der Galerie von Vera van den Broek, als der bis nach New York in der Kunstwelt hoch angesehene Künstler Elvis Esposito mit einem Glas Champagner übergossen und in eines seiner feinnervigen Kunstwerke gestoßen wurde, das dabei erheblichen Schaden nahm. Und dies von niemand Geringerem als der Galeristin selbst! Was Laien zunächst wie eine gezielte Kunstaktion erscheinen mochte, enttarnten Eingeweihte sofort als massiven Affront gegen den renommierten Künstler. Über die Gründe dazu schwieg die Galeristin sich am Abend aus. Mehr dazu heute in der Onlineausgabe.
Ich legte die Zeitung wieder zurück auf die Küchentheke und schnaubte. Diese blöde Ziege! Noch bei der letzten Ausstellung hatte sie Esposito als „stark überschätzten Schwimmtierhersteller“ deklassiert, und jetzt das!
Nüchtern betrachtet konnte ich der kurzen Notiz jedoch vier wichtige Informationen entnehmen.
Erstens: Die Verfasserin alias Kunstkritikerin war wütend. Sehr, sehr wütend.
Zweitens: Sie hatte sich sofort mit Esposito verbündet und den restlichen Abend mit ihm über mich gelästert (bis seine Abendmaschine nach New York ging).
Drittens: Mein Handy war voller Anrufe, die ich aber nicht gehört hatte, weil ich es noch vor der Vernissage ausgestellt hatte.
Viertens: Die Krake war kaputt. Das würde teuer werden. Ziemlich teuer.
Ich sah nach draußen in den noch von Bart entworfenen japanischen Garten. Der Landschaftsarchitekt hatte damals behauptet, man komme allein durch das Betrachten der harmonisch angelegten Landschaft mit Pflanzen, Steinen und einem Seerosenteich zur Ruhe und finde sein inneres Gleichgewicht. Ich aber hasste diesen Garten, und zwar nicht erst, seitdem klar war, dass der Auftraggeber noch vor Fertigstellung des Werks mit seiner Golflehrerin durchgebrannt war.
Vermutlich hatten die meisten Leute, die über das Geld verfügten, sich solch einen teuren Garten gestalten zu lassen, ohnehin nicht die Zeit, ihn danach auch zu genießen. Stattdessen musste man jemanden bezahlen, der den Garten pflegte, da man selbst dafür keine Energie mehr übrig hatte. Innere Ausgeglichenheit gab es also nur für den Gärtner, der womöglich die entspannende Wirkung genießen konnte, während er die Büsche stutzte.
Ich stand auf und kramte aus dem Medikamentenschrank eine Brausetablette gegen die Kopfschmerzen hervor und löste sie in einem Glas Wasser auf. Dann machte ich mich auf die Suche nach meinem Handy, entdeckte es in meiner auf der Treppe abgelegten Jacke, atmete tief durch und stellte es an.
Auf der Mailbox waren sieben Nachrichten von meiner Assistentin. Dreiundzwanzig von Esposito, die letzte vor einer Viertelstunde. Eine von meinem Sohn, vier von der Kunstkritikerin und ein paar von unbekannten Rufnummern. Die Versuchung war groß, sie mir alle der Reihe nach anzuhören, doch eine innere Stimme sagte mir, dass es für meine seelische Gesundheit besser war, dies nicht zu tun.
Aber wenigstens wollte ich wissen, wie mein Sohn die Nachricht von meiner Existenzvernichtung aufgenommen hatte, die offenbar schon bis zu ihm in den Norden vorgedrungen war.
„Hi Mom! Kannst du mir noch was überweisen? Ich bin total klamm diesen Monat, du weißt doch, die Mieterhöhung, und die Mensa hier geht gar nicht, also, danke, du bist ein Schatz! Ciao!“
In der Welt meines Sohnes existierte die Möglichkeit, dass ich Nein sagte, anscheinend genauso wenig wie die, dass er sich selbst durch echte Arbeit etwas dazuverdiente. Die Mieterhöhung für sein WG-Zimmer war, das hatte er mir schon mehrfach vorgejammert, ein angesichts seiner üppigen Zuwendungen lächerlicher Betrag von zwanzig Euro im Monat.
Anscheinend wusste er noch nichts von meiner Existenzvernichtung. Ich freute mich jetzt schon auf sein Gesicht, wenn ich ihm davon erzählte. Denn zu einem gewissen Teil würde es auch seine eigene sein, zumindest die Vernichtung seiner Existenz in der überwiegend liegenden Erscheinungsform.
Ohne mir ihre Nachrichten vorher anzuhören, wählte ich die Nummer meiner Assistentin Konstanze.
„Frau van den Broek! Wie geht es Ihnen?“ Der geheuchelt therapeutische Ton, den Konstanze anschlug, deutete darauf hin, dass sie eine nervlich bedingte Ursache für mein unerklärliches vorabendliches Verhalten vermutete.
„Danke, es geht mir ausgezeichnet.“
„Wirklich? Kann ich irgendetwas für Sie tun?“ Sie glaubte mir offenbar nicht.
„Ja, Sie können aufhören, mich wie eine Irre zu behandeln.“
Sicherlich bemühte sie sich, betroffen auszusehen, wie immer, wenn sie eine innere Erschütterung vortäuschen wollte. In Wahrheit war Konstanze eine verwöhnte und erstaunlich gefühlsarme Oberschichtgöre. Ich hatte sie in der Hoffnung eingestellt, mir neue Kundenkreise erschließen zu können, was eine teuer erkaufte Fehlentscheidung gewesen war, da wir überhaupt nicht miteinander harmonierten.
„Gut“, schaltete sie sofort um. „Herr Esposito hat schon zigmal angerufen, er verlangt eine Erklärung. Und Schadensersatz!“
„Sagen Sie ihm, er soll mir eine Rechnung schicken.“
„Okay – oder wollen Sie nicht lieber erst mit ihm sprechen?“
Ich dachte kurz nach. Da offenbar alle eine nervliche Überlastung als Grund für mein Verhalten vermuteten, wäre mir der Weg zurück in die Galerie weiter offen, wenn ich gewisse, sicherlich sehr schmerzhafte Zugeständnisse machen würde.
„Nein, Sie machen das schon“, wiegelte ich ab. „Übrigens haben Sie vollkommen recht. Es geht mir in der Tat nicht gut, weshalb ich eine Auszeit brauche und mich für ein Jahr aus der Galerie zurückziehen werde. In dieser Zeit werde ich Ihnen die Leitung anvertrauen.“
Die Entscheidung hatte ich erst in diesem Moment getroffen und war selbst überrascht, dass sie sich genau richtig anfühlte.
Konstanze schnappte nach Luft. Sie wollte sich offenbar nicht allzu sehr anmerken lassen, wie sehr sie sich über ihren Karrieresprung freute. Ob es richtig war, ihr so viel Macht zu überlassen, war mir in diesem Moment reichlich egal. Letzten Endes gehörte die Galerie immer noch mir.
Nach einiger Zeit fand meine Assistentin ihre Sprache wieder. „Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das freut mich. Ich habe schon lange … also, ich werde Sie nicht enttäuschen.“
„Davon bin ich überzeugt“, antwortete ich zweideutig. „Ich komme dann morgen in die Galerie, und wir besprechen die Modalitäten. Den heutigen Tag brauche ich noch für meine Rekonvaleszenz.“
„Aber natürlich! Ruhen Sie sich schön aus. Ich regle alles. Wie gehen wir mit der Presse um?“ Konstanze überschlug sich fast vor lauter Eifer.
„Die lassen wir erst mal zappeln. Inzwischen verfasse ich eine schriftliche Erklärung. Das ist alles. Nichts ist uninteressanter als die Wahrheit.“
„Da haben Sie natürlich völlig recht, Frau van den Broek! Dann bis morgen.“
Wir verabschiedeten uns und beendeten das Gespräch. Warum war mir nie aufgefallen, was für eine hinterhältige Schlange diese Person war?
Doch jetzt musste ich mich erst einmal von den Ereignissen des Abends und vor allem der Nacht erholen. Mit letzter Kraft, aber frohen Gemüts schleppte ich mich wieder die Treppe hinauf, vorbei an meiner Stück für Stück abgestreiften Galeristenhaut, und ließ mich, oben angekommen, wieder zurück ins Bett fallen.


















DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.