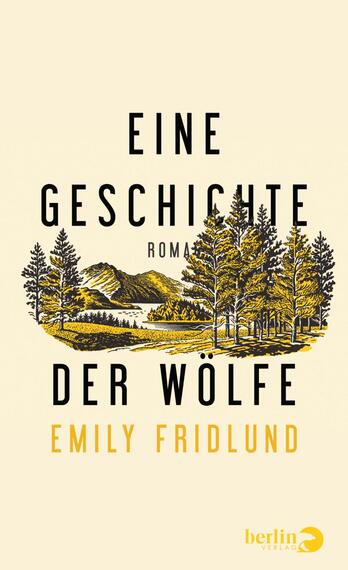
Eine Geschichte der Wölfe - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Eine außergewöhnlich schöne Sprache zeichnet diesen Roman aus, was sicher auch an der deutschen Übersetzung liegt. Hier gibt es keine abgegriffenen Bilder und Klischees. Ein feines, ruhiges, manchmal etwas unheimliches Buch.“
WDR 4Beschreibung
In den dunklen Wäldern von Minnesota wächst Linda in den kläglichen Überresten einer Kommune auf. Ihre Eltern sind über das Scheitern ihrer Hippie-Ideale zu Eigenbrötlern geworden, in der High-School kommt sie sich vor wie eine Außerirdische. In ihrer Isolation fühlt sich Linda wie magisch hingezogen zu ihrer Klassenkameradin Lily und zu ihrem Geschichtslehrer, Mr. Grierson. Es ist ein Schock, als der wegen des Besitzes von Kinderpornographie verhaftet wird und dann auch noch Lily von der Schule verschwindet. Linda hat niemand, mit dem sie über all das reden könnte. Da zieht eine Familie neu…
In den dunklen Wäldern von Minnesota wächst Linda in den kläglichen Überresten einer Kommune auf. Ihre Eltern sind über das Scheitern ihrer Hippie-Ideale zu Eigenbrötlern geworden, in der High-School kommt sie sich vor wie eine Außerirdische. In ihrer Isolation fühlt sich Linda wie magisch hingezogen zu ihrer Klassenkameradin Lily und zu ihrem Geschichtslehrer, Mr. Grierson. Es ist ein Schock, als der wegen des Besitzes von Kinderpornographie verhaftet wird und dann auch noch Lily von der Schule verschwindet. Linda hat niemand, mit dem sie über all das reden könnte. Da zieht eine Familie neu an den See. Alles bei ihnen scheint Linda gut und schön. Sie wird die Babysitterin des kleinen Paul und sehnt sich danach zu dieser heilen Familie zu gehören. Doch als Paul schwer krank wird, bleiben seine Eltern seltsam inaktiv. Soll Linda trotzdem einen Arzt rufen und damit das gute Verhältnis zu ihren „neuen Freunden“ riskieren? Eine vielleicht unmögliche Entscheidung für eine Vierzehnjährige, die ihr ganzes weiteres Leben beeinflussen wird....
Über Emily Fridlund
Aus „Eine Geschichte der Wölfe“
1
Es ist nicht so, dass ich nie an Paul denken würde. Manchmal kommt er zu mir, bevor ich ganz wach bin, wobei ich mich fast nie erinnern kann, was er gesagt hat oder was ich mit ihm gemacht oder auch nicht gemacht habe. In meiner Erinnerung plumpst mir der Junge einfach auf den Schoß. Bumm. Dadurch weiß ich, dass er es ist: ohne besonderes Interesse an mir, ohne jedes Zögern. Es ist ein Spätnachmittag wie jeder andere, wir sitzen im Nature Center, und sein Körper bewegt sich automatisch auf meinen zu – nicht aus Liebe oder Respekt, sondern einfach nur weil er noch [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Langsamkeit, die sich lohnt.“
Stern„Madeline gewinnt schließlich für ihre Arbeit einen Preis. Den hat auch dieses Buch verdient. Mindestens. Denn Emily Fridlund ist ein Romandebüt gelungen, dessen poetische Sprache bezaubert – und dessen Handlung nachhaltig verstört.“
Hamburger Morgenpost„Der vorzügliche Debütroman der amerikanischen Autorin Emily Fridlund ist ein Bildungsroman, lebhaft und spannend geschrieben.“
Hamburger Abendblatt„Emily Fridlunds Geschichte nimmt einen von Anfang an gefangen, und weil alle Figuren sehr ambivalent agieren, fühlt man sich ihnen nah und fremd zugleich. Tolles Buch.“
Flow„Mit lyrischer Prosa seziert Emily Fridlund komplex das Wesen des Bösen.“
Dresdner Morgenpost„Emily Fridlund schreibt so schroff und schön über die Düsternis in uns, dass man die Bilder nicht aus dem Kopf bekommt.“
Brigitte„Fridlunds Schreiben ist ein Öffnen der Augen durch Sprache, ein Umherschauen und Wahrnehmen, hier ist nichts performativ, sondern könnte immer auch anders sein. Stephan Johann Kleiner hat das atmosphärisch getreu und sprachmächtig übersetzt.“
Berliner Zeitung„Starkes Debüt.“
Augsburger Allgemeine„Dass Fridlund in Minnesota geboren und aufgewachsen ist und noch immer in jenem nördlichen Bundesstaat nahe Kanada lebt, ist ihrem überaus lesenswerten weil zudem vielschichtigen Erstling deutlich anzumerken, beschreibt sie nicht nur in einer wundervollen wortgewandten Prosa die dortige herbe, indes eindrucksvolle Natur. Ihr gelingt es ebenfalls, die besondere Atmosphäre dieser Landschaft und die Herausforderungen an das dortige Leben zu beschreiben; geradezu die bilderreichen Winterszenen sind voller Poesie und Sprachkraft.“
zeichenundzeiten.com„In ihrem ersten, überaus beeindruckenden, auch spannenden und in schöner Sprache, mit originellen Bildern erzählten Roman wirft Fridlund ein Bündel von Fragen auf, Fragen, die das Leben täglich stellt. Jede muss sie für sich selbst beantworten.“
tanzschrift.at„Emily Fridlund ist ein beeindruckendes Romandebüt gelungen.“
schreiblust-leselust.de„Was soll man da noch sagen? Zunächst: schönstes Cover des Jahres! Und dann: spannend, klug, verwirrend. Ich denke immer noch drüber nach.“
schnitzel-und-schminke.de„Ein ruhiges Buch, für all diejenigen, die gut erzählte Geschichten und einfühlsame Worte lieben.“
schaedelspalter.de„Ich habe selten ein Debüt von solcher Ideenfülle und Sprachgewalt gelesen.“
piqd.de„Eine Geschichte der Wölfe ist eine gelungene Mischung aus Coming-Of-Age-Story mit mysteriösen Spannungsmomenten.“
madeofstil.com„Großartig erzählt.“
lyrikpoemversgedicht.wordpress.com„Für mich ein absolut großartiges, aber auch sehr bedrückendes und bewegendes Buch.“
litlagletta.wordpress.com„Fridlund hat einen Roman der großen Fragen geschrieben. (…) Es ist ein ungeheuer kraftvoller und atmosphärisch dichter Roman in einer einfachen und doch starken Sprache (…).“
letteraturablog.wordpress.com„Mit der Schwere, die hier über allem liegt, muss man bereit sein sich auseinander zu setzen. Dann hat man mit ›Eine Geschichte der Wölfe‹ ein trauriges aber kraftvolles, sehr individuelles Leseerlebnis.“
fastforward-magazine.de„›Eine Geschichte der Wölfe‹ ist ein interessantes, mutiges und unheimliches Buch, die Stimme Fridlunds einzigartig und rätselhaft.“
culturmag.de„Es gibt - glücklicherweise - immer wieder diese Romane, nach denen erst einmal durchgeatmet werden muss.“
Wilhelmshavener Zeitung„Erneut ist hier das Debüt einer sehr talentierten jungen Autorin aus dem ländlichen Amerika zu bewundern.“
Westfalenpost„Poetisch, mit feinen Sprachbildern erzählt.“
Salon„Die Ich-Erzählerin fügt wie in einem Puzzle Detail an Detail, springt dabei durch die Zeiten –und es entsteht eine überaus komplexe Geschichte, die sich zwischen Thriller und Coming-of-Age-Roman bewegt.“
Kölner Stadt-Anzeiger„Emily Fridlund, selbst in den Wäldern Minnesotas aufgewachsen, schreibt in wunderschöner Sprache, durch die Übersetzung von Stephan Johann Kleiner gewinnt Buch zusätzlich.“
Büchereien Wien„Ein grandioses Debüt über Verantwortung und Erwachsenwerden.“
Bielefelder - Das Magazin für Stadtmenschen„Eine außergewöhnlich schöne Sprache zeichnet diesen Roman aus, was sicher auch an der deutschen Übersetzung liegt. Hier gibt es keine abgegriffenen Bilder und Klischees. Ein feines, ruhiges, manchmal etwas unheimliches Buch.“
WDR 4



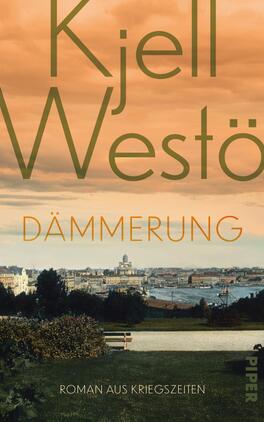

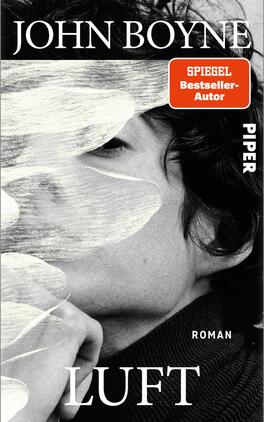
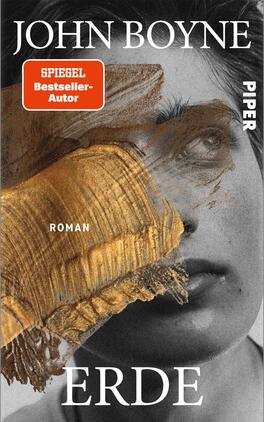

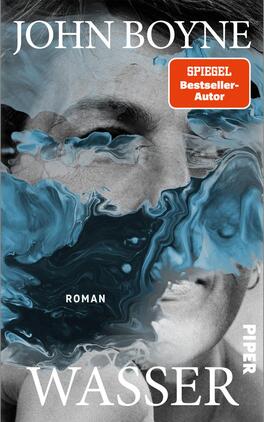

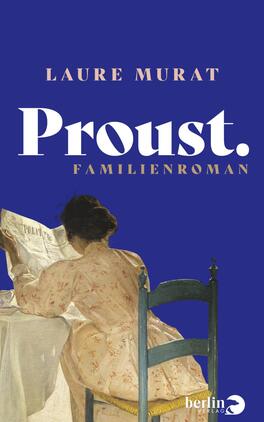
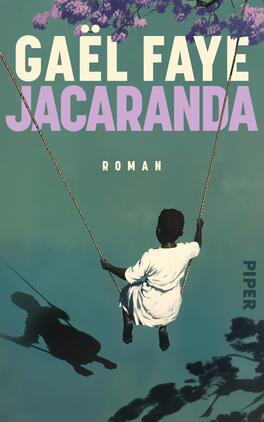






Die erste Bewertung schreiben