
Ein kenianischer Sommer - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Ein wunderbar romantischer Roman zwischen Europa und Afrika, Schweiz und Kenia, Herz und Verstand ...
Von wegen Sommer, Sonne, süßes Leben. Nach fünf Jahren Kenia sitzt Anita wieder im Flugzeug nach Hause. Ohne Job, ohne Mann, ohne Zukunftspläne. Und weil sie auch noch pleite ist, muss sie erst mal bei ihren stockkonservativen Eltern einziehen. Zum Glück ist da noch ihre Lieblingscousine, die lebenslustige Tessa, die Anita mit ihrem Optimismus ansteckt und für sie auf Männersuche geht. Doch dann begegnet Anita zufällig Simon wieder, dem kenianischen Arzt, den es wie sie nach Europa verschlagen…
Ein wunderbar romantischer Roman zwischen Europa und Afrika, Schweiz und Kenia, Herz und Verstand ...
Von wegen Sommer, Sonne, süßes Leben. Nach fünf Jahren Kenia sitzt Anita wieder im Flugzeug nach Hause. Ohne Job, ohne Mann, ohne Zukunftspläne. Und weil sie auch noch pleite ist, muss sie erst mal bei ihren stockkonservativen Eltern einziehen. Zum Glück ist da noch ihre Lieblingscousine, die lebenslustige Tessa, die Anita mit ihrem Optimismus ansteckt und für sie auf Männersuche geht. Doch dann begegnet Anita zufällig Simon wieder, dem kenianischen Arzt, den es wie sie nach Europa verschlagen hat …
Über Blanca Imboden
Aus „Ein kenianischer Sommer“
Leseprobe
Deine Erinnerungen sind ein Land,
aus dem dich keiner vertreiben kann.
Afrikanische Weisheit
SCHWEIZ
Das Flugzeug landet sicher in Zürich, und bald schon betrete ich auf etwas wackeligen Beinen Schweizer Boden.
Ich friere.
Innerlich und äußerlich.
Eiszeit in jeder Beziehung.
Es ist Nachmittag, und die Schweiz empfängt uns in ihrem schönsten Novembergrau. Düster und erdrückend tief hängen die Wolken über Zürich. Man könnte die Stimmung nur noch mit etwas Eisregen oder Graupelschauer toppen. Es schüttelt mich.
Noch während ich am Gepäckband auf meinen Koffer warte, [...]





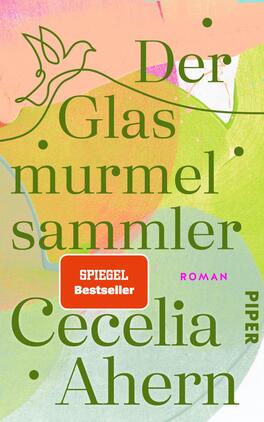












Die erste Bewertung schreiben