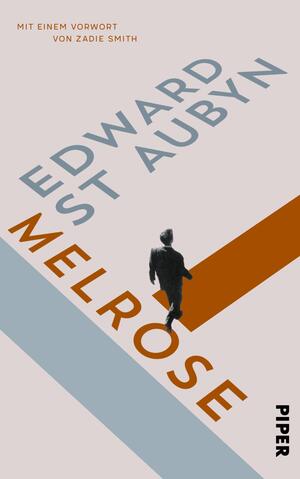
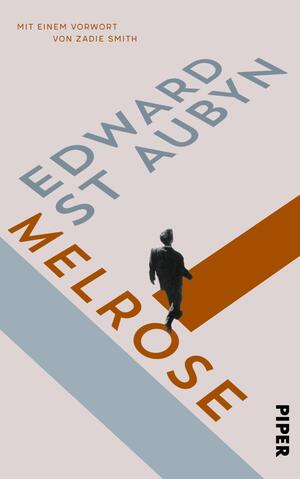
Melrose (Melrose-Saga)
„Ein unvergleichliches Ensemble aus psychologischer Analyse und tiefem Entsetzen über menschliche Destruktivität.“ - SonntagsZeitung (CH)
Melrose (Melrose-Saga) — Inhalt
Mit seinem furiosen fünfteiligen Romanzyklus um sein Alter Ego Patrick Melrose hat sich Edward St Aubyn weltweit in die erste Riege der zeitgenössischen Literatur geschrieben: Die Romane erzählen Patrick Melroses Geschichte von seiner Kindheit bis zum späten Tod seiner Mutter und schildern dabei so elegant wie unnachsichtig das Erwachsenwerden eines begabten, sensiblen Jungen, das in einer aristokratisch privilegierten Umgebung eine schwarze Hölle aus Missbrauch und Vernachlässigung gewesen ist. St Aubyns Melrose-Romane liegen nun erstmals in einem Band vor. „Es ist das reine Vergnügen, in die unvergleichlich reiche und bitterkomische Welt von St Aubyn einzutauchen.“ Zadie Smith
Leseprobe zu „Melrose (Melrose-Saga)“
VORWORT
von Zadie Smith
Wir haben bestimmte Vorstellungen von einem „Sommerbuch“. Es soll am Strand gelesen werden, in der Hängematte oder im hohen Gras. Es verheißt Vergnügen und komplettes Eintauchen: Wenn man es alle paar Minuten auf die Brust sinken lässt, um über das Mittagessen nachzudenken, dann ist es höchstwahrscheinlich kein Sommerbuch. Ein echtes Sommerbuch ist echter als der Sommer selbst: Man lässt Freunde und Familie links liegen, zieht sich auf sein Zimmer und unter das Moskitonetz zurück und vertieft sich – in meinem Fall – wieder in die [...]
VORWORT
von Zadie Smith
Wir haben bestimmte Vorstellungen von einem „Sommerbuch“. Es soll am Strand gelesen werden, in der Hängematte oder im hohen Gras. Es verheißt Vergnügen und komplettes Eintauchen: Wenn man es alle paar Minuten auf die Brust sinken lässt, um über das Mittagessen nachzudenken, dann ist es höchstwahrscheinlich kein Sommerbuch. Ein echtes Sommerbuch ist echter als der Sommer selbst: Man lässt Freunde und Familie links liegen, zieht sich auf sein Zimmer und unter das Moskitonetz zurück und vertieft sich – in meinem Fall – wieder in die Umtriebe des Patrick Melrose. Die Patrick-Melrose-Romane von Edward St Aubyn erzählen die weitgehend autobiografische Geschichte der Familie Melrose, die nur auf dem Papier als „gute Familie“ gelten kann. Von der Mutter Eleanor, einer reichen Erbin und Alkoholikerin, vernachlässigt, vom adligen Vater David ab dem Alter von fünf Jahren missbraucht, wächst Patrick zu einer Art von englischem Gentleman heran, der, je nachdem, welches der Bücher man gerade liest, in New Yorker Hotelsuiten Heroin drückt, den Mythos des Sisyphos in der Manteltasche mit sich herumträgt, kleine Whiskyfläschchen leert, während er mit seinen Kindern in Kew Gardens spazieren geht, und sich selbst noch im schlimmsten Zustand des Absturzes an etliche versprengte englische Gedichtzeilen erinnern kann. St Aubyns Spezialität ist es, die gesamte Handlungsfülle eines Romans in einen einzigen Tag zu packen, mit vielen Vorstößen in die Vergangenheit. Häufig findet an dem fraglichen Tag irgendeine Form von „gesellschaftlicher Tortur“ statt, am besten umschrieben als schauderhafte Zusammenkunft von Leuten, die man am liebsten gar nicht kennen würde. Man hält ein Häppchen in der Hand, wartet darauf, dass einem das Glas aufgefüllt wird, spielt mit Selbstmordgedanken, während am anderen Ende des Raumes irgendein Tölpel eine Rede hält – das Thema der katastrophalen Party hat ganze Generationen englischer Schriftsteller zu heftigen Gefühlsäußerungen angeregt. (Laut Kingsley Amis gibt es im Englischen keine deprimierenderen Wörter als die folgenden drei: „Rot oder weiß?“) In Zu guter Letzt, dem krönenden Abschluss dieser fünf Bücher umfassenden Serie, haben wir es endlich zur Beisetzung von Patricks Mutter geschafft (sein Vater ist bereits dankenswert früh, in Schlechte Neuigkeiten, verstorben) – eine sehr viel komischere Kulisse, als man meinen sollte: „Man hatte den Eindruck, als werde jeder Buchstabe, der den Eingang des Beerdigungsinstituts passierte, sofort in Frakturschrift verzerrt, als sei der Tod ein deutsches Dorf.“ Patrick ist inzwischen mittleren Alters, hat eine Ehe und eine Scheidung hinter sich und gerade einige Zeit in der berühmten britischen Entzugsklinik The Priory verbracht. Er fürchtet einen Rückfall. Aber er hat auch hohe Erwartungen an diese Beerdigung:
Jetzt, wo er Waise war, schien alles perfekt. Es kam ihm vor, als habe er sein ganzes Leben lang auf dieses Gefühl der Vollständigkeit gewartet. Wie gut hatten es doch all die Oliver Twists dieser Erde, die von Anfang an in diesem beneidenswerten Zustand lebten, dessen Erlangung ihn fünfundvierzig Jahre gekostet hatte – doch der relative Luxus, von Bumble und Fagin erzogen worden zu sein, statt von David und Eleanor Melrose, musste zwangsläufig zu einer Schwächung der Persönlichkeit führen.
Sterbende Eltern, Heroin, Missbrauch in der Kindheit, Gefühlskälte, Selbstmord, Alkoholismus – stoppen Sie mich ruhig, falls es zu sommerlich wird. Nichts in der Handlung könnte einen auf die reiche, bissige Komik der Welt des Edward St Aubyn vorbereiten oder auf ihre noch sehr viel überraschendere philosophische Dichte. Für den Großteil seiner schriftstellerischen Laufbahn, bis Muttermilch es 2006 auf die Shortlist des Booker Prize schaffte, blieb St Aubyn ein breites Lesepublikum versagt, vielleicht gerade wegen dieser vermeintlichen Diskrepanz zwischen Stil und Inhalt. Mit dem Witz eines Wilde, der Leichtigkeit eines Wodehouse und der Scharfzüngigkeit eines Waugh umhüllt er mit seiner kunstvollen Prosa das Ich am Abgrund: „erstickt, fallen gelassen, gezeugt durch Vergewaltigung und zur Vergewaltigung gezeugt“ – Situationen, wie man sie sonst eigentlich eher als Leserin von Cooper oder Burroughs kennt.
Jetzt sind die Melrose-Bücher auf einmal schwer in Mode, und man ist versucht, das der Flutwelle des Adligen und Vornehmen zuzuschreiben, die gerade über England hinwegrauscht: eine königliche Hochzeit, ein konservativer Premierminister, ein Kabinett aus Mitgliedern des Bullingdon Club, eine Terence-Rattigan-Renaissance am National Theatre, Downton Abbey im Fernsehen. Aber damit ist man auf dem falschen Luxusdampfer. St Aubyn will die Upperclass nämlich nicht preisen, sondern sie begraben – wenn auch nie zur Gänze und keineswegs ohne Zuneigung –, und dazu bedient er sich genau jenes ironischen Konversationsmodus, in dem diese Schicht so versiert ist. („›Das ist die stärkste Sucht von allen‹, sagte Patrick. ›Heroin? Lächerlich. Aber versuch einfach mal, von der Ironie wegzukommen.‹“) Mit ihrem robusten Anspruchsdenken lassen seine Figuren diese Aufgabe mitunter ganz leicht erscheinen: Es geht nicht so sehr ums Schreiben als vielmehr ums Sich-Raushalten. Diese Charaktere drücken sich nicht lange herum und warten darauf, von einem hart schuftenden, allwissenden Erzähler vorgestellt zu werden. Sie nehmen die Zügel gleich selbst in die Hand, als wollten sie sagen: Jetzt gib schon her, Herrgott. Du hast ja offensichtlich nicht die leiseste Ahnung, was du da tust. Dies hier sind die ersten Sätze von Zu guter Letzt:
›Überrascht?‹, fragte Nicholas Pratt, pflanzte seinen Gehstock auf den Krematoriumsteppich und starrte Patrick grundlos ein wenig verächtlich an, eine überflüssig gewordene, aber längst nicht mehr zu ändernde Angewohnheit. ›Ich bin ja in letzter Zeit geradezu auf Trauerfeiern abonniert. Das wird man in meinem Alter zwangsläufig. Bringt ja nichts, zu Hause herumzusitzen, lauthals über die Unwissenheit der jugendlichen Nachrufschreiber zu lachen oder dem eher eintönigen Vergnügen zu frönen, die täglichen Abgänge unter seinen Altersgenossen zu zählen. Nein! Man muss ›das Leben abfeiern‹: Da geht es hin, unser Schulflittchen! Es heißt, er habe sich mit Anstand geschlagen, aber ich weiß es besser! – so was in der Art, damit die gesamte Lebensleistung angemessen gewürdigt wird. Wohlgemerkt, ich sage nicht, das alles sei nicht sehr bewegend. Diese letzten Lebenstage haben etwas vom Effekt anschwellender Orchestermusik. Und natürlich graut einem fürchterlich. Auf meinen täglichen Runden vom Krankenbett zur Trauerbank und wieder zurück muss ich immer an jene Öltanker denken, die früher alle vierzehn Tage an irgendeinem Felsen zerschellten, und an die Schwärme von Vögeln, die mit verklebten Flügeln am Strand krepierten und verwirrt aus den gelben Augen blinzelten.‹
Meine Güte! Im Fall von St Aubyn ist es einfach ein bisschen schwach, zu sagen, der Mann habe „ein gutes Ohr für Dialoge“. Mancher mag zwar behaupten, dass es auf Erden doch unmöglich noch jemanden geben kann, der tatsächlich so redet wie Nicholas Pratt, aber man braucht nur an einem beliebigen Wochentag den Garrick Club zu betreten, schon findet man ein halbes Dutzend davon, die in ihren Ohrensesseln lümmeln und ihren Verdauungsbrandy schwenken. (Ein kleiner Hinweis: Probieren Sie das besser nicht aus, falls Sie kein Mitglied sind. Oder eine Frau.) Die demografische Gruppe mag zwar wirklich winzig sein, doch die kleinsten Gruppen haben schon die längsten Romanzyklen hervorgebracht (siehe Proust!). Und Patrick fühlt sich der überlegenen Gemeinschaft, der er entstammt, auch keineswegs selbst überlegen; im Gegenteil, er identifiziert sich mit ihr und erkennt sich als „jemanden, der versucht hatte, sich aus allem herauszureden, was er gedacht und gefühlt hatte“. Die Romane treffen diesen Typus und sein endloses Gerede haargenau, doch am Ende bleibt vor allem eine Verteidigung der ganz bescheidenen englischen Syntax übrig, ihrer Windungen und Wendungen, ihres Scharfsinns und ihrer Komik, vor allem aber ihrer Kontrolliertheit. Denn während Patrick Melroses Geschichte oberflächlich betrachtet wie eine Geschichte des Exzesses daherkommt, erhalten die Bücher selbst ihre Struktur aus der Vorstellung, dass sprachliche Kontrolle eine gewaltige Kraft ist. In der Welt des St Aubyn hat derjenige, der die Erzählung kontrolliert, auch die Kontrolle über das Ereignis. Frei nach Lewis Carroll könnten wir das als den Humpty-Dumpty-Effekt bezeichnen.
Patrick zumindest ist stark mit Humpty Dumptys Frage beschäftigt, wer die Macht hat, und kommt mit seiner grauenvollen Familie nur zurecht, indem er sie in vernichtende Verbaldiagnosen einfasst. Als er in der Kirche zu seiner „unglücklichen Tante“ Nancy hinüberschaut, die sich darüber beklagt, wie spärlich und bürgerlich die Beisetzung ihrer Schwester besucht sei (›Mummy hatte zum Beispiel in ihrem ganzen Leben nur einen einzigen Autounfall, aber während sie da kopfüber im verbeulten Blech hing, baumelte neben ihr die Infantin von Spanien.‹), offenbart sein innerer Monolog sowohl die Wurzel von Nancys Problem als auch St Aubyns Umgang mit den zwei Zoll Elfenbein, mit denen Jane Austen ihr Schreiben verglich:
[...] die psychischen Auswirkungen ererbten Reichtums, der rasende Wunsch, diesen Reichtum loszuwerden, und der rasende Wunsch, sich daran festzuklammern; der demoralisierende Effekt dessen, dass man all die Dinge besaß, für deren Erwerb andere Menschen ihr kostbares Leben opferten; die mehr oder minder heimliche Überlegenheit und die mehr oder minder heimliche Scham des Reichen, die zu typischen Tarnungen führten: der Philanthropielösung, der Alkohollösung, der Maske der Exzentrizität, der Suche nach Heil im vollendeten Geschmack; die Besiegten, die Müßiggänger und die Leichtfertigen und ihre Gegenspieler, die Bannerträger – sie alle lebten in einer Welt, deren schillernde Wahlmöglichkeiten Arbeit und Liebe nur schwer durchdringen konnten.
Wenn man Rezensionen schreibt, verbringt man eine Menge Zeit damit, anderer Leute Sätze abzutippen, auch „Zitieren“ genannt. Normalerweise ist das eine langweilige Tätigkeit; bei St Aubyn ist es aber eine Freude. Ach, diese Semikolons, diese Disziplin! Diese so perfekt, so rhythmisch platzierten Kommata, die Sätze formen, beladen und gesegnet, überladen fast, und doch stabil und niemals Gefahr laufend, zusammenzubrechen. Als ließe man ein wunderschönes Stück Brokat durch die Finger gleiten. Diese Weigerung, sich der puritanischen Kürze amerikanischer Sätze zu unterwerfen (oder schlimmer noch: der artifiziellen Arglosigkeit eines englischen Satzes, der klingen soll wie aus dem Französischen übersetzt) – da könnte man fast schon patriotische Gefühle entwickeln.
Aber diese Sätze sind kein bloßer Zierrat. Sie sind wichtig, weil sie die Komik erst ermöglichen: Wenn man jede Zeile gleich mehrfach auffächert, ist immer Platz genug für mindestens zwei Witze und einen gekonnten Seitenhieb. Und es handelt sich um Humor von der schwärzesten Sorte, den vor allem Patricks Eltern abbekommen, selbst noch im Tod. Bei diesem finalen Auftritt erfahren wir mehr über Eleanors „Philanthropielösung“, die erstmals in Muttermilch zur Sprache kam und sie zu Lebzeiten veranlasst, ihre ganze Aufmerksamkeit (und ihr Geld) zunächst Wohltätigkeitsorganisationen für Kinder zu widmen („Eleanor hatte ihn oft mit seinem Vater allein gelassen, während sie an einer Ausschusssitzung des Save the Children Fund teilnahm.“), um sich dann in ihren letzten Lebensjahren einer Gemeinschaft aus falschen Esoterikern anzuschließen, die sie im Handumdrehen um ihr Haus in Saint-Nazaire bringen, dem Schauplatz von Patricks unglücklicher Kindheit und katastrophaler Ehe. Und das alles, „ohne in den beständigen Felsen [ihrer] Selbsterkenntnis auch nur einen Millimeter tief zu ritzen“. Und falls man als Leser der früheren Bände noch an David Melroses psychopathischer Veranlagung zweifeln sollte, setzt zugleich eine Anekdote aus seiner Zeit als Großwildjäger seine Persönlichkeitsstörung in ein neues, grauenhaftes Licht: „Er ging zu dem Tollwütigen“ – einem Mann, den seine Jagdgesellschaft in einem eigentlich für den Transport toter Wildschweine gedachten Netz an einen Baum gehängt hat – „und schoss ihm in den Kopf. Als er zu der wie vom Donner gerührten Gesellschaft zurückkehrte, nahm er ›mit einem Gefühl absoluter Ruhe‹ wieder Platz und sagte: ›Das war die größte Gnade.‹ Der Satz machte am Tisch die Runde: die größte Gnade.“ Aus dieser Erzählung kristallisiert es sich heraus: dass auch das Geschichtenerzählen eine Form der Tyrannei sein kann; und dass die Engländer, sei es aus Höflichkeit, klassenbedingter Unterwürfigkeit oder einfach nur aus schlichter Angst, viel zu oft Erzählungen verteidigen, die so wenig wahr wie äußerst grausam sind.
Die Frage danach, was Wahrheit ausmacht – und wessen Version der Ereignisse sich schließlich durchsetzt –, beginnt als ironische Erkundigung und steigert sich dann zu einer Diskussion über das Wesen des Bewusstseins. Um uns diesen erstaunlichen Übergang zu erleichtern, bekommen wir Erasmus Price serviert, seines Zeichens gefeierter Akademiker, Gast bei Eleanors Beisetzung und Autor von So klug wie zuvor: Entwicklungen in der Bewusstseinsphilosophie. Patricks ebenfalls anwesende Exfrau Mary hatte einmal eine Affäre mit Erasmus, was Patrick erst klar wird, als er sie eines Abends im Bett Erasmus’ Buch lesen sieht:
›Du könntest dieses Buch doch niemals lesen, wenn du nicht eine Affäre mit dem Autor hättest‹, riet er mit halb geschlossenen Augen.
›Glaub mir, sogar dann ist es praktisch unmöglich.‹
Diese Eröffnung hat einen Rückfall zur Folge: „eine ›absolut unerträgliche‹ Phase […], in der Patrick sein neues Blackout-Einzimmerapartment nur noch verließ, um sie [Mary] über Bewusstseinsforschung zu belehren oder auszufragen […]“:
›Wer wird uns von der Erklärungslücke befreien?‹, schrie er, wie Heinrich der Zweite nach einem Mörder schrie, der seinen aufrührerischen Priester töten sollte. ›Und ist jene Lücke nur ein Produkt unseres missverstandenen Diskurses?‹ Er faselte weiter. ›Ist die Realität eine einvernehmliche Halluzination? Und ist ein Nervenzusammenbruch eigentlich die Weigerung, einvernehmlich zu handeln? Na los, nicht so schüchtern, sag mir, was du meinst!‹
›Warum gehst du nicht einfach in dein Apartment zurück und kippst dort um? Ich will nicht, dass dich die Kinder in diesem Zustand sehen.‹
›Was für ein Zustand? Den Zustand philosophischer Neugierde?‹
Sind Gehirn und Geist ein und dasselbe? Aus welchem Stoff ist das Bewusstsein gemacht? Ist eine „Person“ einfach nur die Summe einer Reihe von Anekdoten, die sich das Bewusstsein über sich selbst erzählt? Es ist nicht verwunderlich, dass Patrick sich nach dem sehnt, was Mary als „überzeugende, taugliche Bewusstseinstheorie“ bezeichnet: Wenn man das eigene Unglück mit Medikamenten bekämpft, setzt man natürlich all sein Vertrauen in die „Erklärungslücke“, in die Hoffnung, den Geist zu heilen, indem man das Gehirn behandelt.
Das Dumme ist nur, dass Patrick die Dinge nicht als einheitliches Ich mit einem in sich geschlossenen Geist erfährt; stattdessen ist ihm das Leben unvollständig, fast schon formlos:
Das gesellschaftliche Leben hatte die Tendenz, ihn mit seiner grundsätzlichen Ablehnung der Prämisse zu konfrontieren, die individuelle Identität definiere sich dadurch, dass sie die Erfahrung in eine immer strukturiertere und kohärentere Geschichte verwandelte. In der Reflexion, nicht im Erzählen fand er Authentizität. Der Druck, seine Vergangenheit in anekdotischer Form zu präsentieren oder gar die Zukunft in Gestalt vehementer Bestrebungen, führte dazu, dass er sich schwerfällig und künstlich vorkam. [...] Sein authentisches Selbst war der aufmerksame Zeuge einer Vielzahl unsteter Eindrücke, die es, an sich, nicht vermochten, sein Gefühl der Identität zu steigern oder zu schmälern.
Genau diese grundsätzliche Ablehnung bringen die Melrose-Romane zur Sprache. Keine der Figuren wird bevorzugt, nicht einmal Patrick; die Serie kümmert sich nicht um klare Grenzen zwischen Haupt- und Nebenfiguren, sondern dringt stattdessen immer in den Geist jedes Einzelnen ein. Schön ist es nicht, was dabei zum Vorschein kommt: ein schmutziger Strom von Begierden, wenig korrekten Eindrücken, starken Meinungen, Selbstrechtfertigungen und Selbsttäuschungen. Strukturell gesehen sind das ideale Voraussetzungen für Komik, aber es schwingt auch sehr viel Ernst mit, denn die Kernfrage des komischen Romans – Wie kann ich sicher sein, dass ich nicht lächerlich bin? – besitzt eine große Nähe zu der Kernfrage der Bewusstseinsphilosophie: Wie kann ich sicher sein, was real ist? Beim Empfang nach der Beisetzung erleben wir, wie Fleur, eine geistesgestörte Bekannte von Patricks Mutter, die Patrick selbst noch aus der Entzugsklinik kennt, die Gäste abklappert, um sie zu fragen, ob sie schon mal ihr bevorzugtes Antidepressivum ausprobiert hätten. Sie kommt auch zu Erasmus:
›Haben Sie es mal mit Amitriptylin versucht?‹, fragte sie.
›Nie von ihm gehört‹, erwiderte Erasmus. ›Was hat er denn geschrieben?‹
Fleur wurde klar, dass Erasmus noch wesentlich gestörter war, als sie ursprünglich angenommen hatte.
Patrick weiß, dass Fleur verrückt ist, wir wissen, dass Fleur verrückt ist, und auch Erasmus wird es in Kürze feststellen – aber weiß Fleur es selbst? Wenn wir das Begräbnis aus ihrer Perspektive sähen, und nur aus ihrer, wir würden es als „Realität“ bezeichnen, weil wir es nicht besser wüssten. Was völlig absurd ist, denn welcher vernünftige Mensch würde auf Fleurs Aussagen vertrauen? Und doch ist genau dieser singuläre, begrenzte und unzuverlässige Zugang zur Realität das Schicksal jedes Einzelnen auf dieser Welt.
Die brillanteste Formulierung des Buches ist gar nicht geistreich, sondern einfach nur schmerzhaft zutreffend: „[Er hatte] seine Beziehung zu ihr [seiner Mutter] die längste Zeit eher als Einwirkung auf seine Persönlichkeit, denn als Austausch mit einer anderen Person betrachtet.“ Patrick ist natürlich ein Extremfall, doch auch für uns andere, die wir in ebenso festgefahrenen, vergifteten Beziehungen zu unseren sogenannten „Lieben“ stecken, sind die Fragen aus Zu guter Letzt kein Spaß. Als Patrick Marys Einladung ausschlägt, sie zu besuchen und mit seinen Kindern zu essen, bekommt er von seinem Sohn Thomas zu hören: „›Eigentlich [...] solltest du unbedingt noch mal drüber nachdenken, denn dazu ist dein Kopf da!‹“ Aber ist es überhaupt möglich, seinen Kopf so zu gebrauchen? Ist es möglich, sich frei zu entscheiden? So lange schon wird Patrick von Kräften regiert, die sich allem Anschein nach seiner Kontrolle entziehen – Traumata, Charaktereigenschaften, Hirnchemie –, dass ihm die Vorstellung eines „selbstbestimmten Lebens“ geradezu„extravagant“ erscheint: „Wie wäre es, auf nichts zu reagieren und auf alles einzugehen?“
Und so lauten dann die letzten Sätze der Patrick-Melrose-Romane: „Er griff zum Hörer und wählte Marys Nummer. Er würde noch mal drüber nachdenken. Denn dazu war der Kopf, wie Thomas sagte, ja schließlich da.“ Hier und auch an anderen Stellen spürt man einen emotionalen Imperativ, der dem Autor mehr bedeutet, als bis auf die letzte spitze Bemerkung mit Evelyn Waugh gleichzuziehen. (Nicholas: „›Ungeachtet seiner Schattenseiten als Vater hat er [David] doch zumindest nie seinen Sinn für seinen Humor verloren.‹“ Patrick: „›Er konnte nur den Dingen eine komische Seite abgewinnen, die keine hatten. Das ist kein Sinn für Humor, sondern nur eine Form von Grausamkeit.‹“) In diesem funkelnden Erwachsenenroman kann ich gar nicht anders, als bei dem kitschigen Satz des kleinen Jungen dahinzuschmelzen, wenn ich mirSt Aubyn vorstelle – der seinen eigenen Kindern bescheinigt, sie hätten ihn letztendlich doch noch zumindest ein bisschen glücklich gemacht –, wie er ihn dort, gleich einem Siegel auf einem Liebesbrief, platziert hat.
Der eisernen Verachtung für die Psychiatrie, die in Patricks Kreisen herrscht (gleich nach der Beisetzung fällt Nicholas infolge eines Herzinfarkts tot um, mitten in einer Tirade darüber, dass „›die menschliche Vorstellungskraft mit mörderischen Babys und inzestuösen Kindern verseucht ...‹ sei“), und seinem eigenen Panzer aus Ironie zum Trotz, scheint Patrick aus Therapie und Entzug tatsächlich echte Kraft gezogen zu haben, und er hört sich zu seinem eigenen Erstaunen Sätze aus dem Repertoire der Priory äußern, die Nicholas den Schaum vor den Mund getrieben hätten: „Groll bedeutet, Gift zu trinken und zu hoffen, dass jemand anders daran stirbt.“ Verschwunden ist der Beckett zitierende Heroinsüchtige, der „saß in Träumen ertrunken und brannte darauf zu enden“. Und so wie Becketts Krapp ist auch der neue Patrick Melrose jemand, der es nicht mehr nötig hat, jemand zu sein – der nicht einmal mehr versucht, jemand zu sein. Ihm fehlen im besten Sinne die Worte. Zu den sprachmächtigsten Beschreibungen genau dieser Art von Sprachlosigkeit zählt William Empsons sechs Zeilen langes Meisterwerk „Lass los“. Während Patrick am Rande eines Rückfalls im Taxi sitzt, fällt ihm dieses Gedicht ein:
›Zurück zur Priory?‹, fragte der Fahrer, schon nicht mehr ganz so verständnisvoll.
Von denjenigen unter uns, die zurück müssen, will er nichts wissen, dachte Patrick. Er schloss die Augen und streckte sich auf dem Rücksitz aus. ›Das Reden würde reden und so weit danebengehen.‹ Und dann? Und dann? ›Bloß nicht ins Irrenhaus und was dazugehört.‹ Und was dazugehört. Welch eine wunderbare Sprachlosigkeit, wie sie sich drohend ausdehnt und dann wie unter Zwang wieder zusammenzieht.
Die meisten Schriftsteller hätten sich hier mit Auslassungen aus der Affäre gezogen, aber um so demütig und vorsätzlich falsch zu zitieren, muss man schon St Aubyn sein. In Romanen kommt ständig irgendwem „etwas in den Sinn“, meistens allerdings auf so hochglanzpolierte Weise, dass es das echte Bewusstsein Lügen straft. Bei St Aubyn aber ist es bis zum Irrenhaus nie allzu weit.
Schöne Verhältnisse
1
Morgens um halb acht kam Yvette die Einfahrt herunter, die Wäsche im Arm, die sie am vorigen Abend gebügelt hatte. Eine Sandale schlappte leise, sie hielt sie mit gekrümmten Zehen fest; der Riemen war gerissen, und ihre Schritte auf dem steinigen, zerfurchten Weg waren unsicher. Über die Mauer hinweg sah sie unterhalb der Zypressen, welche die Einfahrt säumten, den Doktor im Garten stehen.
Er trug seinen blauen Morgenmantel und bereits eine dunkle Sonnenbrille, obwohl die Septembersonne so früh noch gar nicht über die Kalkfelsen des Berges gestiegen war, und richtete einen dicken Wasserstrahl aus dem Schlauch in seiner Hand auf eine Ameisenkolonne, die emsig über den Schotter zu seinen Füßen krabbelte. Seine Technik war ausgereift: Die Überlebenden durften sich weiter über die nassen Steine mühen und ihre Würde eine Weile zurückgewinnen, bevor er das Wasser wieder auf sie herabdonnern ließ. Mit der freien Hand nahm er die Zigarre aus dem Mund, ihr Qualm kräuselte sich durch die braungrauen Locken über seiner kantigen Stirn. Dann verdichtete er den Strahl mit dem Daumen, um eine Ameise genauer zu treffen, die er unbedingt tot sehen wollte.
Yvette musste nur noch am Feigenbaum vorbei, dann konnte sie ins Haus huschen, ohne dass Dr. Melrose ihr Kommen bemerkt hatte. Er hatte jedoch die Angewohnheit, nach ihr zu rufen, ohne den Blick vom Boden zu heben, wenn sie sich eben im Schutz des Baumes wähnte. Gestern hatte er gerade so lange mit ihr geredet, dass ihre Arme erlahmten, aber nicht lange genug, dass sie die Leinentücher fallen ließ. So etwas konnte er sehr genau einschätzen. Zunächst hatte er sie nach ihrer Meinung zum Mistral befragt und dabei übertriebenen Respekt vor ihrem Wissen als Einheimische bekundet. Als er schließlich so gnädig gewesen war, sich für die Arbeit ihres Sohnes in der Werft zu interessieren, hatte sich der Schmerz schon über die Schultern ausgebreitet und stach ihr gelegentlich scharf in den Nacken. Sie war entschlossen gewesen, ihm standzuhalten, selbst als er sich noch nach den Rückenschmerzen ihres Mannes erkundigt hatte, ob die ihn womöglich während der Ernte am Traktorfahren hindern könnten. Heute ließ er kein „Bonjour, chère Yvette“ hören, womit sich diese beflissenen morgendlichen Schwätzchen sonst ankündigten, also bückte sie sich unter den tief hängenden Zweigen des Feigenbaumes hindurch und ging ins Haus.
Das Chateau, wie Yvette das Haus nannte, das für die Melroses ein altes Bauernhaus war, lag am Hang, sodass die Einfahrt sich auf Höhe des Obergeschosses befand. Eine breite Treppe führte zu einer Seite des Hauses, auf die Terrasse vor dem Wohnzimmer hinunter.
Eine weitere Treppe ging auf der anderen Seite hinab zu einer Kapelle, in der die Mülleimer verborgen waren. Im Winter plätscherte Wasser durch eine Reihe von kleinen Tümpeln den Hang hinunter, doch um diese Jahreszeit blieb die Rinne neben dem Feigenbaum stumm und war mit zerquetschten und geplatzten Früchten verstopft, die Flecken hinterlassen hatten, wo sie aufgeprallt waren.
Yvette schritt in den hohen, dunklen Raum und legte die Wäsche ab. Sie knipste das Licht an und begann, Handtücher und Bettlaken, Laken und Tischtücher auseinanderzusortieren. Zehn hohe Schränke waren bis obenhin voll mit ordentlich gefalteten Leintüchern, die nicht mehr benutzt wurden. Manchmal öffnete Yvette die Schranktüren, um die gut gehütete Sammlung zu bewundern. In einige der Tischtücher waren Lorbeerblätter oder Weintrauben eingewoben, nur erkennbar, wenn man sie in einem bestimmten Winkel ins Licht hielt. Sie strich mit dem Finger über die Monogramme, die in die glatten weißen Laken gestickt waren, über die kleinen Kronen um den Buchstaben „V“ in der Ecke der Servietten. Am liebsten mochte sie das Einhorn über einem Band fremdartiger Worte auf manchen der ältesten Laken, aber auch diese wurden nie benutzt. Mrs Melrose bestand darauf, dass Yvette immer vom gleichen armseligen Stapel schlichter Leinenwäsche nahm, der im kleineren Schrank neben der Tür lag.
Eleanor Melrose hastete die flachen Stufen von der Küche zur Einfahrt hinauf. Hätte sie sich langsamer bewegt, wäre sie womöglich gestrauchelt, stehen geblieben, hätte sich verzweifelt auf die niedrige Mauer neben der Treppe gesetzt. Sie wagte ihre hartnäckige Übelkeit, die sie bereits mit einer Zigarette verschlimmert hatte, nicht durch Essen zu reizen. Nach dem Erbrechen hatte sie sich die Zähne geputzt, doch den galligen Geschmack hatte sie immer noch im Mund. Auch vor dem Erbrechen hatte sie sich schon die Zähne geputzt, denn sie konnte ihre optimistische Ader nie ganz abbinden. Seit Anfang September war es morgens kühler, und die Luft roch bereits nach Herbst, doch das berührte Eleanor wenig, ihr trat der Schweiß durch dicke Puderschichten auf die Stirn. Bei jedem Schritt stützte sie sich mit den Händen auf die Knie, um voranzukommen, starrte durch eine riesige dunkle Sonnenbrille auf die weißen Leinenschuhe an ihren bleichen Füßen und auf die rohseidene Hose, dunkelrot wie Paprika, die ihr an den Beinen klebte.
Sie stellte sich Wodka vor, über Eis gegossen, wie die milchig gefrorenen Würfel auf einmal klar wurden und sich im Glas verteilten, knackend wie eine Wirbelsäule unter den kundigen Händen eines Chiropraktikers. Wie die klebrigen, klumpigen Würfel nebeneinander klimperten, ihren Raureif an die Glaswand abgaben, und dann der Wodka: kalt und ölig in ihrem Mund.
Links neben den Stufen stieg die Einfahrt steil zu einem flachen, runden Platz an, wo ihr rotbrauner Buick unter einer Schirmkiefer geparkt war. Er sah absurd aus, wie er sich auf seinen Weißwandreifen vor dem Hintergrund aus Weinterrassen und Olivenhainen breitmachte, doch für Eleanor war ihr Wagen wie das Konsulat in einer fremden Stadt, und sie steuerte mit der Dringlichkeit einer ausgeraubten Touristin darauf zu.
Kügelchen durchsichtigen Harzes klebten auf der Motorhaube. Ein Spritzer mit einer welken Kiefernnadel darin haftete am unteren Rand der Windschutzscheibe. Sie versuchte ihn abzunehmen, verschmierte dabei die Scheibe nur noch mehr und machte sich die Fingerspitzen klebrig. Sie wollte so schnell wie möglich ins Auto steigen, kratzte aber weiter zwanghaft am Harz und schwärzte ihre Fingernägel. Eleanor mochte ihren Buick so gern, weil David ihn nie fuhr oder sich auch nur hineinsetzte. Ihr gehörten das Haus und die Ländereien, sie bezahlte die Dienstboten und die Getränke, aber nur dieses Auto war wirklich ihr Besitz.
Als sie David vor zwölf Jahren kennenlernte, hatte sein Aussehen sie fasziniert. Die Miene, auf die man ein Anrecht zu haben glaubt, wenn man aus einem kalten englischen Salon auf seinen Grundbesitz starrt, hatte sich über fünf Jahrhunderte störrisch eingegraben und in Davids Zügen vervollkommnet. Eleanor begriff nie ganz, warum die Engländer es für so vornehm hielten, lange Zeit an ein und demselben Ort nichts getan zu haben, aber David ließ keinen Zweifel daran, dass dem so war. Außerdem stammte er über den Umweg einer Prostituierten von Charles II. ab. „Das würde ich an deiner Stelle nicht so herausposaunen“, hatte sie gescherzt, als er ihr davon erzählte. Statt zu lächeln, hatte er ihr das Gesicht auf eine Weise zugewandt, die sie inzwischen verabscheute: mit vorgeschobener Unterlippe und einem Blick, der verriet, wie sehr er sich beherrschen musste, um nichts Vernichtendes zu sagen.
Einst hatte sie bewundert, dass und wie er Arzt geworden war. Als er seinem Vater diese Absicht unterbreitete, hatte General Melrose sofort seine Leibrente gestrichen und das Geld stattdessen zur Aufzucht von Fasanen verwandt. Auf Menschen und Tiere zu schießen war der Zeitvertreib eines Gentlemans; deren Wunden zu versorgen jedoch die Aufgabe von Quacksalbern aus der Mittelschicht. Das war die Ansicht des Generals, aufgrund der er nun noch häufiger jagen gehen konnte. General Melrose fiel es nicht schwer, seinen Sohn kühl zu behandeln. Er hatte überhaupt zum ersten Mal Interesse an David gezeigt, als der Eton abschloss, und ihn gefragt, was er zu tun gedenke. David hatte gestammelt: „Ich fürchte, das weiß ich noch nicht, Sir“, weil er nicht zu gestehen wagte, dass er komponieren wollte. Es war dem General nicht entgangen, dass sein Sohn auf dem Klavier herumklimperte, und er nahm zu Recht an, eine Militärkarriere würde diese weibische Neigung unterdrücken. „Du gehst am besten zum Militär“, sagte er und bot seinem Sohn mit ungeschickter Kameraderie eine Zigarre an.
Und doch war David Eleanor so anders erschienen als die ganze Schar unbedeutender englischer Snobs und entfernter Cousins, die sie umgaben, immer bereit, notfalls einzuspringen oder ein Wochenende zu kommen. Sie steckten voller Erinnerungen, die nicht mal ihre eigenen waren, Erinnerungen an das Leben ihrer Großväter, das ihre Großväter so nie geführt hatten. Als sie David kennenlernte, hatte sie das Gefühl, er sei der erste Mensch, der sie wirklich verstand. Jetzt wäre er der letzte Mensch gewesen, bei dem sie nach Verständnis gesucht hätte. Dieser Umschwung war nicht leicht zu erklären, und sie bemühte sich, dem verführerischen Gedanken zu widerstehen, dass er die ganze Zeit auf ihr Geld gewartet habe, um damit endlich seine Vorstellung von einem ihm gemäßen Lebensstil finanzieren zu können. Vielleicht war es im Gegenteil gerade ihr Geld, das ihn verdorben hatte. Bald nach ihrer Heirat hatte er seine Arztpraxis aufgegeben. Anfänglich hatten sie noch davon gesprochen, einen Teil ihres Geldes zur Gründung eines Heimes für Alkoholiker zu verwenden. In gewisser Weise war ihnen das auch gelungen.
Wieder durchfuhr Eleanor der Gedanke, sie könnte David begegnen. Sie riss sich von dem Harztropfen auf der Windschutzscheibe los, stieg ins Auto, fuhr den unförmigen Buick an der Treppe vorbei die staubige Einfahrt entlang und hielt erst an, als sie halb den Hügel hinunter war. Sie war auf dem Weg zu Victor Eisens Haus, damit sie möglichst früh mit Anne zum Flughafen aufbrechen konnte, aber zunächst musste sie sich in Form bringen. Unterm Fahrersitz lag, in ein Kissen gewickelt, eine kleine Flasche Bisquit Cognac. In der Handtasche hatte sie die gelben Tabletten zum Wachhalten und die weißen zum Schutz vor den Furcht- und Panikattacken, die von den Wachmachern verursacht wurden. Da sie die lange Fahrt vor sich hatte, nahm sie vier statt der üblichen zwei gelben Pillen, darauf zwei von den weißen, weil sie fürchtete, die größere Dosis könnte sie schreckhaft werden lassen, und spülte alle mit der halben Flasche Cognac hinunter. Zunächst erschauerte sie heftig, aber noch bevor der Alkohol ihre Blutbahn erreicht hatte, spürte sie seinen kräftigen Kick, der sie mit Dankbarkeit und Wärme erfüllte.
Sie ließ sich in den Sitz zurücksinken, auf dessen Kante sie bis eben verkrampft gehockt hatte, und erkannte sich zum ersten Mal an diesem Tag im Spiegel. Wie eine Schlafwandlerin, die nach einem gefährlichen Ausflug wieder ins Bett steigt, nahm sie in ihrem Körper Platz. Durch die geschlossenen Fenster sah sie schwarz-weiße Elstern geräuschlos aus den Weinreben flattern; die Nadeln der Kiefern hoben sich scharf von dem bleichen Himmel ab, den zwei Tage starker Wind blank gefegt hatte. Sie ließ den Motor wieder an und fuhr los, lenkte den Wagen mehr schlecht als recht über die schmalen und steilen Wege.
David Melrose war des Ameisenertränkens müde und beendete die Gartenbewässerung. Ließ sich die sportliche Betätigung nicht mehr auf einen Punkt konzentrieren, ließ sie ihn verzweifeln. Es gab immer noch ein Nest, noch eine Ameisensiedlung. Wie seine Tanten traten sie nie einzeln auf, und es stachelte seine Mordlust noch an, wenn er dabei an die sieben überheblichen Schwestern seiner Mutter dachte, hochmütige und selbstsüchtige Frauen, denen er als Junge seine Begabung am Klavier hatte vorführen müssen.
David ließ den Schlauch auf den Schotterweg fallen und dachte daran, wie wenig Eleanor ihm noch nützte. Sie war schon zu lange starr vor Schreck. Als wollte man die geschwollene Leber eines Patienten abtasten, wenn man schon nachgewiesen hatte, dass sie schmerzte. Nur gelegentlich konnte man sie dazu bringen, sich zu entspannen.
Er erinnerte sich an einen Abend vor zwölf Jahren, als er sie zum Abendessen in seine Wohnung gebeten hatte. Wie vertrauensselig sie damals war! Sie hatten bereits miteinander geschlafen, doch Eleanor war ihm gegenüber immer noch schüchtern. Sie trug ein eher formloses weißes Kleid mit großen schwarzen Punkten. Sie war achtundzwanzig, sah aber mit ihrem einfach geschnittenen, glatten blonden Haar jünger aus. Er fand ihre verwirrte, erschöpfte Art hübsch, doch was ihn erregte, war ihre Ruhelosigkeit, die stille Verzweiflung einer Frau, die sich unbedingt in eine wichtige Aufgabe stürzen will, aber keine findet.
Er hatte ein marokkanisches Gericht gekocht, mit Mandeln gefüllte Tauben, die er ihr auf einem Bett aus Safranreis servierte, doch dann zog er den Teller wieder weg. „Würdest du etwas für mich tun?“, fragte er.
„Natürlich“, sagte sie. „Was denn?“
Er stellte den Teller hinter ihrem Stuhl auf den Boden und sagte: „Würdest du dein Essen ohne Messer und Gabel und ohne Hände essen, direkt mit dem Mund vom Teller?“
„Du meinst, wie ein Hund?“, fragte sie.
„Wie ein Mädchen, das so tut, als wäre sie ein Hund.“
„Aber wieso?“
„Weil ich es gern möchte.“
Er hatte das Risiko genossen. Sie hätte auch Nein sagen und gehen können. Wenn sie blieb und ihm seinen Willen tat, hätte er sie. Das Eigenartige war, dass sie beide nicht auf die Idee kamen zu lachen.
Eine Unterwerfung, selbst eine so absurde, war für Eleanor eine echte Versuchung. Sie opferte Dinge, an die sie nicht glauben wollte – Tischmanieren, Würde, Stolz –, für etwas, an das sie glauben wollte: Opferbereitschaft. Die Leere der Handlung, die Tatsache, dass sie niemandem nützte, hatte die Geste damals noch reiner wirken lassen. Sie ließ sich auf allen vieren auf dem fadenscheinigen Perserteppich nieder, die Hände flach neben den Teller gelegt. Ihre Ellbogen ragten nach außen, als sie den Oberkörper senkte und ein Stück Taube zwischen die Zähne nahm. Sie spürte ein Ziehen am unteren Ende der Wirbelsäule.
Sie richtete sich auf, legte die Hände auf die Knie und kaute still. Die Taube schmeckte eigenartig. Sie hob den Blick ein wenig und sah Davids Schuhe, einer zeigte auf dem Boden in ihre Richtung, der andere schlenkerte dicht vor ihr in der Luft. Sie schaute nicht höher als bis zum Knie seiner übergeschlagenen Beine, beugte sich lieber wieder hinunter, aß diesmal mit größerem Eifer, wühlte im Reis nach einer Mandel, schüttelte sacht den Kopf, um ein Stück Taube vom Knochen zu lösen. Als sie endlich zu ihm aufsah, war eine ihrer Wangen mit Sauce glasiert, gelber Reis klebte ihr an Mund und Nase. Jegliche Verwirrung war aus ihrer Miene verschwunden.
Einige Augenblicke hatte David sie verehrt, weil sie tat, was er verlangte. Er streckte den Fuß aus und strich ihr mit der Kante seines Schuhs zärtlich über die Wange. Ihr Vertrauen zu ihm fesselte ihn völlig, doch er wusste nichts damit anzufangen, da es seinen Zweck schon erfüllt hatte: Er konnte sie dazu bringen, sich zu unterwerfen.
Am folgenden Tag erzählte er Nicholas Pratt, was geschehen war. Es war einer jener Tage, an denen er seine Sekretärin sagen ließ, er sei beschäftigt, um dann im Club zu trinken, außer Reichweite der fiebrigen Kinder und der Frauen, die ihren Kater als Migräne ausgaben. Er trank gern unter der blaugoldenen Decke des Morgensalons, wo die Luft immer leicht vom Vorübergehen wichtiger Männer vibrierte. Die langweiligen, verlebten und unbekannten Mitglieder munterte diese Atmosphäre auf, so wie kleine Boote an ihren Ankerplätzen auf und ab schwanken, wenn eine der großen Yachten aus dem gemeinsamen Hafen fährt.
„Warum hast du sie dazu gebracht?“, fragte Nicholas, zwischen Boshaftigkeit und Abscheu schwankend.
„Sie hat so wenig Gesprächsthemen, findest du nicht auch?“, sagte David.
Nicholas antwortete nicht. Er hatte das Gefühl, zur Komplizenschaft gezwungen zu werden, so wie Eleanor zum Essen.
„Hat sich das denn vom Fußboden aus gebessert?“, fragte er.
„Ich bin kein Zauberkünstler“, sagte David. „Ich konnte sie nicht unterhaltsam machen, aber immerhin zum Schweigen bringen. Ich hätte nicht noch ein Gespräch über die Leiden der Reichen ertragen. Ich weiß darüber so wenig, und sie weiß so wenig über irgendetwas anderes.“
Nicholas kicherte, und David zeigte die Zähne. Wie man auch dazu stehen mochte, ob David sein Talent verschleuderte, dachte Nicholas: Im Lächeln war er nie gut gewesen.
David ging die rechte Seite der Doppeltreppe hinauf, die vom Garten zur Terrasse führte. Er war zwar inzwischen sechzig, aber sein Haar noch dicht und ein wenig unbändig. Sein Gesicht war erstaunlich attraktiv. Der einzige Fehler war die Makellosigkeit: Es war die Blaupause eines Gesichts; es wirkte unbewohnt, als könnten die Spuren von des Besitzers Lebensweise die vollkommene Form nicht verändern. Wer David gut kannte, suchte nach Zeichen des Verfalls, doch die Maske wurde mit jedem Jahr edler. So steif er den Nacken auch machte, hinter seiner dunklen Brille zuckten die Augen unbeobachtet hin und her und taxierten die Schwächen der anderen. Die Diagnose war als Arzt seine berauschendste Fähigkeit gewesen, danach hatte er oft das Interesse an den Patienten verloren, es sei denn, ihr Leiden faszinierte ihn. Ohne die dunkle Brille wirkte er unaufmerksam, bis er die Verwundbarkeit eines anderen Menschen ausmachte. Dann wurde sein Blick hart wie ein angespannter Muskel.
Am oberen Ende der Treppe blieb er stehen. Seine Zigarre war ausgegangen, er warf sie über die Mauer in die Weinranken. Gegenüber war der Efeu, der die Südwand des Hauses bedeckte, bereits von Rot durchzogen. Die Farbe rang ihm Bewunderung ab. Eine trotzige Geste gegen den Verfall, wie ein Mann, der seinem Folterknecht ins Gesicht spuckt. Er hatte gesehen, wie Eleanor früh mit ihrem lächerlichen Auto davongebraust war. Er hatte sogar gesehen, wie Yvette sich ins Haus zu stehlen versucht hatte, ohne seine Aufmerksamkeit zu erregen. Wer konnte es ihnen verübeln?
Er wusste, seine Unfreundlichkeit Eleanor gegenüber zeigte nur Wirkung, wenn er sie mit besorgtem Mitgefühl und ausführlichen Entschuldigungen für seinen destruktiven Charakter abwechselte, doch auf diese Variationen verzichtete er inzwischen, weil er so grenzenlos enttäuscht von ihr war. Er wusste, sie konnte ihm nicht helfen, den Knoten der Sprachlosigkeit zu lösen, den er tief in sich trug. Stattdessen zog er sich immer enger zu, wie drohendes Ersticken, das jeden Atemzug überschattete.
Es war absurd: Den ganzen Sommer lang hatte ihn die Erinnerung an einen stummen Krüppel verfolgt, den er am Flughafen von Athen gesehen hatte. Der Mann hatte versucht, winzige Tüten Pistazien zu verkaufen, indem er den wartenden Passagieren gedruckte Werbezettel in den Schoß warf, hatte sich mit unkontrolliert zuckenden Füßen, hin- und herrollendem Kopf und zum Himmel verdrehten Augen vorwärtsgeschleppt. Jedes Mal, wenn David gesehen hatte, wie der Mund des Mannes sich stumm, keuchend wie ein Fisch am Flussufer, verzerrte, hatte er eine Art Schwindel verspürt.
David lauschte auf das Schlurfen seiner gelben Hausschuhe, als er die letzten paar Stufen zur Tür hinaufstieg, die von der Terrasse ins Wohnzimmer führte. Yvette hatte die Vorhänge noch nicht aufgezogen, was ihm das Zuziehen ersparte. Er mochte es, wenn das Wohnzimmer düster und wertvoll aussah. Ein dunkelroter, reichlich vergoldeter Stuhl, den Eleanors amerikanische Großmutter auf einem ihrer Einkaufszüge durch Europa einer alten venezianischen Familie abgehandelt hatte, stand auf der anderen Seite des Raumes an der Wand. Ihm gefiel die skandalöse Geschichte seines Erwerbs, und da er wusste, dass er eigentlich behutsam konserviert in ein Museum gehörte, nahm er absichtlich so oft wie möglich darauf Platz. Wenn er allein war, setzte er sich manchmal auf den so genannten Dogenstuhl, umschloss mit der Rechten eine der kunstvoll geschnitzten Armlehnen und nahm eine Pose ein, derer er sich aus der Illustrated History of England erinnerte, die er als Schüler bekommen hatte. Das Bild zeigte den immensen Ärger Henrys V., als ihm der unverschämte französische König Tennisbälle als Geschenk übersandt hatte.
David war von Beutestücken Eleanors mütterlicher amerikanischer Familie umgeben. Zeichnungen von Guardi und Tiepolo, Piazzetta und Novelli hingen dicht an dicht an den Wänden. Ein französischer Wandschirm aus dem achtzehnten Jahrhundert, voll mit graubraunen Affen und hellroten Rosen, teilte den Raum in zwei Hälften. Aus Davids Blickwinkel halb dahinter verborgen stand ein schwarz lackiertes chinesisches Kabinett, auf dem sich ordentliche Flaschenreihen drängten und in dessen Innerem sich Nachschub befand. Als er sich einen Drink einschenkte, musste David an seinen toten Schwiegervater denken, Dudley Craig, einen charmanten, betrunkenen Schotten, den Eleanors Mutter Mary verstoßen hatte, als sein Unterhalt zu teuer wurde.
Nach Dudley Craig hatte Mary Jean de Valençay geheiratet, denn sie fand, wenn sie schon einen Mann aushielt, konnte er wenigstens Herzog sein. Eleanor war in einer Reihe Häuser aufgewachsen, in denen anscheinend jeder Gegenstand einst einem König oder Kaiser gehört hatte. All diese Villen waren wunderbar, doch die Gäste gingen meist erleichtert und mit dem Gefühl, dass sie in den Augen der Herzogin im Grunde nicht gut genug für die Stühle waren, auf denen sie gesessen hatten.
David ging zum hohen Fenster am Ende des Wohnzimmers. Es war das einzige, dessen Vorhang aufgezogen war, und ging auf den gegenüberliegenden Berg hinaus. Oft starrte er auf die kahlen Felsnasen aus rissigem Kalkstein. Sie wirkten auf ihn wie Modelle menschlicher Gehirne, die man auf der dunkelgrün bewaldeten Bergflanke verteilt hatte, oder bisweilen auch wie ein einziges Hirn, das aus Dutzenden von Schnitten hervorquoll. Er setzte sich aufs Sofa neben dem Fenster, sah hinaus und versuchte ein primitives Gefühl der Ehrfurcht in sich zu wecken.
„Ein unvergleichliches Ensemble aus psychologischer Analyse und tiefem Entsetzen über menschliche Destruktivität.“
„Aus St Aubyns dichtem, sprachgewaltigen Geflecht liessen sich unzählige Fäden herauslösen. Die Romane, die ihre volle Kraft als Zyklus entfalten, sind zugleich Autobiografie, Chronik einer bitteren Abrechnung, Reflexion über Selbst und Sprachverlust, Abhandlung über Sprachmacht und Sprachlosigkeit und ein scharfzüngiges Porträt der englischen Oberklasse.“
„Bitter, ironisch, sprachlich wunderbar und voller Empathie sind seine Bücher.“





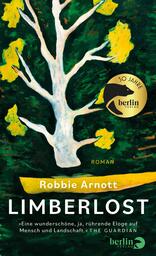


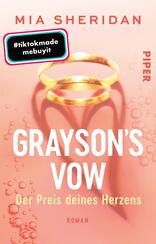


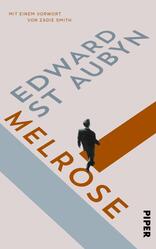


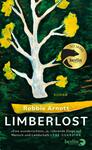
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.