
In Eiseskälte - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Ein bemerkenswerter Band.“
Sächsische ZeitungBeschreibung
Seine erste Winterbegehung der Shisha Pangma im Jahr 2005 war ein Meilenstein der Alpingeschichte. 2006 gelang ihm die erste Süd-Nord-Traverse des Mount Everest im Alleingang, und in der Wintersaison 2011/2012 folgten seine beiden bisher größten Erfolge: die erste Winterbegehung des Makalu und des Gasherbrum II im Alpinstil. Doch im Gegensatz zu anderen Profibergsteigern sammelt Simone Moro keine Achttausender: „Ich träume davon, etwas Neues zu machen. Abenteuer sind der Motor meines Alpinismus.“ Jetzt schildert der Extrembergsteiger erstmals für ein deutschsprachiges Publikum die Höhen und…
Seine erste Winterbegehung der Shisha Pangma im Jahr 2005 war ein Meilenstein der Alpingeschichte. 2006 gelang ihm die erste Süd-Nord-Traverse des Mount Everest im Alleingang, und in der Wintersaison 2011/2012 folgten seine beiden bisher größten Erfolge: die erste Winterbegehung des Makalu und des Gasherbrum II im Alpinstil. Doch im Gegensatz zu anderen Profibergsteigern sammelt Simone Moro keine Achttausender: „Ich träume davon, etwas Neues zu machen. Abenteuer sind der Motor meines Alpinismus.“ Jetzt schildert der Extrembergsteiger erstmals für ein deutschsprachiges Publikum die Höhen und Tiefen im Leben eines Ausnahmebergsteigers und seine leidenschaftliche Suche nach den letzten großen Herausforderungen des modernen Höhenbergsteigens.
Über Simone Moro
Aus „In Eiseskälte“
Ständig drückte ich mich vor dem Schreiben, immer hatte ich eine Menge zu tun, familiäre Verpflichtungen, Reisen, Projekte, Expeditionen und das Training. All dies erforderte Arbeit, Aufmerksamkeit und Energie und lieferte mir so ein unangreifbares Alibi dafür, dass ich keinesfalls eine Pause einlegen konnte, um mich an den Schreibtisch zu setzen und mit dem Schreiben zu beginnen; um meine Erinnerungen in Worte zu fassen, um mir vergangene Momente, Wochen, Monate und Jahre in der vertikalen Welt, all das, wovon ich seit meiner Kindheit geträumt habe, ins Gedächtnis [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Wer dieses Buch liest, wird kalte Hände und Füße bekommen. Warm anziehen also!“
Land der berge„Faszinierend und oftmals auch unbegreifbar ist diese Leidenschaft.“
(A) Tiroler Tageszeitung„Ein bemerkenswerter Band.“
Sächsische ZeitungProlog
WIE ICH DEN WINTERALPINIMUS FÜR
MICH ENTDECKTE
Cerro Mirador und Aconcagua
IM NAMEN ANATOLIS
Mount Everest und Pik Marmorwand
DER TRAUM, ZUM GREIFEN NAH
Shisha Pangma, erster Versuch
ENDLICH AUF DEM GIPFEL
Shisha Pangma, zweiter Versuch
MUT ZUM VERZICHT
Broad Peak
EIN WIRKLICH SCHÖNER BERG
Beka Brakai Chhok
DER SCHWARZE RIESE
Makalu
FAST UNMÖGLICH: DIE ULTIMATIVE EXPEDITION
Gasherbrum II
Nachwort
Versuche an den pakistanischen Achttausendern im Winter
Wintererstbesteigungen der Achttausender
Alpinistischer Werdegang
Karte
Dank
PROLOG








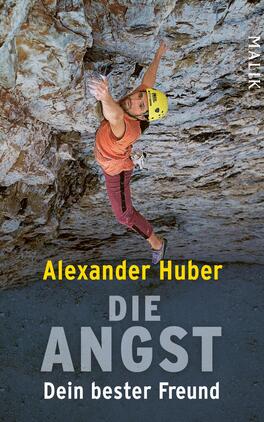
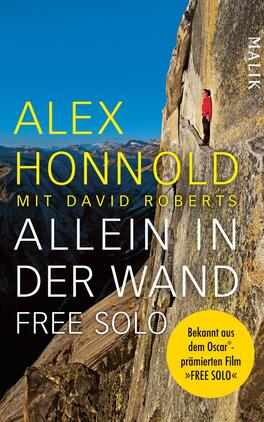


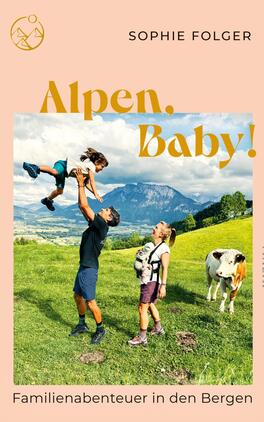





Die erste Bewertung schreiben