Produktbilder zum Buch
The Lies We Tell – Niemand ist ohne Schuld
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Wer auf großes Familiendrama, dunkle Geheimnisse und unterschwellige Spannung steht, der ist hier genau richtig.“
recensio-online.comBeschreibung
Ein Paar, das Geheimnisse hat. Ein Sohn, der einen Mord gesteht. Eine Nacht, die alles verändert.
Sarah und Tom haben gemeinsam ihre perfekte Familie gegründet, bis eine schreckliche Nacht ihre heile Welt für immer erschüttert: Ihr Sohn Freddy gesteht einen Mord. Nun müssen sie entscheiden, wie weit sie gehen, um ihr Kind zu schützen. Und wie weit sie gehen, um sich selbst zu schützen. Denn durch den Mord drohen düstere Geheimnisse ans Licht zu geraten, die beide jahrelang gemeinsam – und voreinander – verborgen haben. Während beide sich immer tiefer in Lügen verstricken, hat Sarah die…
Ein Paar, das Geheimnisse hat. Ein Sohn, der einen Mord gesteht. Eine Nacht, die alles verändert.
Sarah und Tom haben gemeinsam ihre perfekte Familie gegründet, bis eine schreckliche Nacht ihre heile Welt für immer erschüttert: Ihr Sohn Freddy gesteht einen Mord. Nun müssen sie entscheiden, wie weit sie gehen, um ihr Kind zu schützen. Und wie weit sie gehen, um sich selbst zu schützen. Denn durch den Mord drohen düstere Geheimnisse ans Licht zu geraten, die beide jahrelang gemeinsam – und voreinander – verborgen haben. Während beide sich immer tiefer in Lügen verstricken, hat Sarah die unverhoffte Gelegenheit, Freddy davonkommen zu lassen. Sie steht vor einer unmöglichen Entscheidung …
„Ein furchteinflößend guter Thriller“ Nicci French
Ein Thriller der sechsfache Sunday-Times-Bestsellerautorin Autorin Jane Corry. Sie war lange Journalistin und arbeitete drei Jahre als Writer-in-Residence eines Hochsicherheitsgefängnisses. Die Erfahrungen, die sie dort sammelte, inspirieren sie zu ihren hoch spannenden Psychothrillern.
„Alles, was ich an einem Buch liebe“ Lisa Jewell
Medien zu „The Lies We Tell – Niemand ist ohne Schuld“
Über Jane Corry
Aus „The Lies We Tell – Niemand ist ohne Schuld“
Regen.
Die Art, bei der dir die Haare am Kopf kleben.
Langeweile.
Die Art, bei der du dafür SORGEN WILLST, dass etwas passiert.
Andere Leute lachen.
Die Art, bei der du mit einstimmen willst.
Um gemocht zu werden.
Was immer du dafür tun musst.
Sarah
Freddie sollte mittlerweile zu Hause sein.
„Um Mitternacht, keine Sekunde später“, hatte ich mit ihm vereinbart. Ihn angefleht, genauer gesagt.
Darauf hatten wir uns nach einem kurzen Disput geeinigt, bevor unser Sohn in seiner Denim-Jeans im Used-Look, schmuddeligen Sportschuhen und einem fadenscheinigen weißen T-Shirt, auf das [...]
Pressestimmen
„Der Schreibstil ist flüssig, bildstark und steckt voller Emotionen. Es ist eine ruhige, dramatische Geschichte, die mich nachdenklich gemacht hat und nachhallt.“
nadine_dietz„Die Autorin Jane Corry liefert uns mit diesem Buch ein großes Familiendrama voller Lügen, Spannung und Betrug. Ich war von der ersten Seite an gefesselt und habe dieses Buch insgesamt wirklich sehr genossen!“
laylasbuecherwelt„Was begeistert, sind die zahlreichen unerwarteten Wendungen, die einen beim Lesen kalt erwischen und die Entwicklung, die die Figuren durchlaufen.“
StadtRadio Göttingen „Book's n' Rock's“„Eine dramatische Geschichte voller Emotionen, die sehr nachdenklich stimmt und sich schnell zum Thriller auswächst. Absolut furchteinflößend und mitreißend!“
Mainhattan Kurier„Ein Buch, das nicht loslässt und noch lange nach dem Weglegen in den Gedanken des Lesers verweilt.“
CarpeGusta - Das Magazin für Genießer„Wer auf großes Familiendrama, dunkle Geheimnisse und unterschwellige Spannung steht, der ist hier genau richtig.“
recensio-online.com
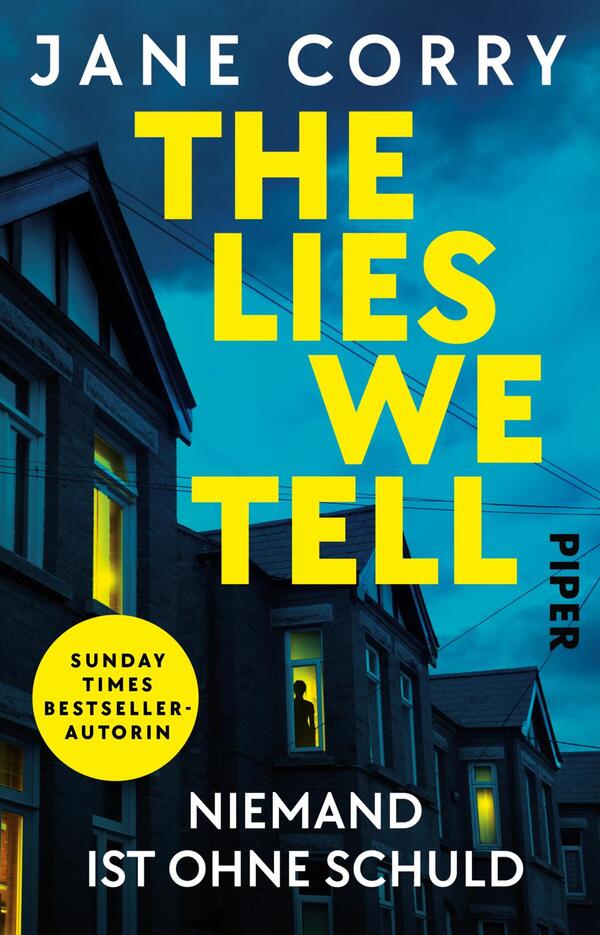
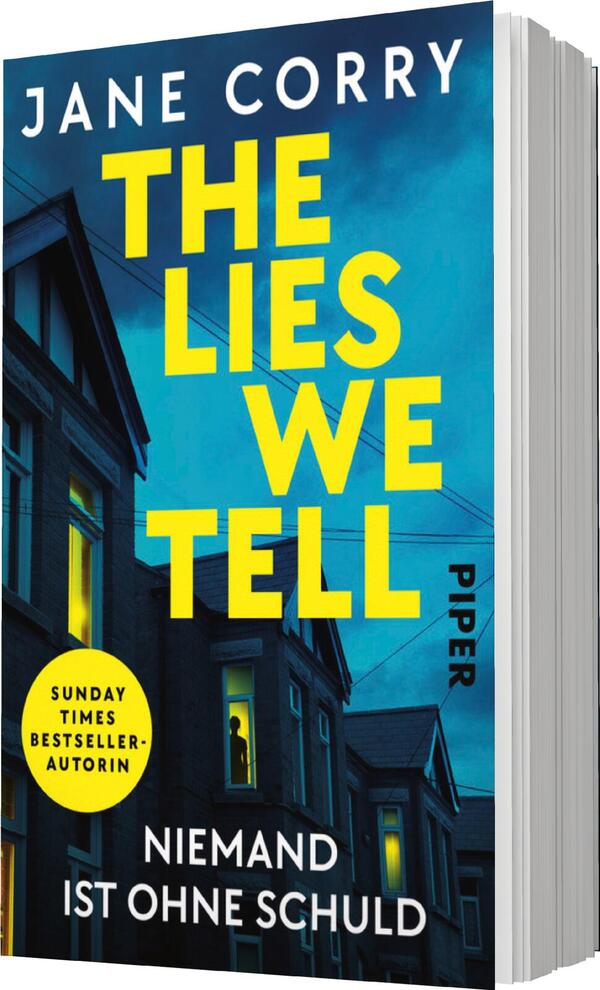
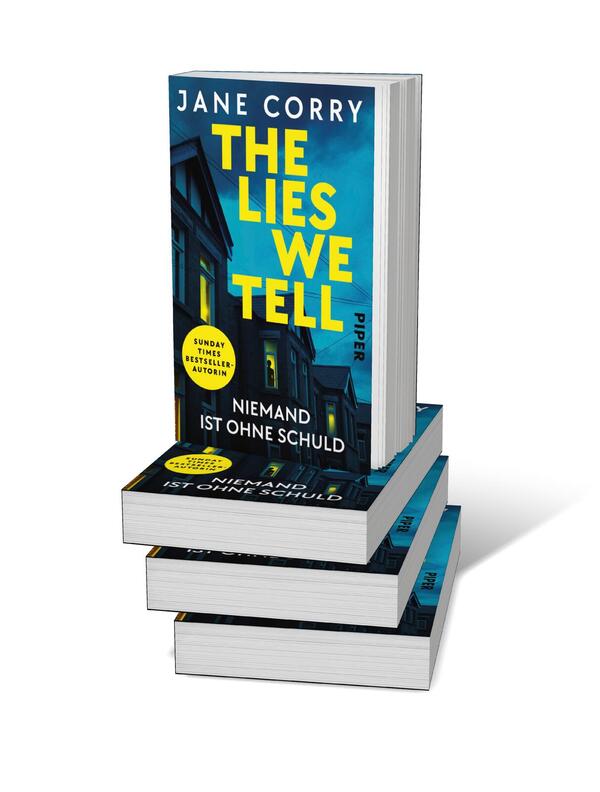













Die erste Bewertung schreiben