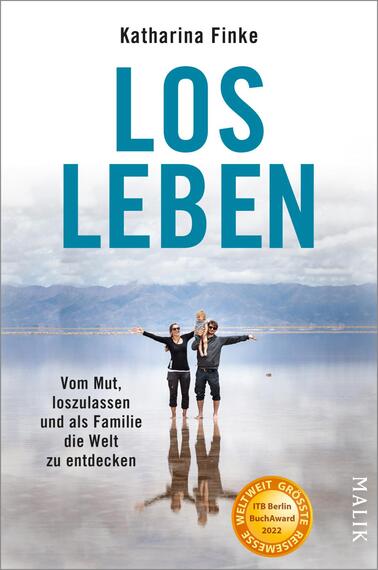
Losleben - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Vom Mut, als Familie zu reisen, und der Freiheit, die eigenen Träume zu verfolgen
Sieben Jahre lang reist Katharina Finke ohne festen Wohnsitz und nur mit dem Nötigsten ausgestattet als Journalistin um die Welt. Als sie mit ihrem Freund David in Südostasien unterwegs ist, stellt sie fest, dass sie schwanger ist. Bei aller Freude fragt sie sich auch: Ist Elternsein mit einem Leben auf Reisen und mit Konsumverzicht vereinbar? Was bedeutet es, die eigene Freiheit aufzugeben und die stärkste aller möglichen Bindungen einzugehen?
Katharina Finke erzählt von ihrer turbulenten Schwangerschaft, den…
Vom Mut, als Familie zu reisen, und der Freiheit, die eigenen Träume zu verfolgen
Sieben Jahre lang reist Katharina Finke ohne festen Wohnsitz und nur mit dem Nötigsten ausgestattet als Journalistin um die Welt. Als sie mit ihrem Freund David in Südostasien unterwegs ist, stellt sie fest, dass sie schwanger ist. Bei aller Freude fragt sie sich auch: Ist Elternsein mit einem Leben auf Reisen und mit Konsumverzicht vereinbar? Was bedeutet es, die eigene Freiheit aufzugeben und die stärkste aller möglichen Bindungen einzugehen?
Katharina Finke erzählt von ihrer turbulenten Schwangerschaft, den Reisen mit Kind und dem Mut, sich als Familie von festgefahrenen Denkweisen zu lösen. Sie berichtet, wie das Muttersein vieles verändert und ein ganz neues Glück mit sich bringt: das Abenteuer, gemeinsam frei zu sein.
Über Katharina Finke
Aus „Losleben“
PROLOG
Berlin Flughafen Schönefeld. Wie fast immer mit dabei: mein Rucksackrollkoffer, den ich beim Einchecken aufgegeben habe, und mein schwarzer Rucksack. Ich trage ihn auf dem Rücken über meinem Wollmantel. Der ist grau, genau wie das Wetter in Berlin. Einen Schal brauche ich trotz der Kälte nicht, denn der vordere Teil meines Körpers wird von etwas beziehungsweise jemand anderem gewärmt: meiner Tochter Yva. Ich habe sie mir in einer Babytrage umgebunden. Während Yvas Papa David den Kinderwagen beim Sperrgepäck aufgibt, probieren wir im Duty-Free-Bereich [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Prolog
Bangla Baby
Bohei Berlin
Wie früher, nur anders
Leben aus dem Koffer
Weiterreisen
Hoch hinaus
Drama Lama
Dulce de Leche
Basis in Berlin
Da sein
Dank




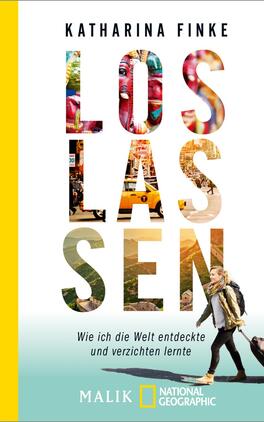





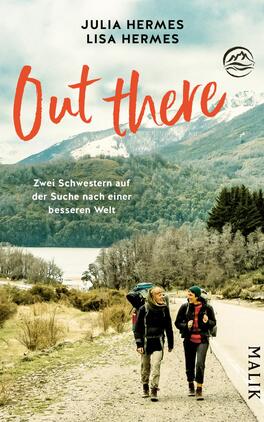
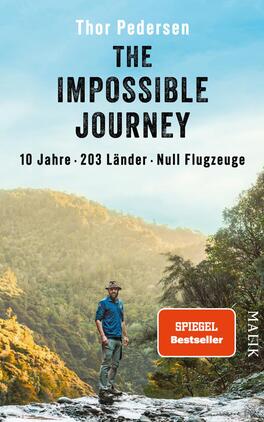


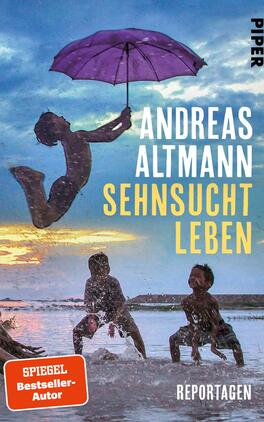
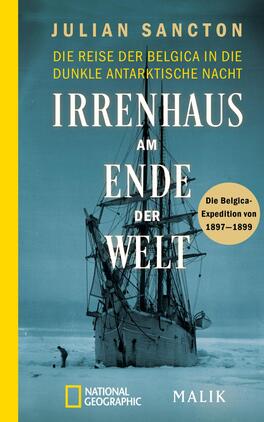



Die erste Bewertung schreiben