
Der Riss im Raum (Reise durch die Zeit 2) - eBook-Ausgabe
Der Riss im Raum (Reise durch die Zeit 2) — Inhalt
Kaum sind Meg, ihr Bruder Charles Wallace und Calvin von ihrer Reise durchs Universum zurückgekehrt, wartet auch schon das nächste Abenteuer. Charles ist davon überzeugt, dass im Gemüsebeet Drachen hausen. Meg glaubt, dass Charles' Fantasie nach den Strapazen in der Schule etwas mit ihm durchgeht. Charles' Mitschüler können nämlich nichts mit seinem Genie anfangen und mobben ihn. Als im Garten aber tatsächlich ein Cherub und sein Lehrmeister auftauchen, wird klar, dass nicht nur Charles' Leben sondern auch das Gleichgewicht des Universums gerettet werden muss: Meg und Calvin kämpfen erneut gegen die Dunkelheit und stellen fest, dass selbst ein Kampf auf der kleinsten Ebene den Ausschlag gibt, ob das Universum noch gerettet werden kann ...
Leseprobe zu „Der Riss im Raum (Reise durch die Zeit 2)“
Charles Wallace und die Drachen
„Im Gemüsegarten der Zwillinge sind Drachen.“
Meg Murry war soeben aus der Schule gekommen; ihr Kopf steckte im Kühlschrank, wo sie nach Essbarem forschte. Überrascht blickte sie ihren sechsjährigen Bruder an. „Was sagst du da?“
„Im Gemüsegarten der Zwillinge sind Drachen. Besser gesagt: Dort waren sie. Jetzt dürften sie auf der oberen Wiese sein.“
Meg erwiderte nichts darauf. Es war nie ratsam, auf eine ungewöhnliche Bemerkung von Charles Wallace mit einer vorschnellen Antwort zu reagieren. Sie wandte sich wieder dem [...]
Charles Wallace und die Drachen
„Im Gemüsegarten der Zwillinge sind Drachen.“
Meg Murry war soeben aus der Schule gekommen; ihr Kopf steckte im Kühlschrank, wo sie nach Essbarem forschte. Überrascht blickte sie ihren sechsjährigen Bruder an. „Was sagst du da?“
„Im Gemüsegarten der Zwillinge sind Drachen. Besser gesagt: Dort waren sie. Jetzt dürften sie auf der oberen Wiese sein.“
Meg erwiderte nichts darauf. Es war nie ratsam, auf eine ungewöhnliche Bemerkung von Charles Wallace mit einer vorschnellen Antwort zu reagieren. Sie wandte sich wieder dem Kühlschrank zu. „Ach ja, Tomaten und Kopfsalat. Und ich hatte schon gehofft, es gibt zur Abwechslung einmal etwas atemberaubend Neues.“
„Meg, hörst du mir überhaupt zu?“
„Natürlich höre ich dir zu. Hm, ich nehme doch lieber Leberwurst und Streichkäse.“
Sie holte außerdem eine frische Milchpackung aus dem Kühlschrank und stellte alles auf den Tisch.
Charles Wallace wartete geduldig.
Bei seinem Anblick wurde sie wider Willen ärgerlich: Der Riss in den Jeans, gleich über dem Knie, war brandneu. Das Hemd hatte satte Schmutzspuren und die Beule unter dem linken Auge nahm allmählich eine dunkle Färbung an.
„Also, wann haben die großen Jungs dich denn heute erwischt?“, schnaubte Meg. „Erst auf dem Schulhof oder gleich, als du aus dem Bus kamst?“
„Meg, du hörst mir nicht zu.“
„Tut mir leid, aber ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Jetzt bist du knapp zwei Monate in der Schule, und keine einzige Woche vergeht, ohne dass dich jemand windelweich prügelt. Kein Wunder, wenn du zum Beispiel überall erzählst, dass in unserem Garten angeblich Drachen herumspazieren.“
„Tu ich doch gar nicht. Hältst du mich denn für blöd? Außerdem habe ich die Drachen erst jetzt entdeckt.“
Meg konnte rasch zornig werden, wenn sie etwas aus der Fassung brachte. Nun ließ sie ihre Wut an dem Sandwich aus: „Wann kauft Mom endlich ordentlichen Käse? Dieses harte Zeug lässt sich beim besten Willen nicht aufs Brot streichen. – Wo ist sie eigentlich?“
„Im Labor. Sie hat ein Experiment laufen; ich soll dir sagen, dass sie bald kommt.“
„Und Dad?“
„L. A. hat angerufen und daraufhin musste Dad für ein paar Tage nach Washington.“
Dass er so oft ins Weiße Haus gerufen wurde, blieb in der Schule am besten ebenso unerwähnt wie die Drachen im Garten. Der einzige Unterschied war, dass Dads Dienstreisen nicht auf reiner Einbildung beruhten.
Charles Wallace spürte Megs Zweifel. „Wenn ich die Drachen aber doch gesehen habe!“, beharrte er. „Sobald du gegessen hast, kannst du dich selbst davon überzeugen.“
„Wo sind Sandy und Dennys?“
„Beim Fußballtraining. Außer dir habe ich noch keinem etwas davon erzählt.“ Auf einmal wirkte er hilflos wie ein kleines Kind: „Warum kommt dein Schulbus erst so spät? Ich habe ewig auf dich gewartet.“
Meg holte nun doch den Salat aus dem Kühlschrank. Genau genommen wollte sie nur Zeit zum Überlegen gewinnen – obwohl Charles Wallace ihre Gedanken jetzt ebenso erriet wie zuvor ihre Zweifel an der Existenz der Drachen.
Was hatte er da draußen bloß gesehen? Äußerst ungewöhnlich musste es jedenfalls gewesen sein, so viel stand fest.
Charles Wallace sah schweigend zu, wie sie die Brote strich, beide Scheiben exakt Kante an Kante aufeinanderlegte und sie in genau gleiche Streifen schnitt. „Ich frage mich, ob Herr Jenkins jemals Drachen sehen könnte.“
Jenkins war der Leiter der örtlichen Grundschule und Meg hatte ihre Schwierigkeiten mit ihm. Von Jenkins war kaum zu erwarten, dass ihn die Leiden von Charles Wallace kümmerten oder dass er bereit war, in eine Entwicklung einzugreifen, die seiner Meinung nach nur „ein gesunder demokratischer Prozess“ war.
„Jenkins glaubt an das Gesetz des Dschungels“, sagte sie mit vollem Mund. „Gibt es eigentlich Drachen im Dschungel?“
Charles Wallace trank seine Milch aus. „Kein Wunder, dass du in Naturkunde so schwach bist! Jetzt iss endlich und hör auf, herumzutrödeln. Wir wollen doch nachsehen, ob die Drachen noch da sind.“
Sie gingen über die Wiese. Fortinbras, der große schwarze Hund, kam mit und schnüffelte und scharrte genüsslich an den herbstlichen Überresten im Rhabarberbeet herum. Meg stolperte über ein Krockettor und schnaubte ärgerlich, denn sie selbst hatte nach dem letzten Match die Schläger und Tore weggeräumt und dieses eine offenbar übersehen.
Eine Reihe Berberitzen trennte den Krocketrasen vom Gemüsegarten der Zwillinge Sandy und Dennys.
Fortinbras sprang über die Hecke. Meg rief automatisch: „Nicht in den Garten, Fort!“, und der große Hund trat zwischen Kohlköpfen und Brokkoli vorsichtig den Rückzug an. Die Zwillinge waren mit Recht stolz auf ihr Grünzeug, das sie im Dorf verkauften, um sich ihr Taschengeld aufzubessern.
„Ein Drache könnte hier gewaltigen Schaden anrichten“, stellte Charles Wallace fest und ging voran durch die Gemüsebeete. „Ich glaube, das wurde ihm auch bewusst, denn auf einmal war er irgendwie fort.“
„Was heißt, er war irgendwie fort? Entweder war er da oder er war nicht da.“
„Er war da; aber als ich näher kam, verschwand er. Also ging ich ihm nach – vielmehr: Ich folgte ihm dorthin, wo er sich verzogen hatte, zu den beiden Felsen auf der oberen Wiese.“
Meg blickte sich misstrauisch im Garten um. Noch nie hatte Charles Wallace derart Unglaubliches behauptet.
„Komm!“, forderte er sie auf und zwängte sich an den Maisstauden vorbei, die schon ziemlich zerrupft dastanden. Dahinter reckten die Sonnenblumen ihre braungoldenen Blütenkränze der tief stehenden Nachmittagssonne entgegen.
„Charles, ist etwas mit dir nicht in Ordnung?“, fragte Meg. Dass er die seltsamsten Dinge erkennen konnte, wusste sie; aber noch nie hatte er die Grenzen zwischen Wirklichkeit und reiner Einbildung verkannt. Auch bemerkte sie erst jetzt, wie schwer und stoßweise er atmete, als sei er gelaufen – dabei waren sie doch eher geschlendert. Sein Gesicht wirkte blass, auf seiner Stirn standen Schweißtropfen, wie nach übermäßiger Anstrengung. Sein Aussehen gefiel ihr gar nicht. Aber zunächst war diese seltsame Geschichte zu klären.
„Charles, wann hast du die vermeintlichen Drachen gesehen?“
„Es war eine ganze Herde. Oder sagt man: eine Schar? Ein Rudel?“ Er keuchte heftig. „Als ich von der Schule kam. Mom war einigermaßen nervös, weil ich so ramponiert aussah. Außerdem blutete ich stark aus der Nase.“
„Mich machst du auch einigermaßen nervös.“
„Ja, Meg, aber Mom geht es dabei nicht nur um die Großen, die mich verdreschen.“
„Sondern?“
Charles Wallace hatte Mühe, über die Steinmauer zu klettern, die den Obstgarten umgab; er wirkte geradezu ungeschickt.
„Sie macht sich Sorgen, weil ich so schnell außer Atem komme.“
„Und worauf führt sie das zurück?“, fragte Meg ängstlich.
Charles schlurfte langsam durch das hohe Gras. „Sie spricht mit mir nicht darüber. Ich nehme bloß ihre – ihre unbewussten Signale auf.“
Sie gingen jetzt Seite an Seite. Meg war groß für ihr Alter, er klein für das seine; sie gaben ein ungleiches Paar ab.
„Manchmal glaube ich, es wäre besser, du würdest nicht so empfänglich für diese Signale sein.“
„Das klappt nicht. Ich tu’s doch nicht mit Absicht, Meg. Es kommt ganz von selbst. Mom meint, irgendetwas ist mit mir nicht in Ordnung.“
„Aber was?“, rief sie.
„Das weiß ich nicht.“ Charles sprach ganz leise. „Jedenfalls ist es so arg, dass ihre Angstsignale voll zu mir herüberkommen. Und ich spüre ja selbst, dass mit mir etwas nicht stimmt. Es ist schon anstrengend, so wie jetzt durch den Garten zu gehen, und das ist bedenklich. Diese Beschwerden hatte ich noch nie.“
„Seit wann spürst du sie?“, wollte Meg wissen. „Bei unserer Wanderung am Wochenende warst du doch noch ganz fit.“
„Stimmt. Also, ich bin schon den ganzen Herbst irgendwie – müde; aber wirklich schlimm wurde das erst im Lauf der Woche; und heute geht es mir wesentlich schlechter als gestern … He, Meg, hör auf, dir Vorwürfe zu machen, weil du bisher nichts bemerkt hast!“
Wieder hatte er ihre Gedanken erraten! Plötzlich wurde ihr ganz kalt vor Angst, und rasch versuchte sie, dieses Gefühl wieder abzuschütteln, denn Charles konnte in ihren Empfindungen noch deutlicher lesen als in Moms Sorgen.
Er hob einen Apfel auf, der im Gras lag, versicherte sich, dass er nicht wurmig war, und biss herzhaft hinein.
Die Sonnenbräune täuschte; sein Teint war fahl. Warum waren ihr auch nie die Schatten unter seinen Augen aufgefallen? Weil sie alle Symptome absichtlich übersehen hatte! Es war bequemer gewesen, seine Blässe und die Lethargie den Problemen zuzuschreiben, die er seit dem Schuleintritt hatte.
„Warum fragt Mom nicht einen Arzt?“
„Hat sie doch schon.“
„Wann?“
„Heute.“
„Und das sagst du mir erst jetzt?“
„Die Drachen waren mir wichtiger.“
„Charles!“
„Bevor du von der Schule gekommen bist, war Dr. Louise Colubra bei uns und aß mit Mom zu Mittag. Sie taucht in letzter Zeit übrigens häufig auf …“
„Weiß ich doch. Weiter!“
„Tja, sie nahm mich von Kopf bis Fuß unter die Lupe.“
„Und was sagt sie?“
„Nicht viel. Ich kann sie nämlich nicht so ohne Weiteres durchschauen wie Mom. Sie ist wie ein kleiner Vogel: Ständig flattern ihre Gedanken hin und her. Dabei spüre ich genau, dass ihr messerscharfer Verstand pausenlos im Einsatz bleibt – sozusagen auf einer anderen Ebene. Dr. Louise versteht es ausgezeichnet, sich von mir abzublocken. Ich bekam nicht mehr heraus, als dass sie Moms Verdacht im Grunde bestätigt – und den kenne ich nicht. Immerhin versprach Dr. Louise, sich wieder zu melden.“
Sie hatten indessen den Obstgarten durchquert, und Charles Wallace kletterte wieder auf die Mauer, um Ausschau zu halten. Auf der anderen Seite lag die große obere Wiese – ein Stück Land, das sich selbst überlassen blieb und aus dem zwei große Urgesteinsbrocken ragten.
„Sie sind fort“, stellte er fest. „Meine Drachen sind nicht mehr da.“
Auch Meg war auf die Mauer geklettert und stand jetzt neben ihm. Nichts Auffälliges war zu erkennen. Der Wind blies Wellen ins sonnengebleichte Gras; der nackte Fels der beiden Klippen leuchtete rostrot in der untergehenden Sonne.
„Hast du nicht vielleicht bloß ein paar Steine gesehen? Oder Schatten?“
„Sehen Steine oder Schatten wie Drachen aus?“
„Nein, aber …“
„Meg, sie standen dort drüben, zwischen den Felsen. Dicht aneinandergedrängt; ein einziger Klumpen von Flügeln, ja, von Hunderten Flügeln. Und dazwischen viele, viele Augen, aus denen sie mich anblinzelten. Und ein bisschen Rauch und ein paar kleine Flammen. Ich rief den Drachen zu, sie sollten vorsichtig sein und nicht das Gras anzünden.“
„Und?“
„Sofort hörten sie auf, Feuer zu spucken.“
„Bist du zu ihnen hinübergelaufen?“
„Das schien mir nicht ratsam. Ich blieb hier auf der Mauer und habe die Drachen lange beobachtet. Sie schlugen ständig mit den Flügeln und guckten mich aus ihren zahllosen Augen an. Und dann scharten sie sich irgendwie enger aneinander, als wollten sie schlafen gehen. Da habe ich mich zurückgezogen und im Haus auf dich gewartet. – Meg, du glaubst mir noch immer nicht.“
Sie fragte rundheraus: „Kannst du mir die Drachen zeigen? Wo sind sie?“
„Du hast mir von allem Anfang an nicht geglaubt.“
Meg wählte ihre Worte mit Bedacht. „Wer sagt, dass ich dir nicht glaube?“ Irgendwie, so seltsam das auch sein mochte, musste ja an der Sache etwas Wahres dran sein. Zwar hatte Charles Wallace bestimmt keine Drachen gesehen, aber trotzdem blieb zu bedenken, dass er sonst nie Realität und Fantasie derart durcheinanderbrachte …
Er trug jetzt ein Sweatshirt über seinem schmutzigen Hemd. Meg tat so, als sei ihr plötzlich kalt. Bibbernd kreuzte sie die Arme vor der Brust und sagte: „Ich laufe schnell ins Haus und hole eine Jacke. Bleib solange hier; ich bin gleich wieder da. Und falls inzwischen die Drachen wiederkommen …“
„Sie kommen bestimmt!“
„… dann halte sie auf, bis ich zurück bin. Ich werde mich beeilen.“
Charles Wallace blickte sie offen an. „Ich glaube nicht, dass Mom bei ihrer Arbeit gestört werden möchte.“
„Ich habe nicht die Absicht, sie zu stören. Ich hole mir bloß eine Jacke.“
„Na schön, Meg“, sagte er und seufzte.
Sie ließ ihn auf der Mauer sitzen, auf die beiden Felsen starren und auf die Drachen – oder sonstigen Geschöpfe – warten, die er angeblich gesehen hatte. Es war ihm also nicht entgangen, dass sie nur zum Haus zurückwollte, um mit Mom zu sprechen. Auch gut. Solange sie nicht ausdrücklich zugeben musste, dass sie sich um Charles Sorgen machte, merkte er vielleicht nichts davon; zumindest konnte sie sich das einreden.
Meg platzte ins Labor.
Ihre Mom saß auf einem hohen Hocker vor dem Mikro-Elektronenmikroskop, blickte aber weder durchs Okular noch trug sie in die Schreibkladde, die auf ihren Knien lag, Beobachtungen ein. Sie saß einfach da und dachte angestrengt nach.
„Was willst du, Meg?“
In aller Eile berichtete sie, was Charles Wallace ihr aufgetischt hatte, obwohl er sich doch sonst nie kindischen Illusionen hingab. Sie gestand auch, sich wie eine Verräterin zu fühlen, weil sie etwas preisgab, was Charles selbst Mom noch nicht erzählt hatte; andererseits konnte das auch an Dr. Louises Anwesenheit gelegen haben …
„Was willst du, Meg?“, wiederholte Frau Murry etwas ungeduldig.
„Ich will wissen, was mit Charles Wallace los ist.“
Megs Mom legte den Schreibblock neben das Mikroskop auf den Tisch. „Charles hatte heute wieder einmal Krach mit seinen Mitschülern.“
„Aber das meine ich doch nicht!“
„Was meinst du denn, Meg?“
„Er sagt, du hättest seinetwegen Dr. Colubra gerufen.“
„Louise kam zum Mittagessen. Da bot sich die Gelegenheit geradezu an, ihn ein wenig zu untersuchen.“
„Und?“
„Und – was, Meg?“
„Was fehlt ihm?“
„Das wissen wir nicht, Meg. Zumindest: noch nicht.“
„Charles sagt, du machst dir große Sorgen um ihn.“
„Stimmt. Du doch auch?“
„Ja. Aber ich dachte bis jetzt, das sei alles nur darauf zurückzuführen, dass er sich in der Schule so schwer einlebt. Jetzt glaube ich das nicht mehr. Schon wenn er durch den Obstgarten geht, kommt er in Atemnot. Und er ist blass. Und er fantasiert. Mir gefällt gar nicht, wie er aussieht.“
„Mir gefällt es auch nicht, Meg.“
„Was hat er? Was fehlt ihm? Ist es ein Virus?“
Frau Murry zögerte. „Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen.“
„Mom, bitte! Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Du kannst mir offen sagen, ob Charles ernsthaft krank ist.“
„Ich weiß nicht, ob er das ist. Auch Louise weiß es nicht. Aber ich verspreche dir, dich zu informieren, sobald wir Genaueres herausbekommen haben.“
„Du verheimlichst mir doch nichts?“
„Meg, es hat keinen Sinn, über Dinge zu sprechen, die mir selbst noch nicht klar sind. In ein paar Tagen weiß ich wahrscheinlich mehr.“
Meg presste nervös die Handflächen aneinander. „Du machst dir schreckliche Sorgen.“
Frau Murry lächelte. „Das haben Mütter so an sich. – Wo ist Charles jetzt?“
„Er wartet bei der Mauer auf mich. Ich tat so, als wollte ich mir bloß eine Jacke holen. Darum muss ich auch gleich wieder zu ihm, sonst glaubt er womöglich noch …“
Ohne den Satz zu beenden, verließ Meg das Labor, schnappte sich im Flur eine Jacke vom Garderobenhaken und rannte über den Rasen.
So, wie sie ihn verlassen hatte, saß Charles Wallace noch immer auf der Mauer. Weit und breit waren keine Drachen zu sehen. Das hatte sie auch nicht ernsthaft erwartet. Dennoch war sie ein wenig enttäuscht, denn ihre Angst um Charles war jetzt umso begründeter.
„Was sagt Mom?“, fragte er.
„Nichts.“
Seine großen, durchdringend blauen Augen saugten sich an ihr fest. „Schob sie es nicht auf meine Mitochondrien? Oder auf die Farandolae?“
„Wie bitte? Warum hätte sie das tun sollen?“ Charles Wallace ließ die Beine baumeln, schlug mit den Schuhsohlen gegen die Mauer, blickte Meg unergründlich an und blieb ihr die Antwort schuldig.
„Warum sollte Mom von Mitro… – Mitochondrien sprechen?“, wiederholte sie beharrlich. „Oh, jetzt fällt es mir wieder ein! Haben die dich nicht schon am ersten Schultag in Schwierigkeiten gebracht?“
„Ich interessiere mich sehr für sie. Und für Drachen. Schade, dass sie noch nicht wiedergekommen sind.“ Er wollte ohne Zweifel das Thema wechseln. „Warten wir noch ein bisschen. Mit Drachen nehme ich es jedenfalls immer noch lieber auf als mit diesen schrecklichen Jungen in der Schule. Übrigens: Vielen Dank, dass du meinetwegen mit Herrn Jenkins gesprochen hast.“
Das hätte ein streng gehütetes Geheimnis bleiben sollen. „Wie hast du denn das wieder erfahren?“
„Eben so.“
Meg fasste an ihre Schultern. „Leider kam nicht viel dabei heraus.“ Das hatte sie allerdings auch kaum erwartet. Herr Jenkins war jahrelang der Leiter von Megs Gymnasium gewesen. Offiziell hatte man seine jüngste Versetzung an die unbedeutende Grundschule damit begründet, auch die ersten Klassenstufen müssten aufgewertet werden und er sei der geeignetste Mann für diese Aufgabe. Es ging aber das Gerücht herum, er sei bloß mit den Rowdies an seiner alten Schule nicht mehr fertiggeworden. Meg traute ihm überhaupt nicht zu, jemals mit irgendjemandem fertigwerden zu können, und sie war fest davon überzeugt, dass er Charles Wallace weder verstand noch mochte.
An dem Tag, an dem Charles Wallace in die erste Klasse kam, war Meg noch nervöser gewesen als er. Sie konnte sich nicht auf den Unterricht konzentrieren. Als die Schule endlich überstanden war und sie den Hügel zum Haus hinaufgerannt kam, traf sie Charles mit einer aufgeplatzten und blutenden Lippe an. Das Unvermeidliche war geschehen und ihre tiefe Entmutigung mischte sich mit brennendem Zorn.
Im Dorf hatte man Charles schon immer für etwas seltsam und nicht ganz bei Trost gehalten. Wenn Meg die Briefe vom Postamt oder Eier aus dem Laden holte, schnappte sie gelegentlich Gesprächsfetzen auf: „Der kleine Murry ist aber ein komischer Junge!“ – „Ja, gerade die gescheitesten Leute haben oft die dümmsten Kinder.“ – „Angeblich kann er noch nicht einmal sprechen!“
Das alles hätte sich hinnehmen lassen, wäre Charles Wallace tatsächlich ein Blödian gewesen. Aber das war er eben nicht; er war bloß unfähig, seinen Wissensvorsprung vor den anderen Sechsjährigen in der Klasse zu verbergen. Allein sein Wortschatz sprach gegen ihn. Charles hatte tatsächlich erst sehr spät zu sprechen begonnen, aber dann gleich in ganzen Sätzen und ohne das übliche Kleinkindergeplapper. In Gegenwart Fremder war er nach wie vor schweigsam – einer der Gründe, warum man ihn für zurückgeblieben hielt. Und auf einmal redete dieser Erstklässler wie ein Erwachsener, wie seine Eltern oder seine Schwester! Sandy und Dennys, die Zwillinge, kamen mit allen Leuten zurecht. Kein Wunder, dass man Charles überall ablehnte: Erst hatte man ihn für einen Idioten gehalten und jetzt plauderte er wie ein wandelndes Lexikon.
„Meine lieben Kinder!“, hatte sich die Lehrerin mit gewinnendem Lächeln am ersten Morgen an die kichernde Schar gewandt.
„Ich möchte, dass mir jeder von euch etwas über sich erzählt.“ Sie blickte auf die Namensliste. „Beginnen wir mit Mary Agnes. Wer von euch ist Mary Agnes?“
Ein kleines Mädchen mit Zahnlücken und straff geflochtenen blonden Zöpfchen piepste, sie wohne auf einem Bauernhof, versorge dort selbst einige Hühner und die hätten heute siebzehn Eier gelegt.
„Sehr schön, Mary Agnes! Und jetzt zu dir, Richard – oder sagt man daheim Dicky zu dir?“
Ein fetter Knirps stand auf, nickte heftig und grinste.
„Nun, was willst du uns Hübsches erzählen?“
„Jungen sind nicht wie Mädchen“, legte Dicky los. „Sie sind anders gebaut, weil sie nämlich …“
„Ausgezeichnet, Dicky, ganz ausgezeichnet! Darüber werden wir später noch mehr lernen. Als Nächste kommt Albertina an die Reihe.“
Albertina wiederholte die erste Klasse. Als sie aufstand, überragte sie die anderen um einen Kopf. Stolz leierte sie: „Unser Körper ist aus Haut und Knochen gemacht, aus Muskeln und Blut – und noch viel mehr.“
„Hervorragend, Albertina! Ist das nicht eine prima Klasse? Ich sehe schon, dass wir diesmal eine ganze Menge Wissenschaftler unter uns haben. – So, und jetzt …“ Wieder blickte sie auf ihre Liste. „Hm, Charles Wallace. Soll ich dich Charly nennen?“
„Nein“, erwiderte er. „Charles Wallace, wenn ich bitten dürfte.“
„Deine Eltern sind doch wirkliche Wissenschaftler, nicht wahr?“ Sie erwartete keine Antwort. „Nun, dann wollen wir einmal hören, was du uns zu berichten hast.“
Charles Wallace stand auf – („Warum konntest du dich nicht ein bisschen zurückhalten?“, hatte ihm Meg an jenem Abend vorgeworfen) – und sagte: „Im Augenblick interessiere ich mich vor allem für Farandolae und Mitochondrien.“
„Wie war das, Charles? Nitrowas?“
„Mitochondrien. Sie und die Farandolae sind im Protoplasma tierischer und pflanzlicher Zellen zu finden.“
„Worin?“
„Im Protoplasma. Sie tragen die Enzyme der Zellatmung, und mich beeindruckt immer mehr, dass trotz ihrer mikroskopisch winzigen Größe unser gesamter Sauerstoffhaushalt von ihnen abhängt.“
„Nun aber Schluss, Charles! Hör auf, dummes Zeug zu faseln. Wenn ich dich das nächste Mal aufrufe, solltest du nicht versuchen, so anzugeben. – Und nun wird uns George ein wenig von sich erzählen …“
Am Ende der zweiten Schulwoche war Charles Wallace am Abend in Megs Dachkammer gekommen.
„Charles!“, hatte sie zu ihm gesagt. „Kannst du nicht einfach den Mund halten?“
Charles Wallace trug seinen gelben Kleinkinderpyjama, hatte frisches Heftpflaster auf seinen Wunden, lag mit geschwollener Stupsnase am Fußende ihres geräumigen Messingbetts und benutzte die wohlig warme schwarze Masse des Hundes als Kopfkissen. Charles wirkte müde und lustlos, aber das war ihr an jenem Abend noch nicht aufgefallen.
„Das funktioniert nicht“, maulte er. „Gar nichts funktioniert. Bin ich still, heißt es, ich soll nicht schmollen. Kaum sage ich aber etwas, ist es schon falsch. Mit dem Arbeitsheft bin ich durch – die Lehrerin behauptet, du müsstest mir dabei geholfen haben –, und die Texte aus dem Lesebuch kenne ich längst auswendig.“
Meg hatte die Knie mit den Armen umfasst. Nachdenklich betrachtete sie ihren Bruder und den Hund. Fortinbras hatte auf Betten nichts zu suchen, doch diese Regel wurde in der Dachkammer großzügig übersehen. „Warum lässt man dich nicht in die zweite Klasse aufrücken?“
„Du lieber Himmel! Die Kinder dort sind ja noch größer.“
Allerdings. Das stimmte.
Also hatte Meg sich entschlossen, Herrn Jenkins einen Besuch abzustatten. Eines Morgens – es war ein grauer, unfreundlicher Tag und am Himmel kündigte sich ein Sturm an – nahm sie, wie alle Tage, um sieben Uhr ihren Bus. Der zur Dorfschule kam erst eine Stunde später; der musste ja auch nicht so weit fahren. An der ersten Haltestelle im Ort stieg sie wieder aus und ging die letzten drei Kilometer zu Fuß. Die Schule war in einem alten, heruntergekommenen Gebäude untergebracht, dessen Fassade man einfach rot angepinselt hatte, um es nach außen hin besser wirken zu lassen – was aber zum Beispiel nichts am krassen Lehrermangel änderte.
Meg schlüpfte zum Seiteneingang hinein, den der Hausmeister meist früher öffnete. In der Eingangshalle, deren Türen noch verschlossen waren, summte die elektrische Bohnermaschine. Das Geräusch war so laut, dass Meg ungehört durch die Halle huschen und in einer engen Besenkammer Zuflucht finden konnte. Dort drinnen drückte sie sich zwischen Wischtücher und Besen. Es roch muffig und nach Staub, und Meg konnte nur hoffen, dass sie nicht niesen musste, ehe Herr Jenkins in seinem Büro eintraf und die Sekretärin ihm den gewohnten Morgenkaffee brachte. Meg veränderte ihre Position, bis sie durch einen schmalen Spalt die Bürotür gegenüber einigermaßen im Auge hatte.
Als drüben endlich das Licht angeknipst wurde, musste Meg mit verstopfter Nase und steifen Beinen noch scheinbar endlos warten – in Wirklichkeit wohl kaum eine halbe Stunde – und lauschte auf das Klicken der hochhackigen Schuhe, wenn die Sekretärin im Raum hin und her ging. Dann wurden die Schultore geöffnet und die Kinder kamen laut lärmend hereingestürmt. Meg dachte an Charles Wallace, der jetzt, eingeklemmt zwischen meist Ältere und Größere, vom Strudel mitgerissen wurde.
Die Glocke kündigte schrill die erste Stunde an. Wieder klickte die Sekretärin über den Flur. Wahrscheinlich brachte sie Herrn Jenkins jetzt den Kaffee. Die Schritte verhallten.
Meg wartete schätzungsweise fünf Minuten und verließ dann ihr Versteck. Sie presste die Fingerspitze an die Oberlippe, um das Kitzeln in der Nase zu unterdrücken, überquerte den Flur, klopfte – und musste dummerweise nun doch niesen.
Jenkins war von Megs Anblick überrascht – was ja durchaus in ihrer Absicht gelegen hatte – und nicht gerade erfreut, obwohl er sagte: „Darf ich fragen, welchem Umstand ich dieses Vergnügen verdanke?“
„Bitte, Herr Jenkins, ich muss ganz dringend mit Ihnen sprechen!“
„Warum bist du nicht in der Schule?“
„Bin ich doch. Oder ist das etwa keine Schule?“
„Ich darf dich bitten, nicht gleich frech zu werden! Ich sehe schon, dass du dich während des Sommers nicht im Geringsten verändert hast. Und ich hatte erwartet, mich nicht länger mit deinesgleichen herumschlagen zu müssen. Weiß man eigentlich über deinen gegenwärtigen Verbleib Bescheid?“
Die Morgensonne spiegelte sich in seinen Brillengläsern und verbarg seine Augen. Meg schob ihre eigene Brille zurecht, die – wie fast immer – verrutscht war, und versuchte vergeblich, in seinem Gesicht zu lesen. Wie üblich sah Jenkins bloß drein, als wittere er Verrat.
Er rümpfte die Nase. „Ich werde meine Sekretärin bitten, dich mit dem Auto zu deiner Schule zu bringen. Das bedeutet, dass ich für einen guten halben Tag auf sie verzichten muss.“
„Vielen Dank, ich komme auch per Anhalter hin.“
„Um eine Fehlleistung durch eine andere zu übertrumpfen? Hierzulande ist das Anhalten fremder Fahrzeuge von Gesetzes wegen untersagt!“
„Herr Jenkins, ich bin nicht gekommen, um mich mit Ihnen über meinen Schulweg zu unterhalten, sondern um über Charles Wallace zu sprechen.“
„Deine Einmischung in unsere internen Angelegenheiten behagt mir keineswegs, Margaret!“
„Die größeren Jungen bedrohen ihn. Wenn Sie nicht endlich dagegen einschreiten, gibt es noch ein Unglück.“
„Ich würde annehmen, dass eher deine Eltern dazu berufen wären, eine Aussprache mit mir zu suchen, sofern sie an meinem Vorgehen Kritik zu üben wünschen.“
Meg bemühte sich, ruhig zu bleiben, aber mit zunehmender Wut wurde auch ihre Stimme lauter. „Wahrscheinlich sind meine Eltern gescheiter als ich und wissen, dass dabei nichts herauskommen würde. Ach, bitte, bitte, tun Sie doch etwas, Herr Jenkins! Die Leute glauben zwar, Charles Wallace sei keine große Leuchte, aber in Wirklichkeit …“
Er fiel ihr ins Wort. „Wir haben alle neu Eingeschulten einem Intelligenztest unterworfen. Dein Bruder schnitt mit durchaus zufriedenstellenden Werten ab.“
„Sie wissen, dass das eine Untertreibung ist, Herr Jenkins! Auch meine Eltern haben Charles getestet. Sein IQ ist so hoch, dass er sich auf herkömmliche Weise nicht mehr messen lässt.“
„Aus dem Allgemeinverhalten deines Bruders könnte man allerdings kaum darauf schließen.“
„Ja, begreifen Sie denn nicht, dass Charles sich nur zurückhält, damit die großen Jungen ihn in Ruhe lassen? Sie kommen mit ihm nicht zurecht und er nicht mit ihnen. Welcher andere Sechsjährige weiß denn schon über Farandolae Bescheid?“
„Ich verstehe nicht, wovon du sprichst, Margaret. Dass Charles Wallace nicht eben besonders kräftig wirkt, ist mir bekannt.“
„Er ist ganz in Ordnung.“
„Er ist außerordentlich blass und unter seinen Augen zeigen sich dunkle Ringe.“
„Wie würden denn Sie aussehen, wenn jeder Sie nach Belieben auf die Nase dreschen oder Ihnen ein blaues Auge verpassen dürfte?“
„Somit frage ich mich bloß eines“, sagte Herr Jenkins und starrte sie eisig aus Eulenaugen an, die von den Linsen seiner Brille unheimlich vergrößert wurden. „Wenn dein Bruder tatsächlich ein solches Genie ist – warum schicken ihn deine Eltern eigentlich überhaupt zur Schule?“
„Weil das Gesetz sie dazu zwingt. Sonst ließen sie es bestimmt bleiben.“
Nun stand Meg neben Charles Wallace auf der Mauer, blickte mit ihm zu den beiden Felsen hinüber, hinter denen keine Drachen lauerten, und als sie sich an die Bemerkung erinnerte, die Herr Jenkins über Charles und seine Blässe gemacht hatte, bekam sie erneut Herzklopfen.
„Warum misstrauen die Menschen jedem, der aus der Reihe tanzt?“, fragte Charles. „Bin ich denn wirklich so anders als die anderen?“
Meg betrachtete ihn voll Trauer und Zuneigung. „Ach, Charles, wenn ich das nur wüsste!“, sagte sie und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. „Ich bin deine Schwester, ich kenne dich seit deiner Geburt; also stehe ich dir zu nahe, um darüber urteilen zu können.“
Sie nahm auf der Mauerbrüstung Platz, doch erst nachdem sie sich vergewissert hatte, dass die Schlange nicht da war, die hier hauste: ein großes, schwarzes und völlig harmloses Tier. Es war ein besonderer Liebling der Zwillinge, aber alle vier hatten sie beobachtet, wie allmählich aus einem kleinen Würmchen dieses Prachtexemplar geworden war. Sie hatten sie Louise getauft – nach Dr. Louise Colubra, denn so viel Latein kannten sie immerhin, um zu wissen, was dieser ungewöhnliche Familienname bedeutete.
„Doktor Schlangenfrau!“, hatte Dennys gesagt. „Geradezu unheimlich.“
„Es ist ein hübscher Name“, hatte Sandy widersprochen. „Wir sollten unsere Schlange nach ihr benennen: Louise die Große.“
„Warum ›die Große‹?“
„Warum nicht?“
„So groß ist sie auch wieder nicht.“
„Doch.“
„Jedenfalls nicht größer als Dr. Louise.“
Dennys war gekränkt. „Für eine Schlange, die in einer Gartenmauer wohnt, ist Louise die Große ungewöhnlich groß. Hingegen ist Dr. Louise eine eher kleine Ärztin – natürlich nur, was ihre Statur betrifft. Als medizinische Kapazität ist sie das reinste Mammut.“
„Doktoren gibt es eben in allen Größen. Aber du hast recht, Dr. Louise ist wirklich ein zartes Persönchen und unsere Schlange ist vergleichsweise ein Riese.“ Die Zwillinge stritten nie lang.
„Andererseits: Unsere Frau Doktor gleicht eher einem Vogel als einer Schlange.“
„Entstammen denn die Schlangen und Vögel in der Entwicklungsgeschichte nicht ohnehin dem gleichen Phylum – oder wie du das immer nennst? Ach was, jedenfalls ist Louise ein guter Name für eine Schlange.“
Zum Glück nahm Dr. Louise die Sache mit Humor. Sie sagte den Zwillingen, Schlangen seien zu Unrecht verabscheute Geschöpfe; sie fühle sich sogar höchst geehrt, Namenspatronin eines so sympathischen Wesens zu sein. Zudem gelte der schlangenumwundene Äskulapstab bis heute als Standeszeichen der Ärzte; der Name sei also sehr passend gewählt.
Louise die Große war seit ihrer Taufe beträchtlich gewachsen, und obwohl sich Meg nicht gerade vor ihr fürchtete, hielt sie doch jedes Mal nach ihr Ausschau, ehe sie sich auf die Mauer setzte. Im Augenblick ließ Louise sich nicht blicken; also konnte Meg ihre Aufmerksamkeit unbesorgt wieder Charles Wallace zuwenden.
„Du bist viel gescheiter als die Zwillinge“, sagte sie, „und die beiden sind selbst nicht gerade dumm. Woran liegt es also, dass sie, anders als du, problemlos mit allen Leuten auskommen?“
„Tja, wenn sie mir das bloß verraten würden!“, klagte Charles.
„Vor allem sprechen sie in der Schule nicht so wie daheim.“
„Ich dachte doch nur, wenn ich mich für Mitochondrien und Farandolae interessiere, könnten andere ebenso daran interessiert sein.“
„Da täuschst du dich aber sehr.“
„Ich interessiere mich wirklich für sie. Ist das denn so ungewöhnlich?“
„Für den Sohn eines Physikers und einer Biologin nicht unbedingt.“
„Aber keiner teilt dieses Interesse mit mir.“
„Es hat eben auch keiner zwei Wissenschaftler als Eltern. Für uns wirkt sich das ohnehin eher nachteilig aus. Ich zum Beispiel werde nie so hübsch werden wie Mom.“
Charles hatte keine Lust, Meg einmal mehr zu trösten. Er blieb bei seinem Thema. „Das Faszinierende an den Farandolae ist ihre geringe Größe.“
Meg dachte daran, dass ihr Haar so unauffällig braun war wie das einer gewöhnlichen Feldmaus, und sie verglich es insgeheim mit der brünetten Lockenpracht ihrer Mom … „Was hast du gesagt?“
„Farandolae sind so klein, dass sich ihre Existenz nur vermuten lässt. Nicht einmal das leistungsfähigste Mikro-Elektronenmikroskop kann sie sichtbar machen. Dabei sind sie ungeheuer wichtig für uns – ohne Farandolae müssten wir sterben. Und trotzdem interessiert sich in meiner Schule keiner auch nur im Geringsten für sie. Unsere Lehrerin hat bestenfalls den Verstand einer Heuschrecke. Ja, du hast schon recht, es ist nicht immer angenehm, das Kind berühmter Eltern zu sein.“
„Vor allem, wenn man mitten auf dem Land lebt. Wetten, dass jeder im Dorf weiß, wie oft Dad ins Weiße Haus geholt wird? Unsere ganze Familie fällt aus dem Rahmen. Nur die Zwillinge kommen damit zurecht. Vielleicht weil sie am ehesten normal sind – oder sich zumindest so geben. Andererseits: Was ist schon normal oder nicht normal? – Sag, warum interessierst du dich eigentlich so für Farandolae?“
„Mom forscht zu ihnen.“
„Sie forscht an einer Menge, ohne dass du dich besonders dafür interessiert hättest.“
„Wenn es ihr gelingt, die Existenz der Farandolae nachzuweisen, bekommt sie garantiert den Nobelpreis.“
„Ja? Das kann aber nicht der Grund sein, warum sie dich so faszinieren.“
„Meg, wenn unseren Farandolae Gefahr drohte – das hätte unabsehbare Folgen.“
„Warum?“ Meg fröstelte plötzlich und knöpfte sich die Jacke zu. Am Himmel trieben jetzt schwere Wolken und der Wind frischte auf.
„Ich habe doch die Mitochondrien erwähnt, oder?“
„Ja. Was ist mit ihnen?“
„Mitochondrien sind Mikroorganismen in unseren Zellen. Gibt dir das eine Vorstellung, wie klein sie sind?“
„Ungefähr.“
„Für sie ist der menschliche Körper groß wie eine ganze Welt – so groß wie die ganze Welt für uns. Und doch hängen wir von unseren Mitochondrien mehr ab als die Erde von den Menschen. Die Erde würde sich auch ohne uns weiterdrehen, aber wenn unseren Mitochondrien etwas zustieße, müssten wir sterben.“
„Warum sollte ihnen etwas zustoßen?“ Charles Wallace zuckte bloß mit den Schultern. Im schwindenden Licht wirkte er noch blasser als sonst. „Menschen können einen Unfall erleiden oder krank werden. Jeder Organismus ist anfällig. Und aus dem, was ich von Mom aufgeschnappt habe, sind viele Mitochondrien ihrer Farandolae wegen in Gefahr.“
„Das alles hat Mom dir erzählt?“
„Nur ein paar Sachen. Den Rest habe ich mir selbst zusammengereimt.“
Charles Wallace konnte aus den Gedanken seiner Mom oder aus Megs Gedanken Schlüsse ziehen, wie andere Kinder einzelne Wiesenblumen zu einem Strauß binden. „Was sind eigentlich Farandolae?“, fragte sie und machte es sich auf der harten Mauer so bequem wie möglich.
„Farandolae leben in den Mitochondrien ungefähr so wie diese in einer menschlichen Zelle. Sie sind genetisch von ihrer Mutterzelle ebenso unabhängig wie die Mitochondrien von uns. Wenn aber den Farandolae etwas zustößt, werden die Mitochondrien – nun, sagen wir: Dann werden sie krank. Und müssen wahrscheinlich sterben.“
Ein trockenes Blatt löste sich von seinem Zweig und gaukelte an Megs Wange vorbei zu Boden. „Warum sollte ihnen etwas zustoßen?“, wiederholte sie.
Charles Wallace wiederholte seinerseits: „Menschen können einen Unfall erleiden oder krank werden. Oder sie führen Kriege und bringen einander um.“
„Ja. Weil sie eben Menschen sind. Wo bleibt da der Bezug zu Mitochondrien und Farandolae?“
„Meg, Mom arbeitet seit einigen Wochen so gut wie rund um die Uhr in ihrem Labor. Das kann dir doch nicht entgangen sein.“
„Das macht sie oft, wenn sie einer besonderen Sache auf der Spur ist.“
„So wie jetzt. Und diesmal geht es um Farandolae. Sie glaubt, durch die Beobachtung bestimmter Mitochondrien – sterbender Mitochondrien – ihre Existenz nachgewiesen zu haben.“
„Das erzählst du doch hoffentlich nicht in der Schule weiter?“
„Ich merke immer deutlicher, Meg, dass du mir nicht zuhörst.“
„Ich mache mir eben Sorgen um dich.“
„Dann hör mir endlich zu! Weißt du, warum Mom so hartnackig versucht, die Auswirkungen von Farandolae auf Mitochondrien zu erforschen? Weil sie nämlich befürchtet, dass mit meinen Mitochondrien etwas nicht in Ordnung ist.“
„Was sagst du da?“ Erschrocken sprang Meg von der Mauer und starrte ihren Bruder an.
Er sprach so leise, dass sie ihn kaum hören konnte. „Wenn meine Mitochondrien krank sind, bin auch ich krank.“
Da war sie wieder, die nackte Angst, die Meg die ganze Zeit gespürt hatte und die sich nun nicht länger unterdrücken ließ. „Ist das sehr schlimm? Kann Mom kein Gegenmittel finden?“
„Das weiß ich nicht. Sie vermeidet es, mit mir darüber zu sprechen. Ich bin ganz aufs Raten angewiesen. Sie versucht, sich gegen mich abzublocken, bis sie mehr herausgefunden hat, und ich bekomme nur Bruchstücke mit. Vielleicht ist es nicht wirklich gefährlich. Vielleicht liegt es tatsächlich nur an der Schule. Immerhin werde ich fast jeden Tag aufs Neue verprügelt. Das könnte schon dazu geführt haben, dass ich … – He, Meg! Schau doch, was Louise macht!“
Meg folgte seinem Blick und wandte sich um. Louise die Große glitt ihnen auf der Steinmauer entgegen. Ihr geschmeidiger schwarzer Leib glänzte silbrig und purpurfarben in der Abendsonne. Unheimlich behände schlängelte sie sich heran.
„Charles! Pass auf!“, rief Meg.
Er rührte sich nicht von der Stelle. „Sie tut uns nichts.“
„Charles! Lauf! Sie will dich angreifen!“
Aber Louise machte knapp vor Charles Wallace halt und richtete sich spiralenförmig auf, bis sie nur noch auf den letzten Zentimetern ihres Schwanzendes balancierte. Unruhig pendelte ihr Kopf.
„Jemand ist in der Nähe“, sagte Charles Wallace. „Jemand, den Louise kennt.“
„Die – die Drachen?“
„Wer weiß. Sehen kann ich sie allerdings nicht. Warte, ich will versuchen, mich einzufühlen.“ Er schloss die Augen – nicht um Louise oder Meg von sich fernzuhalten, sondern um sich besser auf seinen inneren Blick konzentrieren zu können. „Es sind die Drachen – glaube ich“, flüsterte er. „Und es kommt ein Mann. Nein, kein gewöhnlicher Mann. Er ist – sehr groß – und …“ Plötzlich riss er die Augen wieder auf, wies zu einer Baumgruppe, die bereits in tiefem Schatten lag, und rief: „Schau! Dort!“
Meg meinte, eine riesige dunkle Gestalt wahrzunehmen, die sich ihnen näherte; aber ehe sie Genaueres erkennen konnte, preschte Fortinbras mit wildem Gebell durch den Obstgarten. So bellte er keine Fremden an, so begrüßte er sonst nur Megs Eltern, wenn sie lange fort gewesen waren. Jetzt drückte er sich, den schwarzen Schwanz kerzengerade ausgestreckt, eng an die Wand, reckte die Schnauze, schnüffelte erregt, setzte über die Mauer und rannte auf der oberen Wiese geradewegs auf die beiden Felsen zu.
Charles Wallace folgte ihm, keuchend vor Anstrengung. „Er will dorthin, wo meine Drachen gewesen sind! Komm, Meg! Vielleicht hat er ihre Losung entdeckt!“
Meg eilte ihrem Bruder und dem Hund nach. „Woran willst du denn Drachenkot erkennen? Er sieht wahrscheinlich nicht anders aus als Kuhfladen – nur eben größer.“
Charles Wallace stützte sich auf Hände und Knie. „Da! Schau!“
Am Fuße des Felsens lagen vereinzelte Federn im Moos. Sie sahen aber nicht wie Vogelfedern aus, sondern waren außerordentlich weich und geschmeidig und strahlten einen seltsamen Glanz aus. Zwischen den Federn fanden sich kleine, blattförmige Schuppen, die wie Silber oder Gold schimmerten. Meg musste zugeben, dass Drachenschuppen durchaus so beschaffen sein konnten.
„Siehst du, Meg?“, rief Charles triumphierend. „Sie waren hier! Meine Drachen waren hier!“





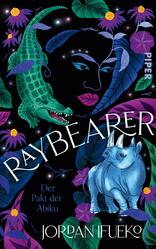



DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.