
Der Pflanzen-Messias – Abenteuerliche Reisen zu den seltensten Arten der Welt - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Fesselnd und sehr anschaulich beschreibt er seine Berufung, rund um den Globus Pflanzen vor dem endgültigen Aussterben zu bewahren.“
Schweizerischer PflanzenfreundBeschreibung
Ein Leben für den Artenschutz
Carlos Magdalena hat eine Mission, er will gefährdete Pflanzen vor dem Aussterben bewahren: von der kleinsten Seerose der Welt bis zu Bäumen mit über fünfzig Meter langen Wurzeln. Er reist zu den entlegensten Orten der Erde - von der Bergwelt Perus über die abgelegenen Inseln des Indischen Ozeans bis in die Tiefen des australischen Outbacks -, auf der Suche nach seltenen exotischen Arten. An seinem Arbeitsplatz in Kew Gardens widmet er sich der Erforschung dieser Pflanzen, entwickelt wegweisende neue Techniken, sie zu vermehren, und versucht alles, um sie in ihrem…
Ein Leben für den Artenschutz
Carlos Magdalena hat eine Mission, er will gefährdete Pflanzen vor dem Aussterben bewahren: von der kleinsten Seerose der Welt bis zu Bäumen mit über fünfzig Meter langen Wurzeln. Er reist zu den entlegensten Orten der Erde - von der Bergwelt Perus über die abgelegenen Inseln des Indischen Ozeans bis in die Tiefen des australischen Outbacks -, auf der Suche nach seltenen exotischen Arten. An seinem Arbeitsplatz in Kew Gardens widmet er sich der Erforschung dieser Pflanzen, entwickelt wegweisende neue Techniken, sie zu vermehren, und versucht alles, um sie in ihrem Wachstum zu stärken und ihren Bestand zu sichern. Sein Buch ist ein sympathisches und mitreißendes Zeugnis wahrer Leidenschaft, beseelt vom Wunsch nach einer besseren, grüneren Welt.
Über Carlos Magdalena
Aus „Der Pflanzen-Messias – Abenteuerliche Reisen zu den seltensten Arten der Welt“
Prolog
Ich stand vor dem Arbeitstisch im Gewächshaus. Es war ein frostiger Morgen in den Royal Botanic Gardens, Kew in London.
Vor mir ein Café-Marron-Baum, ein wunderschöner, immerblühender Strauch mit dunkelgrünen Blättern und schneeweißen, dem Jasmin ähnlichen Blüten. Das Exemplar war aus Stecklingen einer Pflanze von der Insel Rodrigues im Indischen Ozean herangezogen worden.
Eigentlich sollte ich sagen der Pflanze, denn es handelte sich um das einzige verbliebene Exemplar auf der ganzen Welt. Diese Art mit dem lateinischen Namen Ramosmania rodriguesi galt lange [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Faszinierend!“
Schweizer Illustrierte Grün„Mit genauso viel Liebe und Leidenschaft wie beim Pflanzenpflegen schrieb Carlos Magdalena seine ungewöhnliche Lebensgeschichte auf und veröffentlichte sie in dem Buch ›Der Pflanzen-Messias - Abenteuerliche Reisen zu den seltensten Arten der Welt‹.“
Emotion SLOW„So aber ist sein Pflanzenbuch das schönste und wertvollste, das uns seit Längerem in die Hände fiel.“
umweltnetz-schweiz.ch„Ich empfehle ›Der Pflanzen-Messias‹ jedem, der sich für Natur und Botanik interessiert.“
elli-radinger.de„Spannend!“, ORF-Biogärtner Karl Ploberger
OÖ Nachrichten (A)„Bei der Lektüre entfaltet sich ein ungeheuer differenziertes Pflanzenwissen wie ein nicht enden wollendes Feuerwerk.“
Oya„Die Leidenschaft, die Magdalena antreibt, ist nicht nur sympathisch, sondern auch mitreißend – ein wahrer Botschafter der Pflanzenwelt.“
Mannheimer Morgen„(Carlos Magdalenas) Buch ist ein sympathisches und mitreißendes Zeugnis wahrer Leidenschaft, beseelt vom Wunsch nach einer besseren, grüneren Welt.“
Familienheim und Garten„Mehr als nur ein Lesebuch über Pflanzen und Naturschutz.“
Eisenbahn-Landwirt„Fesselnd und sehr anschaulich beschreibt er seine Berufung, rund um den Globus Pflanzen vor dem endgültigen Aussterben zu bewahren.“
Schweizerischer PflanzenfreundProlog
Einleitung: Ein Messias-Manifest
1. Genesis
2. Kew Calling
3. Wiederauferstehung auf Rodrigues
4. Der Messias auf Mauritius
5. Sprechende Schildkröten
6. Berg und Tal
7. Die Pflanze aus dem Müll
8. Meine Wasserbabys
9. Victoria’s Secrets
10. Warme Seerosen
11. Heiße Ware
12. Bolivianische Botanik
13. Peruanische Pflanzen
14. Australiens Flora
Epilog: Jeder kann ein Messias sein
Danksagung
Glossar
Anmerkungen






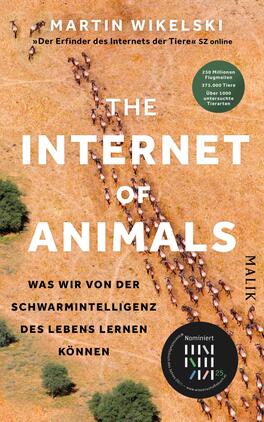

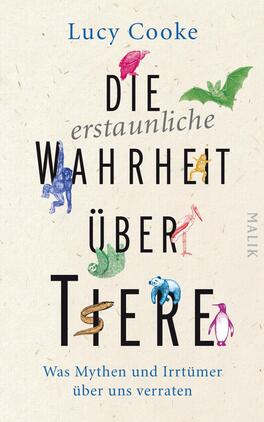
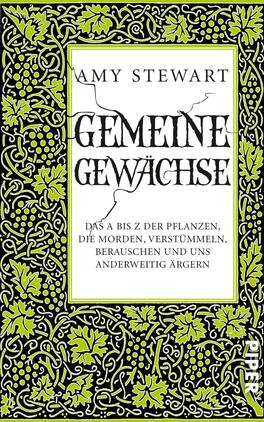





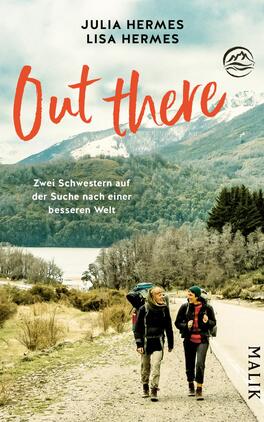


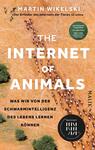
Die erste Bewertung schreiben