
Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
Beschreibung
Menschenrechtsaktivist und Survival-Experte Nehberg blickt zurück auf ein Leben voller Gefahren, Abenteuer und Freuden.
Dies ist seine letzte Autobiografie, sie ist „fesselnd geschrieben wie ein Roman“ Stern
Mitreißend, spannend und unterhaltsam: Nehbergs Biografie ist ein besonderes Abenteuerbuch. Der Visionär und Abenteurer Rüdiger Nehberg blickte kurz vor seinem 85. Geburtstag auf sein Lebenswerk zurück. In seiner Autobiografie erzählt er von seinen spannendsten Erlebnissen, - und seinem großen Engagement für die Yanomami, den Regenwald und für das Ende der Weiblichen…
Menschenrechtsaktivist und Survival-Experte Nehberg blickt zurück auf ein Leben voller Gefahren, Abenteuer und Freuden.
Dies ist seine letzte Autobiografie, sie ist „fesselnd geschrieben wie ein Roman“ Stern
Mitreißend, spannend und unterhaltsam: Nehbergs Biografie ist ein besonderes Abenteuerbuch. Der Visionär und Abenteurer Rüdiger Nehberg blickte kurz vor seinem 85. Geburtstag auf sein Lebenswerk zurück. In seiner Autobiografie erzählt er von seinen spannendsten Erlebnissen, - und seinem großen Engagement für die Yanomami, den Regenwald und für das Ende der Weiblichen Genitalverstümmelung.
Rüdiger Nehberg wurde für seinen großen Beitrag für die Völkerverständigung und sein Engagement für bedrohte Völker mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der Öffentlichkeit ist der Menschenrechtsaktivist auch durch spektakuläre Aktionen bekannt.
So legte er auf dem Deutschlandmarsch 1.000 Kilometer zurück und aß nur, was er am Straßenrand fand. Er bezwang als Erster den Blauen Nil, war Undercover-Goldsucher, um die Yanomami zu retten, und ist der Begründer der Survival-Bewegung in Deutschland.
Ein Aktivist im Kampf für Menschenrechte
Herausragend an Nehberg war nicht nur seine Weltoffenheit, sondern auch sein Engagement im Kampf für die Rechte anderer. Er setzte sich mit seiner selbst gegründeten Organisation namens Target e. V. gegen die Weibliche Genitalverstümmelung ein. Die NGO machte sich den Islam zum Verbündeten und konnte bereits viel erreichen.
„Er hat geschafft, woran UN, EU und große Organisationen gescheitert sind“ (Süddeutsche Zeitung): mit seiner Menschenrechtsorganisation TARGET e. V. die höchsten Religiösen des Islam als Partner für die Beendigung der Weiblichen Genitalverstümmelung zu gewinnen.
Die große Autobiografie des wohl außergewöhnlichsten Abenteurers Deutschlands und sein Vermächtnis
1001 Abenteuer beschreibt Nehberg in „Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen“. Dem Überlebenskünstler gelingt es, dass seine Leser Spannung und Engagement nachempfinden können. Ein Buch für Abenteurer und Menschen, die gerne von Gefahr, Einfallsreichtum und Mut lesen .
Medien zu „Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen“
Über Rüdiger Nehberg
Aus „Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen“
1. Vorwort
„Ohne Aufbruch kein Durchbruch.“
Ulvi Gündüz
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit diesem Buch möchte ich euch mitnehmen auf einen Streifzug durch mein Leben. Ich möchte diejenigen Geschichten erzählen, die bewirkt haben, dass mein Dasein so ganz anders verlaufen ist, als es ursprünglich geplant war.
Es begann 1935 in Bielefeld, zwischen Botanischem Garten und Tierpark Olderdissen, im Dunstkreis der Fabrik von Dr. Oetkers Vanilleduft. Doch der Mensch lebt nicht allein vom Wohlgeruch. Er macht nicht satt. Das weiß auch ein Vierjähriger. Inzwischen hatte ich die [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
1. Vorwort
2. Der Uranfang
3. Ein Rattenschwanz von Erfolgen
4. In jordanischen Gefängnissen
5. Survival : Die Kunst zu überleben
6. Der Mord am Blauen Nil
7. Wendepunkte
8. Das harte Gesetz des Dschungels
9. Der Deutschlandmarsch ohne Nahrung
10. Die Morde um Tatunca Nara
11. Bei den Yanomami-Indianern
12. Von der Flut davongespült
13. Rettet die Yanomami!
14. Dreikampf in Australien
15. Bedrohungen durch Goldsucher
16. Annette
17. Die Karl-May-Klinik im Regenwald
18. Dschungel-Survival
19. Das Verbrechen Weibliche Genitalverstümmelung
20. TARGET e. V. : Unabhängig. Visionär. Respektvoll. Pragmatisch
21. Ab an die Front!
22. Die Wüstenkonferenz
23. Die Fahrende Krankenstation
24. Beim Großsheikh Al-Azhar
25. Die Karawane der Hoffnung
26. Wechselbäder der Gefühle in Dschibuti
27. Unsere historische Azhar-Konferenz
28. Die „andere“ Kairo-Konferenz
29. Das Goldene Buch
30. Hilfe zur Selbsthilfe
31. Verstümmlerin wird Mitkämpferin
32. Unsere Geburtshilfeklinik in Äthiopien
33. Verrat
34. Auge um Auge
35. Das mutige Bekenntnis
36. Helmut Schmidt vermittelt
37. Bei der OIC, der „islamischen UNO“
38. Beim saudischen Großmufti
39. Der Golden Islam Award
40. Hoffen und Warten
41. In den Mühlen der Politik
42. Der Bäcker und der König
43. Wer rastet, der rostet : Meine Art Vermächtnis
Meine Vorträge
Stationen meines Lebens





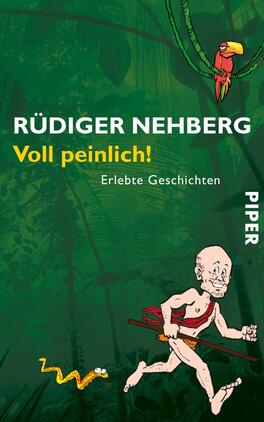





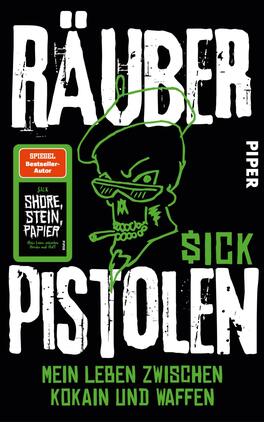
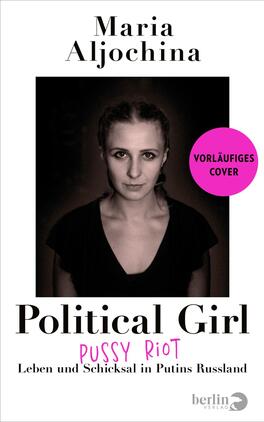
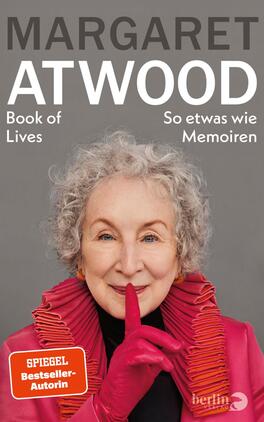

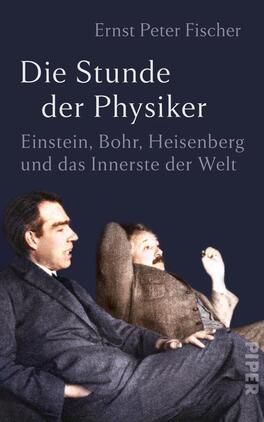



Die erste Bewertung schreiben