
Alicia und die Unwahrscheinlichkeit der Liebe - eBook-Ausgabe
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:
info@piper.de
Piper Verlag GmbH
Georgenstraße 4
80799 München
„Der Roman liest sich flüssig und gut. Eine Prise Humor macht das Lesen zu einer kurzweiligen Sache. Genau die richtige Lektüre für den Sommer.“
Das PTA MagazinBeschreibung
Wie wahrscheinlich ist es, dass man zweimal im Leben der großen Liebe begegnet?
„Eine zweite Chance – eine, die wirklich funktioniert – gibt es nur im Film oder in Büchern.“
Nach dem frühen Tod ihres Mannes erbt die vierzigjährige Alicia ein mallorquinisches Weingut und einen Hund. Das Problem ist nur: Alicia hat keine Ahnung vom Weinanbau. Und erst recht nicht von Hunden. Sechs Jahre später ist das Weingut bankrott, und der Hund zeigt Alicia immer noch die kalte Schulter. Alicia fühlt sich unendlich einsam. Da tritt Marco in ihr Leben: jung, attraktiv und Agraringenieur. Und er interessiert…
Wie wahrscheinlich ist es, dass man zweimal im Leben der großen Liebe begegnet?
„Eine zweite Chance – eine, die wirklich funktioniert – gibt es nur im Film oder in Büchern.“
Nach dem frühen Tod ihres Mannes erbt die vierzigjährige Alicia ein mallorquinisches Weingut und einen Hund. Das Problem ist nur: Alicia hat keine Ahnung vom Weinanbau. Und erst recht nicht von Hunden. Sechs Jahre später ist das Weingut bankrott, und der Hund zeigt Alicia immer noch die kalte Schulter. Alicia fühlt sich unendlich einsam. Da tritt Marco in ihr Leben: jung, attraktiv und Agraringenieur. Und er interessiert sich ebenso für Alicia wie sie für ihn. Doch Alicia ist misstrauisch. Zwar versteht sie nicht viel von Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber dass Marco zu gut ist, um wahr zu sein, wird ihr schnell klar. Und tatsächlich verheimlicht er ihr etwas …
Über Mayte Uceda
Aus „Alicia und die Unwahrscheinlichkeit der Liebe“
Prolog
Das Theorem der endlos tippenden Affen
Angenommen, eine Horde Affen sitzt vor einem Haufen Schreibmaschinen. Oder noch besser, eine Million Affen tippt jeden Tag zehn Stunden lang ununterbrochen. Was glauben Sie, was würde dabei herauskommen?
Genau. Die Antwort lautet: gar nichts oder im besten Fall eine gewaltige Verschwendung von Papier und dazu eine Million ruinierte Schreibmaschinen.
Aber angenommen, statt einer Million Affen würden unendlich viele Affen unendlich lange nach dem Zufallsprinzip auf ihren Schreibmaschinen herumhacken. Bekämen sie wohl einen [...]
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pressestimmen
„Ein unterhaltsamer Roman mit viel südlichem Flair und großen Gefühlen, die von dubiosen Mafia-Verstrickungen bedroht werden.“
(CH) Luzerner Rundschau„Der Roman liest sich flüssig und gut. Eine Prise Humor macht das Lesen zu einer kurzweiligen Sache. Genau die richtige Lektüre für den Sommer.“
Das PTA Magazin



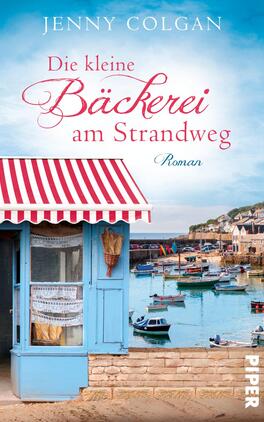
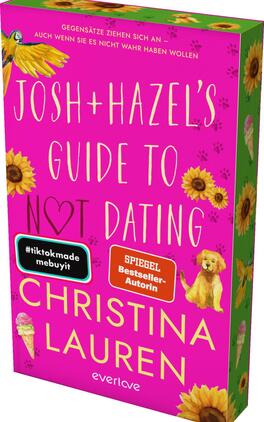





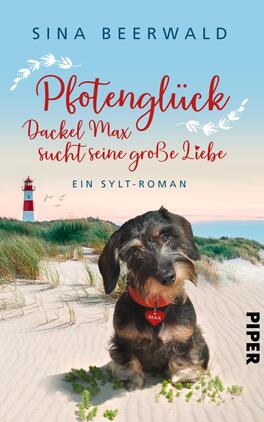







Die erste Bewertung schreiben