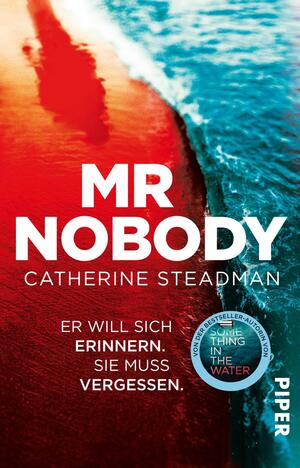
Mr Nobody – Er will sich erinnern. Sie muss vergessen. — Inhalt
Der neue packende Thriller der New-York-Times-Bestsellerautorin Catherine Steadman! Ein Mann ohne Erinnerung. Eine junge Neuropsychiaterin mit einer dunklen Vergangenheit. Und die gefährliche Suche nach der Wahrheit ...
Niemand weiß, wer er ist. Aber er kennt dein größtes Geheimnis.
An einem eisigen Januarmorgen wird an einem Strand in Norfolk ein Mann gefunden, der nass und orientierungslos umherirrt. Die Presse tauft den mysteriösen Unbekannten Mr Nobody, denn er spricht kein Wort, und niemand weiß, wer er ist oder woher er kommt. Für die junge Neuropsychiaterin Dr. Emma Lewis könnte dieser Fall ihren Durchbruch bedeuten. Doch vor vierzehn Jahren verließ Emma nach einem schrecklichen Ereignis dieselbe kleine Stadt in Norfolk und tat alles, um die Spuren ihrer Vergangenheit zu verwischen. Als sie nun ihrem mysteriösen neuen Patienten zum ersten Mal begegnet, wird Emma klar: Mr Nobody weiß etwas über sie, das niemand wissen sollte. Und er könnte eine große Gefahr für sie sein …
„Catherine Steadmans neuer Thriller ›Mr Nobody‹ ist sogar noch besser als ›Something in the Water‹. Originell, scharfsinnig und absolut fesselnd.“ JP Delaney, SPIEGEL-Bestsellerautor von „The Girl Before“ und „Believe Me“
„Zahlreiche Wendungen und ein mitreißendes Tempo machen ›Mr Nobody‹ zu einer absolut spannenden Lektüre.“ Vanity Fair
„Steadman lässt die Ereignisse erneut von der allerersten Sekunde an auf brillante Art Fahrt aufnehmen. Ein faszinierender Thriller, perfekt für dunkle und stürmische Nächte.“ Kirkus Reviews
Catherine Steadman ist Schriftstellerin und Schauspielerin. Sie wirkte unter anderem in „Downton Abbey“, „The Tudors“ und „Breathless“ mit. Ihr Thriller-Debüt „Something in the Water“ wurde von Reese Witherspoon in ihrem Buchclub empfohlen und eroberte Platz 1 der New York Times-Bestsellerliste. Aufgewachsen in New Forest, lebt Catherine Steadman heute mit ihrem Mann, ihrer kleinen Tochter und ihrem Hund in North London.
Leseprobe zu „Mr Nobody – Er will sich erinnern. Sie muss vergessen.“
Prolog
Wenn wir bei diesem Tempo einen Unfall bauen, reicht die Wucht des Aufpralls nicht aus, um uns sofort zu töten. Was man für etwas Gutes halten könnte.
Doch so ist es nicht.
Das Einzige, was schlimmer ist, als durch eine Kollision zu sterben, ist, durch eine Kollision beinahe zu sterben. Glauben Sie mir, ich bin Ärztin. Und jetzt, da ich darüber nachdenke, wäre ich, ehrlich gesagt, überrascht, wenn dieser Mietwagen überhaupt Airbags hätte.
Glitzernde, schneebedeckte Felder huschen vorbei, weiß überzuckerte Hecken, Schafe, Ackerfurchen und Gräben, die [...]
Prolog
Wenn wir bei diesem Tempo einen Unfall bauen, reicht die Wucht des Aufpralls nicht aus, um uns sofort zu töten. Was man für etwas Gutes halten könnte.
Doch so ist es nicht.
Das Einzige, was schlimmer ist, als durch eine Kollision zu sterben, ist, durch eine Kollision beinahe zu sterben. Glauben Sie mir, ich bin Ärztin. Und jetzt, da ich darüber nachdenke, wäre ich, ehrlich gesagt, überrascht, wenn dieser Mietwagen überhaupt Airbags hätte.
Glitzernde, schneebedeckte Felder huschen vorbei, weiß überzuckerte Hecken, Schafe, Ackerfurchen und Gräben, die Kulisse meiner Kindheit, ein winterlicher Flecken ländliches England. Strahlendes Sonnenlicht an einem kobaltblauen Himmel.
Ich werfe einen schnellen Blick auf die Fahrerin, die – das Gesicht starr vor Konzentration – mit quietschenden Bremsen einen Gang herunterschaltet und in die nächste unübersichtliche Kurve jagt. Ich kann nichts anderes tun, als mit aller Kraft hoffen, dass wir es rechtzeitig schaffen. Bevor mein Patient etwas Schreckliches tut.
Wir beschleunigen aus der Kurve heraus und werden gefährlich nah an den Rand der schmalen Straße getragen, die hier von Bäumen gesäumt ist. Unweigerlich gehen mir die Konsequenzen eines möglichen Unfalls durch den Kopf. Ich sehe, wie das fragile Zuckerwerk unserer Neokortexe bei Tempo hundertfünfzig an einem knappen Zentimeter stabilen Schädelknochens zermatscht wird. Ich höre den dumpfen Aufprall unserer Köpfe auf das dunkelgraue Plastik des Armaturenbretts, ehe sie gleich darauf mit voller Kraft gegen die Kopfstützen geschleudert werden. Ein doppelter Wirkungstreffer. Krieg an zwei Fronten. So gehen Armeen zugrunde.
Diese empfindliche graue Masse, die wir alle als selbstverständlich gegeben hinnehmen, der Teil unseres Körpers, der uns zu uns macht, wird mit hoher Geschwindigkeit gegen unseren Schädelknochen geschleudert. Trauma durch stumpfe frontale, parietale und okzipitale Gewalteinwirkung. Massive Hämorrhagie, innere Blutungen, Quetschungen und Atrophie. Totes Gewebe. Das Gehirn irreparabel zerstört. Wer wir mal waren – Vergangenheit.
Und dann stellt ein neuer Gedanke all diese erschreckenden Bilder noch in den Schatten: Selbst wenn wir es irgendwie schaffen würden zu überleben, wäre ich wahrscheinlich der einzige Mensch, der uns nachher wieder in Ordnung bringen könnte. Ich bin die einzige Ärztin im Umkreis von hundertfünfzig Kilometern mit relevanter klinischer Erfahrung. Diese Ironie schmerzt.
Eng nehmen wir eine weitere Kurve, Äste stoßen durchs zerbrochene Fenster gleich neben mir, und ich rutsche ein Stück weiter in die Mitte des Wagens.
Ich muss mich konzentrieren.
Ich balle meine blutende Faust, ganz fest, und der Schmerz rast durch meinen Körper. Konzentration. Keine weiteren Fehler mehr. Dies alles ist meine Schuld. Alles, was geschehen ist. Hätte ich mich bloß mehr angestrengt und besser hingeschaut, dann wäre nichts von alldem passiert. Wenn ich bestimmte Dinge erkannt, die Hinweise wahrgenommen hätte.
Mein Blick fällt auf die Straße vor uns. Ich sehe unser Ziel am Horizont schnell näher kommen: die Haltebucht, den Pfad, der direkt hinunter zum Meer führt. Zu dieser weiten, wilden Wasserfläche. Dort wird er sein. Wenn wir nicht zu spät kommen.
Es gab ein anderes Mal, vor langer Zeit, als ich ebenfalls nicht konzentriert war. Auch damals habe ich die Zeichen übersehen und etwas sehr Schlimmes geschehen lassen. Aber diesmal wird es nicht schlecht ausgehen. Ich verspreche es. Diesmal wird es anders laufen. Ganz anders. Diesmal werde ich verhindern, dass etwas Schreckliches passiert. Diesmal werde ich es in Ordnung bringen.
Und wenn ich mir selbst gegenüber gnadenlos ehrlich bin, ist dies vielleicht genau die Situation, die ich mir immer gewünscht habe. Eine Chance, es besser zu machen.
Ich meine, niemand wird durch Zufall Psychiaterin.
1 – Der Mann
Der Mann
Tag 1
Das blendende Licht, als sich die weiche Haut zweier Augenlider öffnet.
Ein auf dem Sand ausgestreckter Körper.
Das schnelle Flattern der Wimpern, als dahinter die Wahrnehmung aufkeimt, und auf einen Schlag ist er wach. Bewusstsein erfüllt seinen Körper, und er spürt, wie die Haut seiner Wange den kalten Strand berührt. Verwirrung.
Die Geräusche des Meeres. Wellen brechen und ziehen sich zurück. Ein Aufprallen und ein Schsch.
Der frühe Morgen eines Januartags. Ein britischer Strand im tiefsten Winter. Meilenweit der weiß-goldene Ufersand von Norfolk und das kalte Licht der Morgendämmerung, das alles in HD präsentiert.
Über den flachen Boden wehen Körner von Flugsand in künstlerisch anmutenden Wellen dem Mann direkt ins ungeschützte Gesicht. Er kneift die Augen zusammen.
In seinem Schädel wallt ein scharfes, schmerzhaftes Pochen auf. Er zuckt zusammen. Die papierne Haut rund um die Augen legt sich in noch tiefere Falten, und er runzelt unwillkürlich die Stirn. Der unerwartete Schmerz zieht sich in die Länge, breitet sich in seinem Kopf aus und wird beinahe unerträglich. Er schnappt nach Luft, und der Schmerz schlägt noch härter zurück. Die heiße Luft, die er ausatmet, wird vom kalten Seewind davongetragen.
Er versucht, sich in den Schmerz hinein zu entspannen; die quälende Welle durch sich hindurchrauschen zu lassen, über sich hinweg. Und es scheint zu funktionieren. Eine gefühlte Ewigkeit bleibt er schlaff im Sand liegen und lässt das Pochen langsam zur Ruhe kommen.
Alles tut ihm weh, und der Schatten eines Gedankens spukt ihm durch den Kopf.
Wo bin ich? Dünn wie Spinnweben treibt der Gedanke durch die Luft, kaum zu fassen.
Noch einmal atmet er bewusst durch und versucht zögernd, den Kopf zu heben. Ganz vorsichtig, um den schlummernden Schmerz nicht erneut zu wecken. Beim Versuch, sein Gewicht auf die Unterarme zu verlagern und vorsichtig deren Belastbarkeit zu testen, bleibt feuchter Sand wie Zuckerkristalle an seiner Wange kleben. Er blinzelt ins Morgenlicht.
Wie bin ich hierhergekommen?
Möwen hüpfen über den Strand, während er in der Landschaft nach einer Antwort sucht – doch nichts hier kommt ihm bekannt vor.
Was ist passiert?
Er betrachtet den Wald, der den Strand säumt, doch die dichte Reihe von Baumkronen gibt nichts preis. Keine Anhaltspunkte. Nichts, woran sich ein Begreifen festmachen könnte.
Okay. Wo war ich, bevor ich hierhergekommen bin?
Er schaut hoch zum gespenstischen grauen Gewölbe des winterlichen Himmels, und er fragt sich, ob er wohl träumt. Ob er im Bett liegt, zu Hause und in Sicherheit, wo immer das sein mag. Doch die Wolken, die er fixiert, sind echt; schwer und voll mit Regen. Er schaudert.
Erst jetzt registriert er, dass seine Kleidung durchnässt ist, dass der durchtränkte Stoff ihm an der Haut klebt. Er zittert und friert bis auf die Knochen. Er muss sich bewegen, das begreift er, er muss sich aufwärmen, sonst riskiert er, bei diesem Wetter zu erfrieren.
Er braucht einen Unterschlupf. Wieder schaut er zu den Bäumen hinauf. Der Wind peitscht den Sand wie spitze Nadeln, kleine Stecknadeln, die sich in seine betäubte Haut bohren.
Mühsam versucht er, auf die Beine zu kommen. Um das Ausmaß seiner Verletzungen einschätzen zu können, achtet er darauf, wie gut die Muskeln ansprechen.
Als er endlich aufrecht steht, zögert er. Er dreht sich in einem kleinen Kreis und betrachtet den Sand an der Stelle, wo er gelegen hat. Eine instinktive Handlung, weiter nichts. Ein kurzes Sich-Umsehen nach Gegenständen, die er verloren haben könnte, irgendwelchen Dingen, die ihm gehören. Obwohl er keine Ahnung hat, was für Dinge das sein könnten. Aber irgendetwas muss ihm schließlich gehören, oder nicht?
Er denkt einen Moment nach, dann steckt er die tauben Hände in die feuchten Taschen.
Da muss irgendetwas sein.
Die Taschen sind leer. Eine lähmende Verwirrung überfällt ihn.
Langsam. Was, zum Teufel, ist hier los?
Kurz fährt er sich mit der Hand durch die nassen Haare. Irgendwie muss er die Situation wieder unter Kontrolle bekommen, eine Logik darin entdecken. Er muss sich doch an etwas erinnern? Als er sich mit der Hand über den Hinterkopf streicht, durchflutet der von der Schädelbasis ausgehende Schmerz erneut seinen ganzen Körper. Er atmet scharf ein und zieht ruckartig die Hand weg. Dann entdeckt er die dunkle Spur an den Fingern.
Blut.
Er kneift die Augen zusammen und atmet bewusst in den langsam nachlassenden Schmerz hinein. Als er die Augen öffnet, bemerkt er etwas anderes, auf der anderen Seite seiner Hand. Er dreht sie um, und dort, auf dem Handrücken, steht in blauer Farbe etwas geschrieben. Vom Meerwasser weitgehend abgewaschene Buchstaben, ein Wort. Verblüfft starrt er es an.
Komisch. Was soll das bedeuten?
Das Wort streift am Rand von etwas Bekanntem entlang, an der Antwort, so nah, dass er beinahe zugreifen und sie packen kann. Dann aber entfernt sie sich außer Reichweite, ausweichend, quecksilbrig. Wie die hellen Leuchtfäden, die auf der Innenseite seiner Lider tanzen, wann immer er sie schließt.
Er zittert, die Kälte reißt ihn in die unmittelbare Gegenwart zurück. Er braucht einen Unterschlupf.
Es wird wiederkommen, sagt er sich. Er schüttelt sich und macht sich entschlossen auf den Weg landeinwärts.
Beim Gehen presst sich feuchter Sand zwischen seinen nackten Zehen nach oben, kalt und breiig wie frisch gegossener Beton. Und die ganze Zeit tastet er in den Verästelungen seines Hirns vorsichtig nach etwas, woran er sich festhalten kann.
Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst?
Schweigen. Das Blubbern und leise Zerplatzen des im Wind trocknenden Schaums.
Wie bin ich hierhergekommen?
Ist mir etwas zugestoßen?
Plötzlich trifft ihn das Begreifen wie ein Keulenschlag. Abrupt bleibt er stehen.
Moment mal. Wer bin ich? Wie heiße ich?
Reglos steht er im Sand, die kurzen braunen Haare vom Wind zerzaust. Seine Gedanken rasen.
Woher komme ich?
Er weiß es nicht mehr. Er betrachtet die Blutspur an der Hand. Das Wort auf der anderen Seite. Die Panik überfällt ihn mit unglaublicher Geschwindigkeit.
Warum kann ich mich nicht erinnern? Warum weiß ich meinen Namen nicht mehr?
Das Gewicht dessen, was diese Fragen bedeuten, lastet mit jedem kalten Atemzug schwerer auf ihm. Eine abgrundtiefe Angst macht sich in ihm breit.
O Gott. Alles ist weg.
Seine Welt schrumpft auf die Größe eines Stecknadelkopfs und dehnt sich wieder aus, mit einem Mal beängstigend grenzenlos. Er hat keine Konturen mehr. Wer ist er? Er hat kein Selbst. Seine Augen tasten verzweifelt die Landschaft ab, doch sie bietet kein Entkommen von der Leere. Er ist hier, und es gibt kein Vorher. Es gibt keine Antworten.
Unfähig, seine rastlosen Gedanken einzufangen, durchwühlt er noch einmal die leeren Taschen. Nichts. Kein Ausweis, kein Telefon, kein Portemonnaie, kein Name, keine Schlüssel, nichts mit einem Namen darauf. Nichts, was ihm einen Anhaltspunkt bieten könnte.
Er versucht, seinen Atem zu kontrollieren, ruhig zu bleiben. Er versucht, klar zu denken.
Wenn mir etwas zugestoßen ist, wird mich jemand suchen. Irgendwer wird mich finden und mich dahin zurückbringen, wo ich herkomme. Ich werde mich erinnern. Jemand muss mich kennen. Und dann kommt alles zurück. Alles wird gut. Ich muss nur jemanden finden.
Er blickt auf, nimmt den Wald wieder wahr und entdeckt die Einbuchtung, wo ein Weg herunterführt. Er marschiert los – mit fieberhaften Schritten. Er muss jemanden finden.
Moment mal.
Wieder bleibt er abrupt stehen. Sein Selbsterhaltungstrieb meldet sich zu Wort.
Vielleicht hat es einen Grund, dass du allein hier draußen bist.
Er betrachtet das Wort, das auf seiner Hand geschrieben steht. Dieses Wort ist alles, woran er sich orientieren kann, aber es ist nicht genug.
Ist es eine Erinnerung? Eine Warnung?
Vielleicht ist etwas sehr Schlimmes geschehen? Er denkt an seine Kopfwunde. Falls ihn jemand überfallen hat, wäre es nicht die beste Idee zu riskieren, dass er entdeckt wird. Zumindest so lange nicht, bis er weiß, was passiert ist oder wer er ist. Er könnte noch immer in Gefahr sein. Es ist unmöglich zu sagen.
Er prägt sich das Wort auf seiner Hand ein und reibt sich die Tinte dann an der nassen Hose von der Haut, bis nichts mehr zu sehen ist. Er wird sich daran erinnern. Für den Fall, dass er gefunden wird, dürfte es am besten sein, alle Hinweise zu vernichten.
Tief in seinem Inneren regt sich ein gerade erwachender Gedanke. Etwas, das am Rand des Gedächtnisses entlangschleicht, eine Erinnerung, oder zumindest ihr Schatten. Gerade eben nicht zu greifen. Jemand sagt etwas zu ihm. Könnte er sich bloß erinnern. Jemand sagt ihm etwas Wichtiges, etwas sehr Wichtiges. Es ging um etwas, das er sich merken sollte. Etwas, das er tun sollte. Plötzlich ist es wieder da.
VERSAU ES NICHT.
Eine Erinnerung. Das hat man zu ihm gesagt, auch wenn er sich nicht richtig erinnern kann, wer der Sprecher war. Er klammert sich an die Worte. Ihre Warnung, ihre Drohung, so stark und eindeutig.
VERSAU ES NICHT.
Was sollst du nicht versauen? Denk nach. Denk nach.
Er jagt der Erinnerung hinterher, doch sie entwindet sich seinem Zugriff. Dann nimmt er wieder seine nackten Füße im Sand wahr. Ein Gedanke drängt an die Oberfläche. Er weiß, dass er einmal gelesen hat, dass Selbstmörder sich oft die Schuhe ausziehen, ehe sie sich das Leben nehmen. Ist er ein Selbstmörder? Woher er die Sache mit den Schuhen weiß, ist ihm nicht klar. Hat er sich selbst die Schuhe ausgezogen, sie irgendwo abgestellt, und seine Sachen, sein Leben, irgendwo ordentlich aufgestapelt? Aber warum hätte er das tun sollen? Er ist nicht traurig. Er fühlt sich nicht wie jemand, der sich das Leben nehmen will. Aber vielleicht kann sich das niemand von sich vorstellen?
Versau es nicht ist alles, woran er sich orientieren kann. Und wenn er es längst versaut hat?
Wieder blitzt in der Dunkelheit eine Erinnerung auf. Ein Signal. Jemand redet mit Nachdruck auf ihn ein.
DU MUSST SIE FINDEN.
Sie finden? Er richtet sich gerade auf. Das ist eine sonnenklare Anweisung. Ein Ziel.
Ist er deswegen hier? Um jemanden zu finden? Was bedeutet sie für ihn?
Er denkt an das Wort, das eben noch auf seinem Handrücken stand, und blinzelt.
Warum muss er sie finden?
Die Erinnerung ist das, was sie ist. Mehr ist da nicht. Wer auch immer diese Frau ist, er muss sie finden.
Man muss mir doch mehr gesagt haben.
Er versucht, den Zusammenhang herbeizuzwingen, doch tief in seinem Schädel regt sich das schmerzhafte Pochen wieder. Er lässt den Gedanken los.
Alles, was er weiß, ist, dass jemand auf ihn eingeredet, ihm eine Anweisung gegeben hat … er kann sich nicht erinnern, wer es war, wie die Stimme geklungen hat, wie das Gesicht aussah. Aber er muss demjenigen vertraut haben, so viel ist klar.
Wie kann er sie – diese Frau – finden, wenn er nicht weiß, nach wem oder was er sucht?
Ein weit entferntes Geräusch reißt ihn aus der Konzentration. Eine Stimme ruft. Instinktiv dreht er sich zum Wald um, sein Herz rast. Da ist niemand. Vielleicht der Wind, obwohl es eher so klang, als hätte jemand gerufen – einen Namen. Es kam aus dem Wald, eine Stimme, die vom Wind herübergetragen wurde. Er starrt noch lange, nachdem das Geräusch verklungen ist. Ganz sicher hat er etwas gehört. Einen Menschen.
Aber da ist keiner.
Er dreht sich wieder zum Wasser um.
Noch einmal das Geräusch. Diesmal direkt hinter ihm. Es ist eine Stimme. Er rührt sich nicht. Jemand steht direkt hinter ihm.
Langsam dreht er sich auf dem feuchten Sand um. Dort ist tatsächlich jemand. Eine junge Frau. Eben war sie noch nicht hier.
Wo ist sie hergekommen?
Er blinzelt und sucht verzweifelt nach einer Erklärung für das alles. Seine Gedanken überschlagen sich.
Eben war sie noch nicht hier, oder? Ist SIE es? Ist sie diejenige, die ich finden muss?
Doch im selben Augenblick weiß er Bescheid.
Sie ist es nicht.
Er betrachtet sie, wie sie ihm gegenübersteht und ihn anstarrt. Sie spricht mit ihm. Sie wirkt verwirrt, besorgt, als habe sie bereits längere Zeit geredet. Sie spricht, doch er kann die Worte nicht richtig verstehen. Ihre Sprache klingt entstellt, der Sinn erschließt sich ihm nicht.
Wieder dieses heftige Pochen im Kopf.
Ihr Blick hat einen bestimmten Ausdruck, und dieser Ausdruck sagt ihm alles, was er wissen muss. Für den Augenblick ist er in Sicherheit. Das wird ihm so deutlich wie der Sand, die Kälte und das strahlende, reflektierende Gelb in der Jacke der Frau.
Und plötzlich, für den Bruchteil einer Sekunde, erfasst er genau, was mit ihm geschieht. Dass es bereits so oft geschehen ist, exakt diese Szene, es ist eine Schleife, aus der es kein Entrinnen gibt. Und für einen kurzen Moment begreift er zumindest einen winzigen Teil dessen, was er als Nächstes tun muss. Zusammen mit diesem Wissen kommt die Panik, die sich in einer riesigen Woge über ihm auftürmt. Der grelle Schmerz in seinem Schädel explodiert, und er lässt sich in den Sand sinken.
2 – Dr. Emma Lewis
Dr. Emma Lewis
Tag 6 – London
Das ist mein Piepser. Es gibt viele solche Geräte, aber das hier ist meiner.
Während ich zur Station 10 haste und der Piepser tief unten in der Tasche meines Kittels vibriert, gehen mir die beiden Sätze immer wieder durch den Kopf wie ein Song, den ich nicht vergessen kann, oder der Jingle eines Werbespots.
Das ist mein Piepser. Es gibt viele solche Geräte, aber das hier ist meiner.
Ich weiß, es gibt originellere Mantras. Aber falls es jemanden interessiert: Eigentlich hat es als Gag im praktischen Jahr angefangen. Aus dem Gag wurde eine feste Gewohnheit, die mich, so seltsam es klingen mag, inzwischen tatsächlich beruhigt. So läuft es mit festen Gewohnheiten. Sie schenken Trost. Und sind schwer wieder loszuwerden. Wie das Rauchen. Aber davon bin ich weg. Ich bin nicht mehr diese Art Mädchen.
Ich bin überhaupt kein Mädchen mehr – ich bin eine dreißigjährige Frau. Ich bin die leitende Fachärztin für Neuropsychiatrie in einem stark ausgelasteten Londoner Krankenhaus. Würde ich meinen Arbeitsplatz verlassen und einen Tisch im Restaurant reservieren, dann liefe meine Buchung auf Dr. Lewis, nicht auf Ms Lewis. Natürlich nur, falls ich je Freizeit hätte, um ins Restaurant zu gehen.
Schlechte Angewohnheiten können zum Problem werden, wenn sich Zwölf-Stunden-Schichten gern mal zu Vierundzwanzig-Stunden-Schichten auswachsen. Aber gegen Mantras ist wahrscheinlich nichts einzuwenden.
Mein Gott, ich brauche eine Zigarette.
Als ich auf Station 10 eintreffe, schreit Mr Davidson, so laut es seine achtundsiebzig Jahre alte Lunge zulässt. Was ich einerseits verstörend, seltsamerweise aber irgendwie auch sympathisch finde. Am bemerkenswertesten ist wahrscheinlich die enorme Lautstärke. Ein Besucherpaar und ein Pförtner stehen reglos auf dem Gang und verfolgen den Tumult in seinem Zimmer.
Ihre Mienen entspannen sich, als sie meinen weißen Kittel registrieren, eine Reaktion, die mir inzwischen vertraut ist. Im Laufe der Jahre habe ich bemerkt, dass das Auftauchen eines Arztes bei den meisten Menschen entweder Beruhigung oder Besorgnis hervorruft.
Ich schalte meinen aufgeregten Piepser aus und lasse ihn wieder in die Tasche gleiten. Ärzte zählen zu den wenigen Menschen auf der Welt, die man noch mit Piepsern herumlaufen sieht. Wir benutzen sie weiterhin, weil sie zuverlässig sind. Im Gegensatz zu Mobiltelefonen kennen sie keine Funklöcher; sie funktionieren überall, selbst in der streng abgeschirmten Röntgenabteilung eines Krankenhauses. Außerdem ist nicht alle paar Stunden der Akku leer. Piepser können länger als eine Woche ohne Aufladen durchhalten. Und sie sind robust. Werfen Sie einen Piepser, nur zum Beispiel, wutentbrannt und in Tränen aufgelöst gegen eine Betonwand. Sie werden ihn damit nicht kleinkriegen.
Als ich in das fragliche Krankenzimmer trete, stehen ein Assistenzarzt, zwei Schwestern und Mr Davidsons vierzigjähriger Sohn tatenlos herum, während der bettlägerige Mr Davidson immer weiter schreit. Tränen laufen ihm langsam über das müde, faltige Gesicht. Bei meinem Eintreten drehen sich sämtliche Köpfe zu mir um. Das macht der Kittel.
Der Assistenzarzt wirft mir einen fragenden Blick zu. Seine Miene verrät, dass er überglücklich wäre, wenn ich die Sache in die Hand nähme. Ich nicke ihm beruhigend zu. Schließlich ist das der Grund, warum sie mich hergerufen haben.
Mr Davidsons Schreie und die Atmosphäre im Zimmer sind eindeutige Anzeichen dafür, dass die Situation irgendwie in eine Sackgasse geraten ist. Mr Davidson will sich nicht anfassen lassen.
„Guten Morgen, Mr Davidson“, sage ich fröhlich und versuche, noch mehr Energie aufzubringen als er.
Im Rhythmus seiner Schreie wird eine leichte Veränderung spürbar. Er schaut mich überrascht an, und als ich fortfahre, habe ich seine volle Aufmerksamkeit. „Ich bin Dr. Lewis. Erinnern Sie sich an mich, Mr Davidson? Ich bin Ihre Ärztin. Emma Lewis.“ Ich lächle ihm beruhigend zu, wie um zu sagen: Natürlich erinnern Sie sich an mich, wir sind alte Freunde.
Er klammert sich an mein Lächeln, lässt sich von seinen Gedanken ablenken, und endlich ebbt sein Schreien ab. Zögerlich nickt er mir zu, obwohl er noch nicht restlos überzeugt ist, dass wir uns tatsächlich kennen.
„Können Sie mir sagen, was Ihnen fehlt, Mr Davidson?“
Sein tränenüberströmtes Gesicht wird glatter, als er sich müht, meine Frage zu entwirren.
„Haben Sie Schmerzen, Mr Davidson? Wo tut es Ihnen weh?“ Ganz vorsichtig übernehme ich die Initiative. Jetzt wendet er den Blick ab und schaut zum Fenster.
Es ist schwer zu sagen, inwieweit Mr Davidson mich erkennt, wenn überhaupt. Howard Davidson hat Schwierigkeiten, an seine Erinnerungen heranzukommen und sie festzuhalten. Ich behandele ihn, seit er vor drei Wochen eingewiesen wurde. Das Wiedererkennen ist ein komplexer neurologischer Prozess, und Menschen verbergen es sehr, sehr geschickt, wenn ihnen dieser Prozess misslingt. Sie richten sich sozusagen um den Gedächtnisverlust herum ein, indem sie sich auf andere Dinge verlassen – visuelle Anhaltspunkte, soziale Anhaltspunkte. Sie entwickeln großes Geschick darin, Menschen und Situationen zu deuten und sich übergangsweise auf diesen Nebengleisen zu bewegen, bis sich ein echtes Erkennen einstellt. Doch unabhängig davon, ob Howard Davidson mich erkennt oder nicht, scheint er mir zu vertrauen. Er schreit nicht mehr, und das ist unzweifelhaft ein Fortschritt.
Vorsichtig nähere ich mich seinem Bett. Er dreht sich um und schaut mich erschöpft und neugierig zugleich aus großen, feuchten Augen an. Sanft lege ich ihm eine Hand auf den Arm, um ihn zu beruhigen.
Er betrachtet meine Hand. Sein Brustkorb hebt und senkt sich in dem mühevollen Versuch, den Atem wieder unter Kontrolle zu bekommen. Er entzieht sich meiner Berührung nicht und schlägt nicht um sich. Patienten mit Gedächtnisstörungen reagieren manchmal überraschend aggressiv bis hin zu körperlicher Gewalt. Doch als er mir wieder in die Augen schaut, ist sein Blick nicht feindselig, sondern flehend.
„Wo genau spüren Sie die Schmerzen, Mr Davidson?“, frage ich wieder mit sanfter Stimme.
Er kann noch immer kaum richtig atmen. Kein Wunder, hat er sich doch eine ganze Weile ohne Unterbrechung vor einem verwirrten und tief beunruhigten Publikum verausgabt. Als er mich mit schnappenden Atemzügen anstarrt, wirkt er wie ein Mann, der sich in einem fremden Land verirrt hat.
Er klopft sich auf die Brust. Sein Herz. Das ist die Antwort. Die Antwort auf meine Frage. Dort spürt er den Schmerz: in seinem Herzen.
Ich nicke und drücke leicht seinen Arm.
Ich habe Sie verstanden.
Ernst nickt Mr Davidson mir zu, gut!, dann bricht er in einen heftigen Hustenanfall aus.
Mit seinem Herzen ist alles in Ordnung – na ja, rein körperlich zumindest. Howard Davidsons körperliches Problem ist sein Gehirn. Aus seiner Sicht betrachtet, ist er ein Zweiunddreißigjähriger, der im Körper eines Achtundsiebzigjährigen gefangen ist. Vor drei Wochen ist er morgens aufgewacht, ohne eine einzige Erinnerung an die letzten sechsundvierzig Jahre seines Lebens zu haben. Woran er sich erinnern kann, ist, dass er im Jahr 1973 sein Haus verlassen hat. Und nun ist er hier wieder aufgewacht, als alter Mann. Was Howard Davidson fehlt, lässt sich nur auf einer MRT-Aufnahme erkennen. Große Bereiche seines Neokortexes sind atrophiert, verkümmert. Sämtliche Erinnerungen, die in diesen Bereichen gespeichert waren, sind verloren. Ein großer Teil seines Lebens hat in seiner Erinnerung nie stattgefunden. Vor drei Wochen noch ist es ihm gut gegangen. Er hat im Garten herumgewerkelt, seinen Hund ausgeführt, gelesen. Ein alter Mann im Fluss seines Lebens, zufrieden im Ruhestand. Doch diesen alten Mann gibt es nicht mehr.
Howard Davidson fiel auf, als er über den Mittelstreifen einer vierspurigen Schnellstraße in Shepherd’s Bush spazierte. Man brachte ihn gleich in die Notaufnahme. Nachdem seine Angehörigen erklärt hatten, dass bei ihm keine Alzheimer-Demenz diagnostiziert worden sei und dass er noch am Vormittag das Leben eines Abgeordneten im Ruhestand genossen habe, wurde ein MRT durchgeführt.
Die auf der Aufnahme sichtbare Atrophie deutete auf eine vaskuläre Demenz hin, genauer gesagt, auf eine Einzelinfarkt-Demenz. Durch einen einzigen Hirnschlag ist ein großer Teil des Hippocampus zerstört worden.
Sechsundvierzig Lebensjahre, ausgelöscht in einem Wimpernschlag. Er hat keine Erinnerung an seine Kinder, an seine Wahlkämpfe, und er glaubt noch immer, dass er mit seiner jungen Frau Ginny in einer Seitenstraße der Goldhawk Road wohnt. Dort enden seine Erinnerungen.
Aus der Kanne auf dem Nachttisch gieße ich ihm ein Glas Wasser ein. Er nimmt es mit zittriger Hand entgegen. Dann schaue ich mich zu der Gruppe hinter mir um, auf der Suche nach einer Erklärung für Mr Davidsons augenblicklichen Zustand. Dabei habe ich bereits einen Verdacht.
Sein Sohn erwidert meinen Blick. Simon Davidson und ich sind uns schon einmal begegnet, kurz, am Tag von Howards Einweisung.
Ich verrate Ihnen ein Geheimnis, das wir in der Ausbildung lernen: Manche Dinge lassen sich nicht heilen. Manchmal geht es darum, mit ihnen zu leben. Sich einzurichten. Davon wollte Simon Davidson nichts wissen.
Ich bin lange genug in meinem Beruf, um in solchen Situationen meinem Instinkt zu trauen. Und im Moment sagt mir dieser Instinkt, dass Simon höchstwahrscheinlich die Verantwortung für diesen Vorfall trägt. Ärzte und Krankenschwestern bringen erwachsene Männer selten zum Schreien. Zumindest nicht in ihrer professionellen Umgebung. Also nicke ich den Kollegen zu, die sich dankbar an Simon vorbei aus dem Zimmer schleichen.
„Simon, wäre es möglich, dass wir uns kurz draußen unterhalten?“
In dem Bewusstsein, dass er als Einziger herausgepickt wird, weiten sich kurz Simons Augen. „Ähm, ja. Ja, klar.“ Er nickt mir ohne große Begeisterung zu und wendet sich zur Tür.
„Ich bin gleich bei Ihnen.“ Ich schenke ihm ein aufmunterndes Lächeln, doch er verlässt das Zimmer stirnrunzelnd und wenig überzeugt. Zuallererst aber muss ich Mr Davidson beruhigen, meinen eigentlichen Patienten. Danach kann ich mich um seinen Sohn kümmern.
Ich sehe, wie die Tür sanft hinter ihm ins Schloss fällt.
„Wer war der schreckliche junge Mann?“, fragt eine zittrige Stimme in meinem Rücken.
Ich drehe mich um und betrachte die zerbrechliche Gestalt Mr Davidsons, sein knittriges Gesicht, die gutmütigen Augen. Ich spüre einen Anflug von Traurigkeit. Natürlich spricht er von seinem Sohn. Aber was mich wirklich berührt, ist die Vorsicht, mit der er seine Frage stellt. Die Behutsamkeit mir gegenüber, denn er könnte mich ja beleidigen, im Fall, dass der schreckliche junge Mann mein Freund ist.
„Alles in Ordnung, Howard, wir beide sind jetzt allein“, versichere ich ihm. Ich trete wieder ans Bett, greife nach seinem schmalen Handgelenk und fühle den Puls. Erhöht, aber im Rahmen. „Hat der Mann, der gerade hier war, Sie aufgeregt, Howard?“
Ich kenne die Antwort schon. Es ist nicht das erste Mal seit Mr Davidsons Einweisung, dass so etwas passiert ist, so viel steht fest. Und er ist auch nicht der erste Patient, der so reagiert.
Howard Davidson rutscht in seinem Bett ein kleines Stück höher. „Dieser junge Mann. Nicht der andere Arzt, sondern der kleinere Mann. Er hat gesagt, Ginny wäre gestorben. Meine Frau. Ginny. Ich weiß nicht, wer er ist oder warum er so etwas sagt. Ich meine, wie kommt er dazu, so etwas zu sagen?“ Er mustert mich wie ein hingefallenes Kleinkind, das noch nicht weiß, ob es lachen oder weinen soll. „Und wie er es gesagt hat, so merkwürdig. Ich hatte gefragt, wann sie herkommt, und er sagt einfach: ›Sie ist tot.‹ Kurz und knapp, als hätte es nichts zu bedeuten. Meine Ginny tot.“ Er stößt sich mit den Fingern auf die Brust, allein schon die Erinnerung versetzt ihn aufs Neue in Aufregung. „Warum sagt er so etwas?“ Er schaut zu mir auf, die feuchten Augen voller Panik. „Ginny geht es doch gut, oder? Als ich das Haus verlassen habe, war alles in Ordnung. Der andere Arzt wollte mir nichts sagen. Es geht ihr gut, oder? Ich hätte nicht aus dem Haus gehen dürfen.“ Er ballt die zerbrechlichen Hände auf dem Bettbezug zu Fäusten.
Ginny ist vor elf Jahren, im Alter von zweiundsechzig, an Schilddrüsenkrebs gestorben. Fairerweise muss man sagen, dass Howards Sohn wahrscheinlich einfach versucht hat, ihn daran zu erinnern. Aber wahrscheinlich auf diese leicht genervte Art und Weise, die viele Menschen gegenüber Demenzpatienten an den Tag legen.
„Geht es Ginny gut?“ Die Muskeln unter seinen Augen zucken. Er ist müde.
Sanft nehme ich seine Hand. „Ja, mit ihr ist alles in Ordnung, Howard. Es geht ihr sehr gut. Sie lässt Sie herzlich grüßen, und sie hat mir gesagt, dass sie es heute Nachmittag nicht schafft. Aber morgen wird sie gleich als Erstes kommen.“ Ich sage das, weil er mein Patient ist und mir daran liegt, dass es ihm gut geht. Und morgen wird er sich nicht daran erinnern, was ich gesagt habe.
Er lächelt und drückt mir die Hand, so fest er kann. Wieder füllen sich seine Augen mit Tränen. „Danke. Danke, ich hatte solche Angst um sie. Ich weiß nicht, was ich ohne meine Ginny tun würde. Und wenn ich keine Gelegenheit hätte, mich von ihr zu verabschieden, dann …“ Natürlich hatte er die Gelegenheit, sich von ihr zu verabschieden – vor elf Jahren, an ihrem Bett, just in diesem Krankenhaus.
Mr Davidson wird sich nicht an die Worte erinnern, die wir gesprochen haben, aber an die Gefühle, die das Gespräch in ihm weckt.
Ich lüge ihn nicht an. Ich weigere mich bloß, mich wie ein Unmensch zu verhalten.
Wir können Howard nicht jedes Mal, wenn er uns fragt, erklären, dass seine Frau tot ist. Das wäre pure Grausamkeit. Warum sollte dieser Mann jeden Tag aufs Neue den schlimmsten Tag seines Lebens durchmachen müssen? Draußen im Gang versuche ich, genau das seinem störrischen Sohn zu erklären.
„Wollen Sie damit sagen, dass wir ihn anlügen sollen? Jeden Tag? Bis zu seinem Tod?“ Simon spricht leise, aber in scharfem Ton.
Dies ist keine Diskussion, die wir auf dem Gang führen sollten, obwohl ich bezweifle, dass irgendein anderer Ort das, was ich zu sagen habe, angenehmer machen würde. „Sie müssen sich einfach die Frage stellen, Simon, wer etwas davon hätte, wenn er sich an den Tod Ihrer Mutter erinnert? Warum sind Sie so darauf bedacht, dass Ihr Vater sich ausgerechnet an diesen Vorfall erinnert?“
Er starrt mich an, von meiner Frage überrumpelt. Verwirrt, weil er geglaubt hat, dass auch in Krankenhäusern die Regel gilt, nach der der Kunde immer recht hat. Er schluckt die böse Bemerkung, die ihm offenbar auf der Zunge liegt, herunter und erwidert nur: „Ich möchte, dass er sich erinnert, weil es wahr ist. Es ist wichtig, dass er sich erinnert, denn es ist die Wahrheit.“
„Ja, es ist die Wahrheit, Simon. Aber vieles ist wahr. Theoretisch könnte ich jetzt in die Onkologie hineinmarschieren und allen dort erzählen, dass neunzig Prozent von ihnen es definitiv nicht schaffen werden. Aber was, um alles in der Welt, sollte das nützen? Ihr Vater wird sich nicht mehr erholen. Er wird sich an diese Dinge nicht erinnern, egal, wie oft Sie ihm alles erzählen. Er wird sich nur aufregen. Und wenn Sie es ihm sagen, wird er Sie hassen, Simon. Er könnte noch fünfzehn oder sogar zwanzig Jahre vor sich haben. Vielleicht überlebt er uns alle. Und ich glaube, wir möchten beide, dass die Jahre, die er noch hat, glücklich werden. Ich würde Ihnen raten, in Zukunft Ihrer Schwester die Rolle als unsere Hauptansprechpartnerin zu überlassen und nicht mehr so häufig zu kommen, wenn Ihnen meine Vorstellungen so stark widerstreben. Falls Sie Ihre Besuche aber fortsetzen wollen, muss ich Sie bitten, ihn nicht mehr sehenden Auges aufzuregen. Er ist äußerst verletzlich, und das, was Sie tun, grenzt an seelische Misshandlung.“ So hart das klingen mag, letztlich ist Howard mein Patient. Ich bin für sein Wohlergehen verantwortlich, nicht für das seines Sohnes.
Einen Moment lang starrt Simon mich zornig an, dann sagt er: „Ich verstehe. Ähm, also … mir war, ehrlich gesagt, nicht klar, dass ich ihn so quäle …“
Im Grunde wollen die Menschen von uns Ärzten nicht die Wahrheit hören. Sie mögen es selbst glauben, aber es ist nicht so. Ärzte sollen wie Priester sein. Sie sollen mit ihrer Autorität Hoffnung wecken.
Ich sehe, dass mir aus dem Schwesternzimmer eine Pflegerin zuwinkt. Sie deutet auf den Telefonhörer an ihrem Ohr. Ich empfehle Simon eine Angehörigenberatung und verabschiede mich von ihm.
Mit einem aufmunternden Lächeln reicht mir die Schwester das Telefon. Der Nächste, bitte.
„Hi Emma.“ Ich höre die Stimme meiner Sekretärin Milly. „Tut mir leid, dass ich Sie durchs ganze Gebäude verfolge, aber eben hat jemand aus den USA angerufen. Ich hab gesagt, Sie hätten Bereitschaft, und der Anrufer will es um halb neun noch mal probieren. Da ich Sie inzwischen nicht mehr gesehen habe, wollte ich Ihnen auf jeden Fall Bescheid geben.“
Ich schaue auf die Armbanduhr: Es ist 8:27 Uhr. Ich kann es gerade noch rechtzeitig auf die Neuropsychiatrie schaffen – wenn ich laufe.
„Wer war denn dran, Milly?“
„Ähm, ein gewisser Richard Groves. Dr. Groves?“
Ich runzele ungläubig die Stirn. „Richard Groves? Das kann nicht sein. Sind Sie sicher?“
„Den Namen hat er jedenfalls genannt.“ Sie klingt leicht desinteressiert. Ich höre, wie sie beim Telefonieren weitertippt.
„Der Richard Groves?“
Am anderen Ende herrscht für einen Moment Stille. „Ähm … ich weiß nicht, Emma, tut mir leid. Ich hab bloß den Namen notiert, den er mir genannt hat. Warum? Wer ist das denn?“
Einen Moment lang spiele ich mit dem Gedanken, es Milly zu erklären, doch dann überlege ich es mir anders. Wenn ich ihr sagen würde, wer Richard Groves ist, würde ihre Reaktion nicht annähernd angemessen ausfallen. Sie könnte ihn googeln – was sie sicher nicht tun wird – und würde auf eine drei Jahrzehnte währende Karriere an vorderster Front der Gehirnforschung stoßen. Sie würde von den Bestsellern, Essays, Lehrstühlen und Beratertätigkeiten für Wirtschaft und Politik erfahren, die neue Behandlungsmethoden, neue Verfahren, neue staatliche Richtlinien angestoßen haben. Sie könnte meine genaue Berufsbezeichnung googeln, was sie natürlich auch nicht tut, und feststellen, dass sein Name im Wikipedia-Artikel „Neuropsychiatrie“ genannt wird. Meiner nicht. Nun ja, noch nicht.
„Okay, hat er wenigstens gesagt, warum er anruft, Milly?“
„Ähm …“ Ich höre das Rascheln von Papier. „Ähm, nein. Nein, hat er nicht.“
Ich bin Richard Groves zweimal begegnet. Zuletzt ganz kurz bei einer Konferenz zur Vernetzung medizinischer Forschung in Dubai vor drei Jahren. Ich habe meine Doktorarbeit über ihn geschrieben und war – bin – mit manchen seiner Methoden nicht einverstanden, aber das ist in medizinischen Doktorarbeiten ganz normal. Es gehört zur wissenschaftlichen Methodik. Als wir uns begegnet sind, war er freundlich, kollegial. Aber ich kann wirklich nicht behaupten, dass wir häufiger telefonieren. Deshalb kommt dieser Anruf völlig aus heiterem Himmel. Warum, um alles in der Welt, ruft er mich morgens um acht aus Amerika an?
Natürlich kann Milly diese Frage nicht beantworten. Wieder schaue ich auf die Uhr. Zwei Minuten noch. Wenn ich renne, kann ich es schaffen.
In einem Interview haben Sie einmal gesagt, dass Sie versuchen, pro Woche ein Buch zu lesen, was recht eindrucksvoll ist! Wie läuft's damit?
Das stimmt. Letztes Jahr hatte ich mir selbst die Aufgabe gestellt, ein ganzes Jahr lang ein Buch pro Woche zu lesen, was nicht ganz geklappt hat. Aber ich habe alle zwei Wochen ein Buch geschafft – was für mich ziemlich gut war! Ich konnte feststellen, dass ich ein bisschen weniger ferngesehen und etwas weniger auf mein Handy geschaut habe, was nie schlecht ist. Und ich habe es ruhiger angehen lassen, Zeit gewonnen und mich entspannt. Bisher führe ich den „Jede zweite Woche ein Buch“-Plan auch in diesem Jahr weiter ...
Was bevorzugen Sie, physische Bücher oder E-Books?
Definitiv Bücher. Ich habe E-Books ausprobiert, aber ich liebe die körperliche Tätigkeit des Lesens einfach viel zu sehr, um umzusteigen. Man kann das Gewicht eines Buches, diesen Papiergeruch und das Geräusch des Umblätterns von Seiten nicht überbieten.
Welches ist das beste Buch, das Sie je gelesen haben? Und was war Ihr Lieblingsbuch als Kind?
Wow, das ist eine große Frage – mit einer sich ständig verändernden Antwort. Aber ich würde sagen, dass Stoner von John Williams mein aktuelles Lieblingsbuch ist. Als Kind war ich von Douglas Adams besessen. Ich habe Per Anhalter durch die Galaxis oft gelesen. Eigentlich habe ich wirklich sehr viel von allem gelesen.
Welches Buch, das Sie gelesen haben, hat Sie am meisten beeinflusst?
Es gibt ein paar Bücher, die mir in den Sinn kommen, aber Jane Eyre wäre definitiv eines davon. Ich liebe den direkten Kontakt, den Jane mit dem Leser hat, er macht das Buch so modern und bedeutend, ganz unabhängig davon, wann es geschrieben wurde – ich habe nicht das Gefühl, dass ich diese Verbindung zwischen Protagonist und Leser in diesem Ausmaß zuvor in irgendeinem Buch erlebt habe. Für mich haben Chuck Palahniuk und Gillian Flynn diese gleiche Unmittelbarkeit. Das finde ich aufregend, und auf dieser Grundlage würde ich alles lesen, was die beiden schreiben.






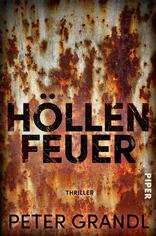




DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.