
Immer ich
Erzählung
„Walser ist eine Meisterin darin, Sexualität zu schildern, ohne peinlich direkt oder peinlich verzuckert zu werden. Sexuelle Begegnungen sind hier Zwischenzustände, die aus dem Alltag herausfallen, weil sie die Illusion einer Zusammengehörigkeit erzeugen. Dabei wissen die Beteiligten aber jederzeit, dass es sich um eine Illusion handelt. Vielleicht liegt es daran, dass man beim Lesen das Gefühl bekommt, es mit lauter Verlorenen zu tun zu haben. Oder mit Menschen, die ihr Leben bloß träumen. In den Bildern, die dabei entstehen , sind aber ganz genau und mit allen Sinnen beteiligt.“ - Der Tagesspiegel
Immer ich — Inhalt
Ob vier Menschen in Brooklyn versuchen, Weihnachten mit einem verstimmten Klavier zu feiern, oder eine Frau den begehrten Mann ins Pornokino schickt – Alissa Walser ist eine Meisterin der Kurzform, der Tiefenvirtuosität, die mit Raffinesse unsere normalerweise verschwiegenen „menschlichen Zwischenräume“ ausleuchtet. Sie entwirft mit schlafwandlerisch sicheren Strichen emotionale Gefüge zwischen Frauen und Männern, Freunden und Freundinnen, Eltern und Kindern. Manchmal steckt schon in einem einzigen Satz ein scheinbar vertrauter Roman. Aus Leben entstehen Bilder, und umgekehrt werden die Bilder lebendig. Die Sicht der Autorin, ihre kluge Wahrnehmung, kristallisiert die Verhältnisse in klarer poetischer Sprache.
Leseprobe zu „Immer ich“
Dein ist sie nicht
(tut mir leid, es zu sagen)
die erzählte Geschichte.
Anne Carson
Immer
ich
Er blickt zu mir herauf. Er wird der erste Tote meines Lebens sein, aber das weiß ich noch nicht. Ich weiß, in seinem Herzen steckt eine Kugel, und wundere mich, dass man mit einer Kugel im Herzen leben kann. Ich kenne niemanden sonst mit einer Kugel im Herzen. Und weiß auch nicht, wie sie dahin gekommen ist.
Später, wenn es mir meine Mutter, während sie dreckiges Geschirr abspült und in die Maschine sortiert, verraten wird, werde ich plötzlich spüren, wie es ist, [...]
Dein ist sie nicht
(tut mir leid, es zu sagen)
die erzählte Geschichte.
Anne Carson
Immer
ich
Er blickt zu mir herauf. Er wird der erste Tote meines Lebens sein, aber das weiß ich noch nicht. Ich weiß, in seinem Herzen steckt eine Kugel, und wundere mich, dass man mit einer Kugel im Herzen leben kann. Ich kenne niemanden sonst mit einer Kugel im Herzen. Und weiß auch nicht, wie sie dahin gekommen ist.
Später, wenn es mir meine Mutter, während sie dreckiges Geschirr abspült und in die Maschine sortiert, verraten wird, werde ich plötzlich spüren, wie es ist, ohne Kugel im Herzen zu leben. Vorerst muss es ein Geheimnis bleiben. Etwas zwischen ihr und ihm wie zwischen Christkind und Osterhase. Nicht groß, aber geheim.
In dem Alter, in dem ein Kind Schuhe binden lernt, war ich mit meiner Mutter, mit meinen Geschwistern, ohne meinen Vater und noch ohne, wir sagten Onkel zu ihm, Onkel Uwe in eine neue Wohnung gezogen. Eine große Wohnung. Eine Wohnung mit einem Zimmer mehr. Ein Zimmer mehr wie ein Gedeck zu viel auf dem gedeckten Tisch.
Inzwischen kniet er neben mir – in meiner Erinnerung. Ich sehe seinen Kopf von oben. Schütteres, streichholzkuppenkurzes, weißes Haar, das wie der Schaum am Strand auf seinen Speckfalten im Nacken ausläuft. In meiner Erinnerung ist sein Gesicht von Linien durchzogen wie ein Bewässerungssystem. Und wenn sein Mund lächelt, wird der ganze Kopf von seinem Lächeln geflutet. Er ähnelt einem Buddha. Die dicke Variante. Die dicke und alte Variante.
Er hat sich mein rechtes Bein zwischen die Knie geklemmt und zieht den Schnürsenkel fest, wo immer er ihn zu fassen bekommt. Unterste, zweitunterste und so weiter Öse meines lackroten Kinderstiefels. Größe 31. Er arbeitet.
Unten, sagt er, legt man den Finger drauf, da muss es straff bleiben.
Sieht einfach aus. Die losen Enden des Schnürsenkels werden nach oben automatisch kürzer. Hinter den letzten Ösen hält er sie wie Zügel, zieht und zieht. Zieht mein Bein mit hoch, und ich verliere das Gleichgewicht. Wir lachen, als er mich auffängt.
Stehen bleiben, sagt er. Stellt mich wieder auf die Beine, drückt meinen Fuß auf den Boden und zaubert direkt unterhalb meines Knies eine schöne, symmetrische Schleife.
So, sagt er. Und jetzt du.
Ich fädele den Senkel durch die untersten Ösen des linken Stiefels. Zerre an den Enden.
Zieh doch, zieh, sagt er.
Ich kippe, er fängt mich.
Es funktioniert nicht. Geht nicht, sage ich.
Immer ich sagen, sagt er.
Vielleicht geht’s anders, sage ich.
Na, dann zeig mir doch wie.
Ich fädele den Schnürsenkel locker von oben nach unten und über Kreuz wieder hoch. Bis zur Wade etwa, und beginne zu ziehen. Links geht es leicht. Rechts rührt sich nichts. Um die Wade liegt der Schaft einigermaßen eng an. In Knöchelhöhe ragt der Schnürsenkel als lose Schlinge über die lederne Zunge hinaus.
Hm, sagt er und, Ob es so halten wird?
Man braucht halt Kraft, sage ich.
Immer ich sagen, sagt er. Und wenn ich mich richtig erinnere, verwandelte er die Geste seines sich ansatzweise zwischen uns aufrichtenden Zeigefingers unauffällig in ein etwas verlegenes Augenwinkelauswischen.
Meine Mutter hat, keiner weiß, warum, wieder mal Kalbsvögel gekocht.
Schon die Wortkombination ist unverdaulich. Das kann man nicht essen. Pfui Teufel.
Immer ich sagen, lächelt Onkel Uwe und wartet, die Gabel mit einem abgeschnittenen Stück, in dessen Mitte ein weinendes Speckauge glänzt, vor dem offenen Mund, dass ich mich korrigiere.
Kann man trotzdem nicht essen, den Fraß, zitiere ich, ohne ihn zu verraten, meinen Bruder, der es hinter vorgehaltener Hand wenigstens gleich beim richtigen Namen nannte: Kann man nicht fressen, das Aas.
Ich schon, verkündet Onkel Uwe, wenn du mit „man“ auch mich meinst.
Onkel Uwe, diese Verkörperung der Abwesenheit meines leiblichen Vaters, war ein freundliches, schwammiges Wesen, das uns Kinder gelten ließ. Ich mochte ihn, aber er zählte nicht. Und wenn eines der Kinder krank war, kümmerte er sich mit Kräutertee und kalten Wickeln. Das ganze selbstlose Programm. Das Hand auf die Stirn legen, das Fieber messen.
Und die Zeit kreist um sich selbst. Wie die Kugel in seinem Herzen. Ich halte die Luft an. Und die Zeit bleibt stehen. Das Essen wird kalt, das Loch immer größer. Ich denke, das Loch in seinem Herzen, das die Kugel einschließt, ist auch nur eine Kugel.
Irgendwann sinkt seine Gabel auf den Teller. Ich atme wieder. Ich weiß nicht, ob ein oder aus. Alle schauen auf ihre Teller und kauen. Nur ich schlucke, ohne zu kauen, laut und deutlich.
Mädchen
namens Debbie
Mein Baby hat einen Tinnitus, sagt er. Sie wünscht sich ein Klavier.
Auf jeden Fall besser als ein Klavier haben und sich einen Tinnitus wünschen, denke ich, und da räuspert er sich und setzt noch eins drauf: Mein Baby ist eine Renaissance-Frau. Sie wünscht es sich zu Weihnachten.
Brooklyn bringe ich eher mit Verbrechen in Verbindung, sage ich, als mit Weihnachten und Musik.
Ach wirklich, sagt er und schaut auf die Uhr.
Ja, sage ich. Mit Dunkelmännern und Voodoozauber im Prospect Park und in den Statistiken.
Die alten Klischees, sagt er.
Und ich sage, Dein Baby glaubt doch nicht wirklich, dass sie ein Klavier kriegt, oder?
Wie meinst du das, sagt er.
Ich meine, sage ich, um acht ist Bescherung. Wo willst du denn jetzt noch ein Klavier auftreiben?
Wait and see and hope to see it.
Den ganzen Nachmittag hatte ich gerätselt, was mit diesem Mädchen los war. Sie hatte, als wir die Treppe raufstiegen, neben ihm in der offenen Tür gestanden und zu uns herabgeschaut. Jeff, beladen mit einem Riesenpaket, und ich – links den Campari, rechts freie Hand – hüpfte hinterher. Sie hielt eine Kamera vor ihrem Gesicht. Sie suchte und knipste. Eine blond gefärbte Jackie O. im selbst entfachten Blitzgewitter. Schaffte sie Rummel um sich, weil keiner sonst es tat?
Weihnachten 1990. Brooklyn. Diese Wohnung. 7th Ave. Appt.3C. Brownstone, top floor, bay windows. Ecke 15te Straße. Die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft irgendwo zwischen Küche und Schlafzimmer. Man blickt über die Straße in die schlechte Gegend. Von dort blickt nichts zurück. Vernagelte Haustüren, vermauerte Fenster. Brandflecken und Graffiti.
Jeff stieg keuchend und arschwackelnd vor mir her, und dieses Mädchen schaute von oben zu. Ich weiß noch, wie ich bei jedem Blitz dachte, die schießt auf uns, die wehrt sich, die will uns nicht reinlassen. Und wie ihr Freund sich auf die Schenkel schlug und sagte, Ich fass es nicht. Er hat sie. Jeff, he Alter, du hast sie!
Im ersten Moment dachte ich, er rede von mir, aber er meinte das überdimensionierte Paket, von dem alle wussten, was drin war. Wir hätten uns das Einpacken sparen können. Aber auch Jeff neigt zu Klischees: Verpackung vergrößere die Vorfreude. Und beim Schenken gehe es doch hauptsächlich ums Auspacken. Um das Zuendebringen eines Wunsches. In dem Moment, in dem man das Gewünschte plötzlich sieht.
Im Moment sah er nichts, denn er trug das Riesen-Paket vor sich her, die Stirn an den Karton gepresst. Ich dicht hinter ihm. Sein Parka roch nach Schnee. Kann das sein?
Oben übergab Jeff das Paket an seinen besten Freund. Geschenke statt Küsse. Dann drehte er sich um.
And this is the German woman I thought you wanted to meet … Nina, sagte er. Seine Hand schlug Haken zwischen ihr und mir. Meinte er jetzt sie oder mich?
Sie schleuderte mir Blitze ins Gesicht, bis ihr Freund mich rettete.
He, mach sie nicht blind, sagte er. Sie hörte auf. Es war das einzige Mal, dass ich sie lächeln sah. O Gott, hoffentlich irrte Jeff sich nicht. Überall auf der Welt geht sich Deutsch und Deutsch aus dem Weg. Ist doch bekannt. Seit dem Untergang des Tausendjährigen Reichs arrangiert es sich – mal mehr, mal weniger – wie Hund und Katz. Nur Jeff (geboren in Maine, aufgewachsen in Brooklyn) weiß nichts davon, dachte ich, als wir uns aus den Jacken wanden.
Die Männer verschwanden rechts, Nina links. Ich ihr nach in die Küche, diesen Schlauch nach hinten mit Blick auf schwarzes Dachpappeland. Wassertürme, Gärten, Balkone, Bäume. Ich lernte Brooklyn neu kennen. Weit in der Ferne ein Streifen helles Wasser. Dahinter die Zwillingstürme (o ja, sie standen), wie eine römische Zwei, dabei winzig und zart und farblos wie ungekochte Shrimps. Nicht auszumachen, ob sie Wasser spiegelten oder Himmel.
Nina versuchte im Kühlschrank Platz zu schaffen. Ich sah zu, über einen Stapel Alu-Grillschalen hinweg, über ein Päckchen Hormonpillen, über den Toaster und ein paar Dosen Katzenfutter, über zwei braune, mit Milch und Früchten gefüllte Grand-Union-Tüten.
Jemand verschätzt sich hier andauernd, sagte Nina und fing an einzuräumen. Ständig bringt irgendwer was mit. Zu viel Zeugs, zu viele Geschenke, zu viele Dinge.
Quetschmassen wie meinen Frauen-Körper, den ich inzwischen schlechten Gewissens versuchte den Ausmaßen des Küchen-Klappstuhls (vierzig auf vierzig) anzupassen. Aber Arme und Beine standen über, immer stand irgendetwas über.
Du meinst mich, sagte ich. Ich bin das Mitbringsel. Diesmal, meinst du, hat Jeff sich verschätzt.
Nina schaute überrascht auf, sagte, Immer alles gleich auf sich beziehen. Ist nicht gesund, macht unglücklich. Dir, fügte sie hinzu, muss ich doch dankbar sein. Du hast doch nichts mitgebracht, oder? Sie lachte. Und dann schwieg sie eine Weile, und ich redete. Na ja, ein paar Sätze hat sie noch gesagt. Drei oder vier vielleicht. Aber gelacht hat sie nicht mehr. Und ich habe versucht, sie umzustimmen. Ausgerechnet ich. Selber ständig auf der Suche nach was zum Lachen. Jeden Satz check ich ab nach dem lächerlichen Kernchen, Pünktchen, Fünkchen. Findet man doch in allem, wenn man will. Aber Nina wollte nicht. Sie hatte sich zu mir an den Tisch gesetzt und ließ mich Sätze sagen wie: Ich will mit netten Leuten durch die Welt ziehen. Gleichgültig auf welchem Kontinent. Nur nie Wurzeln schlagen, und nie was kappen müssen. Oder vielleicht doch. Genau das: Sesshaft werden. Und vielleicht klingt das ja paradox. Dass ich mich gerade in diesem wurzellosen Gedanken so heimisch fühle. So blühend.
Aufschreiben würde ich solche Sätze nie. Aber wenn ich rede, passieren sie schon mal, weil ich grenzenloses Reden nicht gewohnt bin. Wer mehr als eine Schwester hat, kennt das nicht. Denn mit mehr als einer Schwester bekommt man normalerweise keinen Satz zu Ende, ohne dass jemand den in sein eigenes Ding verstrickt.
In den wenigen Selbsthilfegruppen, in die ich schon reingeschnuppert hatte – zwecks Bewältigung von Fress-, Sex-, Rede-, Zigaretten-, Gefall- oder TV-Sucht –, gab es zwar keine Schwestern, die mich ausbremsten, aber doch wenigstens Eieruhren.
Nina schwieg. Und ich kam in Fahrt.
Bei Jeff, sagte ich, fühle ich mich sicher. Er ist Elektriker in der New School, und eigentlich Künstler (Dichter, Feuerschlucker). Und tagsüber trägt er Uniform, dunkelblaue Hose, hellblaues Hemd, hundert Prozent Polyester. Seit ich ihn kenne, ist dieses Land, diese Stadt vor mir aufgegangen wie eine Sonne. Wie diese Muschel, die ich als Kind abends in ein Glas Wasser gelegt habe. Damit über Nacht eine Blume herauswachse und sich am nächsten Morgen im Wasser wiege. Ein irre fragiles rosa Blütchen. Und eine Flagge. Eine amerikanische.
Wie die bei der Passkontrolle bei meiner Ankunft in Amherst.
Awfully cute smile, hat der uniformierte Schwarze zu meinem Passfoto gesagt, bevor er den Stempel knallen ließ. Ich fühlte mich sofort eingelassen in dieses Land. Und später dann Jeff. Und ich fühlte mich doppelt eingelassen.
Ich hatte nach der Elf-Uhr-Klasse in der Cafeteria der New School gesessen, als dieser Junge in Uniform direkt von der Kasse zu mir rübergrüßte, sich setzte, sein Truthahnsandwich wie einen Anker auf mein kleines schwarzes Tablett warf, auf dem bisher ein einzelner weißer Plastikbecher Kaffee stand, und all das so selbstverständlich, so ohne jedes Zögern, als sei der dünne Kaffee und das dünne Truthahnsandwich eine ganze, vollständige, komplette, Tag und Nacht stillende Mahlzeit. Und mir fiel auf, dass ich Hunger hatte. Ich ging zur Theke, holte mir ein Sandwich mit Munsterkäse und warf es zu dem, was zwischen uns stand. Sah fast schon malerisch üppig aus, wenn man sich die Plastikfolien wegdachte.
Wir begannen zu essen. Und waren offenbar beide neugierig. Jeder ließ den andern kosten. Und beiden schmeckte es. Mir sein Truthahn, ihm mein Käse. Als die Zeit um war, lud er mich wie selbstverständlich zu seinem Auftritt am Abend ein, und ich sagte selbstverständlich zu. Die Stadt musste ja erobert werden, auch wenn ich das nicht so meine, wie es klingt. Ich meine, die äußere Stadt sollte eine innere werden. Ich ging hin, obwohl ich mir aus Alleinunterhaltern nichts mache. Seither verbringe ich alle Zeit mit Jeff.
Abends kaufen wir zusammen ein, und dann, während er kocht, schaue ich fern. Archie Bunker, Gilligan’s Island – alles Mögliche –, würde ich zu Hause nie. Nach dem Essen liegen wir zusammen im Bett. Jeff hat eine Fernbedienung gebaut oder umgebaut, so eine Art Wunderkästchen fürs Wohnzimmer. Es kann Lichter dimmen, die Lautstärke der Musik regeln, den Ventilator und die Kaffeemaschine anund die Klingel ausschalten.
Wir lesen und reden, schlafen miteinander, lesen, dösen, reden, trinken Tee, schlafen miteinander. Oder er schreibt, das heißt, er murmelt seine Verse auf Band, seine Notizen. Manchmal, mitten im Gespräch mit mir, hält er sich das kleine Mikrofon vor den Mund. Und ich merke mir die Sätze, die er in die Maschine spricht. Genauso, wenn er am Telefon spricht. Ich will ja nicht zuhören, wenn er telefoniert, sagte ich zu Nina, aber im Gegensatz zu Augen tun Ohren, was sie wollen. Je weniger ich zuhören will, desto genauer höre ich zu. Als seien Mikrofon und Telefonhörer die Mundstücke eines inneren Rekorders. So bleiben ausgerechnet die Sätze, die er aufschreiben wird, an mir hängen.
„Walser hat ein großes Gespür für Situationskomik, lyrische Sprache und eindrückliche Momentaufnahmen.“
„Der Leser kann sich dieses Kunstwerk nur erlesen. Es ist ein komplexes Vergnügen, ohne unnötig kompliziert zu sein. Dazu sei mit großer Freude geraten.“
„Schön ist auch, mit welcher Klarheit und sprachlicher Meisterschaft Alisa Walser von den Unklarheiten des Lebens erzählt.“
„Es ist eine Kunst, deren Geheimnis unsereinem am Ende verschlossen bleibt, Sekunden unverbindlich und doch für den Moment flirrend aufzuheben. Der Leser wird sie sich noch nicht einmal merken können, aber doch die Atmosphäre, wie nach dem Besuch einer Impressionismus-Ausstellung.“
„Walser ist eine Meisterin darin, Sexualität zu schildern, ohne peinlich direkt oder peinlich verzuckert zu werden. Sexuelle Begegnungen sind hier Zwischenzustände, die aus dem Alltag herausfallen, weil sie die Illusion einer Zusammengehörigkeit erzeugen. Dabei wissen die Beteiligten aber jederzeit, dass es sich um eine Illusion handelt. Vielleicht liegt es daran, dass man beim Lesen das Gefühl bekommt, es mit lauter Verlorenen zu tun zu haben. Oder mit Menschen, die ihr Leben bloß träumen. In den Bildern, die dabei entstehen , sind aber ganz genau und mit allen Sinnen beteiligt.“
„Sie schreibt mit literarischem Anspruch, den sie nicht vor sich herträgt. (…) Manches klingt wie ein höchstpersönlicher Essay- wechselnden fiktiven Personen in den Mund gelegt- und alles ist auf hohem Niveau erzählt. “
„Der Leser (…) bleibt am Buch hängen, gerät in den eigenwilligen Rhythmus, den Alissa Walser mit ihrer musikalischen Sprache aus Mini-Sätzen entfaltet.“
„Alissa Walser zeigt einmal mehr ihre Meisterschaft, die Dinge traumverloren in der Schwebe zu halten.“
„Alissa Walser, selbst ausgebildete Künstlerin, gelingen berückende Sprachbilder, die etwas Schwebendes haben und an überbelichtete Fotografien erinnern.“
„Fülliger, farbenreicher ist Alissa Walsers Sprache geworden, lakonisch ist sie geblieben, doppelbödig und hell – sie erweist sich auch wieder als Meisterin der kristallklaren Verunklarung. Immer tiefer wird man hineingezogen in dieses literarische Spiegelzelt. Als Leser kommt man schwer wieder raus (…)“
„Alissa Walser erzählt von den Irrungen und Wirrungen moderner Paare (…) in leichtem Ton, (…) wie zufällig eingestreut findet sie Gedanken und Sentenzen, die es auf den Punkt bringen. (…) Von fast lyrischer Kraft ist Walsers Sprache, sobald sie, die Malerin, über Farben spricht, nichts als Malende, sondern als ein Mensch, dessen Augenalles, bewusst und unbewusst, nach Farbtönen abtasten.“
„›Immer ich‹, dieser Seufzer des Überdrusses am eigenen Bild, ist genau im Übergang zwischen Kunst und Leben verkreuzt; eine flirrende Erzählung über die Ökonomie der Verhältnisse und dem darin sich verlierenden Selbst. Schon immer hat Literatur Fremdheit und Fremdeln formuliert. Alissa Walser aber zeigt die Welt am Scheidepunkt. (…) Finten, Schattenspiele, Lichtreflexe, wunderbar in Sprache übertragen.“
„Nach der letzten Seite will man nur eins: gleich wieder von vorne anfangen.“











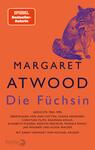


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.