
Gefallen (Ära der Götter 2) — Inhalt
Nach den Ereignissen aus "Verflucht" liegt die einst blühende Handelsstadt Mireea als geisterhafte Ruine da. Die Überlebenden der Schlacht fliehen in die Küstenstadt Yeflam, in der der Wind das Blut des Gottes Leviathan in sich trägt. Und der Zufluchtsort hält neue Schrecken bereit: Nicht nur wird Zaifyr des Mordes an zwei Bewahrern angeklagt. Inmitten der Intrigen und politischen Zerwürfnisse droht außerdem ein Bürgerkrieg auszubrechen. Derweil wächst die Macht des namenlosen göttlichen Kindes. Es ist ein Nachfahre der alten Götter, das über Jahrtausende geschlafen hatte. Und es prophezeit die Ankunft einer grausamen Armee, die an der Küste vor Yeflam landen und die Welt in einen gewaltigen Krieg stürzen wird ...
Leseprobe zu „Gefallen (Ära der Götter 2)“
Prolog
Leviathans Blut, so hatte Ya Nuurals Mutter den Ozean immer genannt.
Er war einen Tagesmarsch von der Küste entfernt aufgewachsen, und in den ersten Jahren seines Lebens war sie jeden Sommer mit ihm an den leeren Strand gepilgert. Sie brachen am Abend auf, nachdem die leuchtende Scherbe der Nachmittagssonne bereits untergegangen war, ihre Wärme aber noch nachwirkte. Seine Mutter nahm ihn an der Hand und wanderte schweigend mit ihren Brüdern und Schwestern durch die Nacht zum Meer. Am nächsten Morgen entfachte die Familie ein Feuer auf dem Sand – [...]
Prolog
Leviathans Blut, so hatte Ya Nuurals Mutter den Ozean immer genannt.
Er war einen Tagesmarsch von der Küste entfernt aufgewachsen, und in den ersten Jahren seines Lebens war sie jeden Sommer mit ihm an den leeren Strand gepilgert. Sie brachen am Abend auf, nachdem die leuchtende Scherbe der Nachmittagssonne bereits untergegangen war, ihre Wärme aber noch nachwirkte. Seine Mutter nahm ihn an der Hand und wanderte schweigend mit ihren Brüdern und Schwestern durch die Nacht zum Meer. Am nächsten Morgen entfachte die Familie ein Feuer auf dem Sand – oft in der Asche des letzten Jahres –, und dann wurde den ganzen Tag und die nächste Nacht hindurch gegessen und getrunken. Dabei erzählte man sich die Geschichte von Leviathan, deren Blut am Tag ihres Todes in den Ozean geflossen war. Der Wasserspiegel war angestiegen, und der Ozean hatte sich schwarz gefärbt. Seine Mutter schilderte auch, was dabei mit dem Leben im Meer geschehen war. Alle Tiere hätten sich verändert, sagte sie. Manche wurden entstellt, andere, die vorher harmlos gewesen waren, wurden gewalttätig. Doch alle waren sie für jeden, der sie verzehrte, giftig geworden.
Darüber hatten schon die Fischer, ihre Vorfahren, geklagt. Die Familie Nuural hatte die Worte über Generationen bewahrt, und in jenen langen Nächten hatte Ya unter den verschwommenen Sternen und dem matten Mond gelegen und im Geiste Männer und Frauen unter den Wellen gesehen. Er hatte versucht, ebenso wie sie den Atem anzuhalten – länger als jeder andere Mensch –, und er hatte sich vorgestellt, einen Speer aus den Knochen eines Wesens in der Hand zu halten, das im Gewirr der roten und goldenen Korallenriffe verendet war, wo Leviathan ihre letzte Ruhe gefunden hatte.
Seine Mutter war schon seit zwanzig Jahren tot, doch wenn er nun, selbst Vater eines bereits erwachsenen Kindes, über den Sand ging, hatte er ihre Geschichten noch immer im Ohr. Besonders deutlich vernahm er ihre Stimme an dem Nachmittag, an dem er das Schiff Glafanr entdeckte.
Er war gekommen, um nach den Angeln zu sehen, die sich über den schwarzen Ozean neigten. Unter seinen Füßen knirschten die toten Hüllen der Schmetterlinge dieses Tages, als er über Sand und Stein zu den Ruten und den Netzen ging, die dazwischen im Wasser lagen. Er hatte die Leinen am Morgen ausgeworfen, kurz bevor die erste Scherbe der Sonne aufging, aber die Ausbeute war spärlich; die dicken Angelsehnen lagen schlaff im Wasser. Das überraschte ihn nicht allzu sehr, denn Fische fing man besser in der Nacht. Deshalb hoffte er, dass am nächsten Morgen viele ungenießbare Tiere die Leinen straffen würden.
Die dicken Angelruten steckten in Stahlhülsen, die am Ende des Strandes in den Felsen geschlagen waren. Bunte Schmetterlinge lagen, vollgesogen mit Wasser, um die Stangen herum, doch am dichtesten hingen sie an den Spulen mit den Angelsehnen aus Katzendarm. Die Leinen waren lang genug, dass auch die größten Geschöpfe des schwarzen Ozeans sich daran müde zerren konnten, aber Ya wusste auch, dass es in den Tiefen von Leviathans Blut Lebewesen gab, die imstande waren, sie zu zerreißen und in seltenen Fällen sogar die Angelrute aus der Hülse zu zerren und davonzuschleppen wie einen dürren Ast.
Die Flut hatte Leinen und Schmetterlingsleichen in den Gezeitentümpel zwischen den Steinen geschwemmt; die Sehnen der beiden Angeln hatten sich ineinander verheddert. Der Tümpel – zweimal so lang und mindestens ebenso tief, wie Ya groß war – war von Hand ausgeschürft worden. Anschließend hatte man ein Netz auf seinen Grund gelegt. In diesen Teich warfen die Fischer alles, was sie im Ozean gefangen hatten, um es zu untersuchen. Jedes gefangene Tier wurde markiert und gelegentlich mitgenommen. Ya wollte auf jeden Fall verhindern, dass sich die Leinen bis zum nächsten Morgen auch noch in den Netzmaschen verfingen, und so beugte er sich nieder, um sie vorsichtig herauszuziehen.
Als er sich wieder aufrichtete, sah er es.
Weit draußen dümpelte ein einzelnes Schiff auf den schwarzen Wellen. Es war so groß, so imposant, dass er im schwindenden Licht der Nachmittagssonne sogar die roten Segel erkennen konnte.
Zuerst hatte Ya die Gerüchte von seiner Tochter Iz gehört. Sie war zwei Wochen zuvor in seine Hütte gestürmt, ohne darauf zu achten, dass sie Sand auf dem Boden verstreute und den grellen Schein der Mittagssonne einließ. Dann hatte sie ihn mit einem Blick aus ihren scharfen schwarzen Augen an seinem Stuhl gefesselt, sich vor ihm aufgebaut und hastig, aber so leise wie einst seine Mutter auf ihn eingeredet. Abgesehen von der Stimme waren sich die beiden nicht sehr ähnlich. Iz war hochgewachsen und schmal und hatte tiefschwarze Haut, während seine Mutter dunkelbraun und von schwerem Körperbau gewesen war. Jetzt, Mitte der vierzig, hatte Ya mehr mit seiner Mutter als mit seiner Tochter gemein. Iz schlug nach ihrer Mutter, seiner Frau, die vor zwölf Jahren gestorben war.
„Das Wrack eines Schiffes wurde an den Strand gespült“, hatte sie gesagt. „Die Seeleute waren an den Rumpf, ans Deck, an den Mast und an verschiedene Stühle genagelt. Man hatte sie nicht beraubt: Sie trugen immer noch ihren Schmuck und ihren gesamten Sold bei sich. Sie waren auf dem Rückweg von Gogair …“
„Manche Leute“, sagte er, „mögen keine Sklavenhändler. Sie halten deren Geld für schmutzig.“
„Diese Toten – sie sind sein Werk.“
Er hielt dagegen, dass jedes Wrack, jedes verschwundene Schiff Aela Ren zur Last gelegt würde. Wenn es nicht der Mann selbst sei, dann sei es die Glafanr, sein riesiges Schiff, das seit siebenhundert Jahren fest vor der Küste von Sooia vertäut war. Das wüsste sie ebenso gut wie er. Sie sollte klug genug sein, nicht alles nachzuplappern, was man ihr erzählte. Er hatte sich gefreut, als sie nickte, ihm beipflichtete und versprach, die Geschichte nicht weiter im Dorf herumzutragen. Beide wussten, dass das Dorf es sich nicht leisten konnte, noch mehr Männer und Frauen zu verlieren, wenn sie ihre Arbeit fortsetzen wollten.
Am nächsten Morgen waren zwei junge Familien weggezogen, neun Menschen insgesamt, die er dringend gebraucht hätte. Wer die neun waren, hatte ihn nicht überrascht. Beide Familien waren an die Küste gekommen, weil das Gold sie lockte, das er ihnen bieten konnte. Die Fünfte Königin unterstützte seine Arbeit, aber sie hatten nicht an die Aufgabe geglaubt. Sie hatten nicht verstanden, warum diese Tätigkeit nicht von Hexen ausgeführt wurde, warum sie sich nicht mit dem Blut im Ozean befassten, warum sie die Verfahren nicht beschleunigten, mit denen das Gift und die Krankheiten aus den Fischen herausgezüchtet wurden. Er hatte ihnen erzählt, was mit den Hexen und Hexern geschehen war, die genau das versucht hatten, aber sie hatten ihm wohl nicht geglaubt. Immer wieder hatten sie gefragt, warum man auf diese Weise Fischzucht betreibe, warum man große wie kleine, gefährliche und harmlose Fische fangen und halten müsse und warum es nötig sei, bei allen das Gift des Ozeans aus dem Fleisch zu entfernen.
Aber sie waren nicht wegen der Arbeit fortgegangen.
„Es ist seinetwegen“, hatte ihm Un Daleem, die älteste der Frauen erklärt. Die stämmige schwarzhäutige Frau mit dem kräftigen Knochenbau trug einen kleinen schwarzen Stein um den Hals wie ein drittes blindes Auge. „Aela Ren. Er ist auf dem Weg hierher, in die Fünfte Provinz. Nach Ooila.“
„Das kannst du nicht wissen“, hatte er gesagt.
„Man hört, was die Leute sagen.“
„Die Leute reden immer.“
„Diesmal ist es anders.“
Sie hatte unverwandt auf die leeren schwarzen Wellen und die Sonnenlichtstreifen gestarrt, die wie Schwertklingen auf das Dorf gerichtet waren.
„Ich habe den Gerüchten über sein Kommen nie geglaubt“, sagte sie nach kurzem Überlegen. „Bis heute nicht. Meine Mutter sprach vom Tag meiner Geburt bis zu ihrem Tod tagtäglich davon. Aela Ren wird kommen. Der Unschuldige ist schon auf dem Weg. Ich sagte ihr, Aela Ren führt seit siebenhundert Jahren Krieg gegen Sooia. Er wird das Land nicht verlassen. Er hat es zu seinem Eigentum gemacht. Deshalb ist kein anderes Land jemals dort einmarschiert. Deshalb ist niemand den armen Menschen dort zu Hilfe gekommen. Aber jetzt … jetzt ist alles anders, Ya Nuural. Die Glafanr wurde gesichtet. Mehr als ein Seemann, mehr als ein Schiff – du hast es ebenfalls gehört. Und jetzt das Wrack, das einen halben Tagesritt von hier angespült wurde? Das war nicht das Werk eines Räubers, eines Söldners oder eines anderen Landes. Das war er. Das war der Unschuldige mit seinem Heer, und Leviathans Blut hat uns die toten Seeleute zugetragen, um uns zu warnen.“
Das war vor einer Woche gewesen, und als er nun auf den nassen Felsen stand und zur Glafanr hinüberschaute, erinnerte er sich an Un Daleems Worte, und ein Schauer überlief ihn.
Es ist nicht das Schiff des Unschuldigen, suchte er sich zu beruhigen. Mehr als ein Schiff hat auf dem Ozean rote Segel gesetzt. Und außerdem … sosehr er seine schwachen Augen auch anstrengte, er sah keine Bewegung an Deck.
Das Schiff war verlassen. Ein Geisterschiff, nichts weiter.
Die Worte enthielten mehr Hoffnung als Wahrheit, er wiederholte sie dennoch. Schiffe gerieten in schweres Wetter. Segel zerrissen im Sturm, der Kiel konnte brechen. Schiffe wurden aus vielen Gründen aufgegeben… Ya Nuural ging sie alle durch, als die Nachmittagssonne hinter ihm in dunkelroter Glut unterging und er über den Strand seinem Dorf zustrebte.
Dort angekommen, nickte er den wenigen Menschen zu, die ihm auf der Straße begegneten, erwähnte das Schiff aber mit keinem Wort. Wenn sie bemerkten, dass er anders war als sonst – angespannter vielleicht –, so äußerten sie sich nicht dazu. Die verlassenen Häuser, die sie aus leeren Augen anstarrten, lieferten mehr als genug Gründe, warum er beunruhigt sein mochte.
Vor drei Jahren hatte er ein Gesuch an die Fünfte Königin gerichtet, in dem er nicht nur für seine Arbeit mit den Fischen, sondern für das ganze Dorf um Geld bat. Die alte Königin war verstorben, und die neue stand seinem Vorhaben dem Vernehmen nach wohlwollend gegenüber, deshalb hatte er ihr geschrieben. Zunächst hatte er dem Dorf den Namen Steinamfluss gegeben, doch der Name hatte sich nicht eingebürgert, und die Menschen, die darin wohnten oder in der Umgebung lebten, nannten es einfach das Dorf. Keine Anführungszeichen, kein Titel. In seinem Gesuch an die Fünfte Königin hatte er den Namen Steinamfluss verwendet, doch als sie die Mittel für weitere Gebäude und neue Brunnen bewilligte, hatte sie die Antwort an Ya Nuural „aus dem Dorf“ adressiert. Trotz dieser Unterstützung war es ihm nicht gelungen, die Ansiedlung so zu vergrößern, wie es ihm vorschwebte; sie hatte nicht genügend Menschen angezogen. Viele der neuen Häuser hockten da wie die schwarzen Schmetterlingskadaver, als warteten sie nur darauf, zertreten zu werden und wiederaufzuerstehen. Die Meinung, dass die Fünfte Königin ihn nicht noch ein weiteres Jahr unterstützen würde, wenn sie erst erfuhr, wie wenig sie mit ihrem Gold erreicht hatte, war weitverbreitet.
Der Gedanke verband sich mit dem Bild des Schiffes – des Schiffes, wiederholte er bei sich, nicht etwa der Glafanr – und er hielt sich vor Augen, wie viel Arbeit er in den Aufbau dieser Siedlung gesteckt, wie viel von seinem Leben, seiner Jugend er dafür geopfert hatte. Unter solchen Gedanken verließ er das Dorf auf der anderen Seite.
Gleich hinter dem Strand fing der Wald an, und dort erwartete ihn eine Reihe von breiten Felsbecken. Es waren mehr als zwanzig, darunter zwei, die so geräumig waren, dass sie fünf Bestien Platz boten, die zweimal so groß waren wie er und lange, scharfe Zähne hatten. Wenn sie dicht unter der Oberfläche schwammen, schillerte ihre graue Haut im Licht, doch wenn sie weiter hinuntergingen, waren sie nicht mehr zu sehen – und sie hielten sich oft tagelang in der Tiefe auf. In den alten Büchern der Fischer wurden sie als Haie bezeichnet, aber Leviathans Blut hatte sie verändert. Jetzt waren ihre Flossen hart wie Knochen, und wenn sie sehr aufgeregt waren und Hunger hatten, sonderten die dunklen Augen schwarzen Schleim ab. In den letzten zwei Jahren hatte das Dorf zwei Bewohner an die Haie verloren, doch Ya glaubte dennoch, einen Fortschritt erzielt zu haben: Drei von den fünfen kannten nur das saubere Wasser des Beckens.
Vielleicht noch ein Jahr, dann könnten sie die ursprünglichen Haie herausholen und zu Forschungszwecken aufschneiden.
Im Haifischbecken war alles ruhig. Er ging weiter. Auch in den anderen Becken regte sich nichts. Aus dem letzten Teich drang ein weicher phosphoreszierender Schein, sobald die Nachmittagssonne vollends untergegangen war. Er blieb stehen und sah den winzigen Elritzen zu, die unermüdlich hin und her schossen. Das Licht wurde allmählich stärker und erhellte die gesamte Umgebung. Die Elritzen waren Yas Lieblinge – er fing sie nicht mit Angeln, sondern mit langen Netzen, die er von einem Boot aus ins Meer warf. In den frühen Abendstunden kam er oft hierher, sah ihnen zu und schwelgte in ihrer Freude über das saubere Wasser, aber heute war er dazu nicht imstande. Heute sah er in dem Licht nur ein Leuchtfeuer, das einem einzelnen gefürchteten Mann und seinem Heer den Weg von ihrem Landeplatz am Strand hierher weisen würde.
Der Gedanke verfolgte ihn bis in den Schlaf, aber die gesichtslosen Soldaten erschienen nicht in seinen Träumen. Nein, er träumte nur von dem Schiff, das er nicht Glafanr nennen wollte und das lautlos und sanft auf den Wellen schaukelte.
In seinem Traum stand er an Deck.
Ya ging langsam auf die Reling zu und schaute ins Meer hinab. Die Oberfläche war wie Rauch, und er glaubte, darunter Gestalten zu erkennen. Zuerst nur winzige Striche wie die Elritzen von vorhin. Sie leuchteten immer wieder auf, bis ohne jede Vorwarnung ein riesiger Schatten unter dem Schiff hervorschoss, ein Ungeheuer, wie er es in dieser unglaublichen Größe noch nie gesehen hatte. Es war so gewaltig, dass Ya es nicht als Ganzes erfassen konnte. Fieberhaft versuchte er, die Teile zu einem Bild zusammenzufügen, ein Kopf wie ein Berg, scharfe Stacheln auf dem Rücken, ein endlos langer Schwanz, der sich nach oben wölbte, wenn die Bestie in Spiralen nach unten abtauchte. Es war, als breitete sich ein Land, ein Königreich um ihn herum aus, und Ya erkannte, von jäher Panik erfasst, dass die Kreatur nur deshalb in die Tiefe schoss, um anschließend gleich wieder aufzusteigen. Im Geiste sah er sie aus dem schwarzen Wasser schießen, das weit aufgerissene Maul eine Höhle des Grauens, die ganze Nationen mit einem einzigen Bissen verschlingen und ihn in eine Welt hinabsaugen konnte, wo er alsbald aufgelöst würde, zerfressen von der Magensäure der Bestie, bis nichts mehr von ihm übrig wäre.
Er spürte eine Hand auf seiner Schulter.
„Vater.“
Seine Tochter.
„Vater, du musst aufwachen“, flüsterte sie. „Ein Boot ist auf dem Weg hierher.“
Er wünschte sich, dass ihre Worte noch Teil seines Traumes wären, doch sie schüttelte ihn wieder, und er schlug schlaftrunken die Augen auf.
Draußen vor dem Haus leuchteten nur die Sterne und der Mond, doch als Ya Nuural den Strand erreichte, hatten die Dorfbewohner bereits Lampen angezündet und sich in einer Reihe aufgestellt, sodass er sich erst durchdrängeln musste. „Es tut mir leid“, sagte Iz leise und stellte sich neben ihn ans Ende des Strandes. „Ich habe es kurz vor den beiden Wachen entdeckt.“
Auf dem dunklen Wasser näherte sich ein einzelnes Boot mit einer einzelnen Gestalt darin.
Einem einzelnen Mann.
„Schon gut“, sagte er endlich.
„Was …“ Seine Tochter zögerte, wohl wissend, dass die anderen jedes Wort mithörten. „Man sollte die Kinder wegschicken.“
„Wir wissen doch nicht, ob er es ist“, wandte er ein, ohne selbst daran zu glauben. „Vorerst ist es nur ein Schiffbrüchiger, der sich retten konnte.“
Auf Leviathans Blut türmte sich eine Welle auf und hob das kleine Boot in die Höhe.
„Wir werden ihn willkommen heißen“, sagte er. Das Boot glitt an der Welle herab, die Ruder hoben und senkten sich gleichmäßig. „Wir schicken drei Mann hinunter. Sie sollen ihm helfen, das Boot an Land zu ziehen, und sie sollen auch dem Mann beistehen, falls er Hilfe braucht. Wir werden ihm voller Stolz zeigen, was wir hier tun. Wir werden ihm erklären, dass wir die Welt verändern wollen. Dass wir den Schaden beheben, den die Götter angerichtet haben. Aber wir werden auch vorsichtig sein. Die anderen statten wir mit Armbrust und Bogen aus. Wir sorgen dafür, dass alle bewaffnet sind. Die kleinen Kinder schicken wir mit den älteren in den Wald. Wir fliehen nicht. Wir brauchen uns nicht für das zu schämen, was wir hier tun.“
„Vater“, sagte seine Tochter leise. „Wir brauchen ihm nicht entgegenzugehen.“
„Wir werden keine Angst zeigen“, beharrte er.


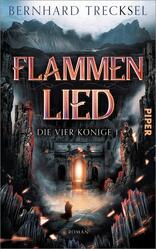
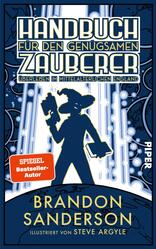

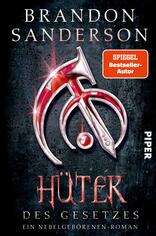




DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.