
Gebrauchsanweisung für die Fußball-Nationalmannschaft
„Streng genommen handelt es sich bei Horenis Werk natürlich nicht um eine Gebrauchsanweisung im eigentlichen Sinne. Sein Buch ist eher als Liebeserklärung an die Nationalmannschaft der Jahre 2004 ff. zu verstehen.“ - Der Tagesspiegel
Gebrauchsanweisung für die Fußball-Nationalmannschaft — Inhalt
54, 74, 90, 2014 – Deutschland reist als Weltmeister mit vier Sternen auf der Brust an und gilt nicht erst seit dem Gewinn des Confed Cup als einer der Favoriten auf den WM-Titel. Es wird spannend in Russland, wenn Jogis Elf auf Klassiker wie Brasilien, Italien und Frankreich trifft: Michael Horeni, der 1974 als Kind beim Strandfußball an der Adria erlebte, was es bedeutet, Weltmeister zu sein, begleitet die Nationalmannschaft seit fast 20 Jahren. Er erzählt uns so detail- und kenntnisreich von der Aura und den Emotionen, von der Geschichte und den Strategien dieses Teams, dass man die Nationalelf mit anderen Augen sieht. Er erklärt uns, warum uns keine andere Mannschaft seit Jahrzehnten so bewegt und der Bundestrainerjob der unmöglichste im ganzen Land ist. Was es heißt, für Deutschland zu spielen, aber die Hymne nicht zu singen. Und was es braucht, um 2018 den fünften Stern aufs Trikot zu sticken.
Leseprobe zu „Gebrauchsanweisung für die Fußball-Nationalmannschaft“
Warum die Nationalelf glücklich macht
Ich war neun, als ich das erste Mal Weltmeister wurde. Es passierte am 7. Juli 1974, an einem kühlen Sommertag. Mittags hatte es ein bisschen geregnet, wir schauten in die schwarzen Wolken und hörten ein wenig früher mit dem Kicken auf. Aber das war nicht wichtig an diesem Tag. Wichtig war etwas anderes: Das Endspiel fiel auf Grabis Geburtstag! Und damit war die Sache für uns klar: Heute werden wir Weltmeister.
Schon während der gesamten Weltmeisterschaft hatte ich zuvor alle Zeichen richtig gedeutet. An diesem [...]
Warum die Nationalelf glücklich macht
Ich war neun, als ich das erste Mal Weltmeister wurde. Es passierte am 7. Juli 1974, an einem kühlen Sommertag. Mittags hatte es ein bisschen geregnet, wir schauten in die schwarzen Wolken und hörten ein wenig früher mit dem Kicken auf. Aber das war nicht wichtig an diesem Tag. Wichtig war etwas anderes: Das Endspiel fiel auf Grabis Geburtstag! Und damit war die Sache für uns klar: Heute werden wir Weltmeister.
Schon während der gesamten Weltmeisterschaft hatte ich zuvor alle Zeichen richtig gedeutet. An diesem Finaltag, da war ich mir absolut sicher, lief alles auf Grabi hinaus. Und auf Holz. Und auf Frankfurt, meine Heimatstadt. Grabi, das war natürlich Jürgen Grabowski, und Holz, das war Bernd Hölzenbein. Das musste man damals niemandem erklären, schon gar nicht, wenn man aus Frankfurt kam. Grabi war ein Fußballgott, das Wort gab es damals zwar noch nicht, aber er war trotzdem einer. Aber weil Grabi so unerreichbar war, wurde er nie mein Lieblingsspieler. Das war Holz, das Schlitzohr.
Ich hatte schon bei meiner ersten Weltmeisterschaft begriffen, dass man Fußball nur mit magischem Denken wirklich versteht. Für mich war das Erkennen und Verbinden dieser Zeichen eine vollkommen logische Angelegenheit, ein Kinderspiel. Ich sah die Dinge, die kommen sollten, glasklar vor meinem inneren Auge. Meine Eltern konnten jedoch nicht sehen, was ich sah, und die anderen Erwachsenen auch nicht. Selbst in der Zeitung, die ich an jenem Sonntag kurz vor dem Endspiel am Wasserhäuschen holte, dort, wo die Männer ihr Henninger und Binding wie immer aus der Flasche tranken, hatten sie doch tatsächlich behauptet, die Holländer hätten die bessere Mannschaft.
Wer den Fußball aber wirklich begriff, so wie ich damals als Kind, dem hatten sich schon vor dem Endspiel die entscheidenden Dinge offenbart. Wo hatte denn das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft stattgefunden? In Frankfurt! Und wer kam ins Team, nachdem wir gegen die DDR mit 0:1 verloren hatten: Holz! Und im nächsten Spiel auch noch Grabi! Und wo hatte die Wasserschlacht gegen Polen stattgefunden, die wir 1:0 gewannen und die uns ins Endspiel gebracht hatte? Natürlich auch in Frankfurt! Und nun spielten mit Grabi und Holz gleich zwei Frankfurter von Anfang an im Endspiel gegen die Holländer – und Grabi hatte auch noch Geburtstag! Das waren für mich eindeutige, unwiderlegbare Zeichen, dass ich mir um den Ausgang des Spiels überhaupt keine Sorgen machte.
Mein Vater schaltete den schleiflackweißen Grundig-Fernseher ein, den er extra für die Weltmeisterschaft gekauft hatte, leider das etwas günstigere Modell ohne Fernbedienung. Die braucht kein Mensch, hatte er gesagt. Meine Mutter setzte dafür den eleganten, silbernen Drehfuß durch. Als das farbige Bild langsam auf dem Grundig Super Color 8011 erschien, sprang ich von der Hollywoodschaukel auf und lief ins Wohnzimmer.
Auf der glattbraunen Ledercouch nahmen wir vor dem Fernseher unsere feste Formation ein. Eine Dreierkette, wie ich heute sagen würde, auch wenn es die damals noch nicht gab. Ich saß ganz links auf dem Sofa, direkt neben der Tür. Meine Mutter in der Mitte, mein Vater ganz rechts, nah an den Schaltern des neuen Geräts. Er brauchte seinen muskulösen Arm nur ein wenig auszustrecken, um die Lautstärke zu regeln oder zwischen den einzigen drei Programmen zu wechseln, was er auf Anweisung meiner Mutter auch klaglos tat, um zu beweisen, dass wir die Fernbedienung nicht brauchten.
Das Spiel begann. Für die Nationalhymne interessierte sich damals, als Deutschland noch mit dem sperrigen Vornamen Bundesrepublik vorgestellt wurde, niemand bei uns. Ich war jedenfalls kein bisschen nervös, als die Mannschaften erst an der Mittellinie Aufstellung nahmen und Uli Hoeneß dann schon eine Minute nach Anpfiff den verdammt lässigen Johan Cruyff foulte und Johan Neeskens den Elfmeter genauso lässig zum 1:0 für Holland mitten ins Tor donnerte. Warum auch? Ich wusste ja, dass wir gewinnen.
Mein Vater drehte nach dem Rückstand die Lautstärke runter, während ich ruhig auf den Ausgleich wartete. Schmerzhafte Niederlagen, über die sich mein Vater mit seinen Freunden während der Weltmeisterschaft ausgelassen hatte, kannte ich noch nicht. Und selbst wenn ich davon mal gehört hatte, dann lagen sie für mich unendlich weit zurück. So wie das 3:4 gegen Italien nach Verlängerung beim WM-Halbfinale von Mexiko vier Jahre zuvor, von dem die Erwachsenen immer wieder erzählten. Über diese Niederlage redeten sie auf eine ganz merkwürdige Art, geradezu schwärmerisch, als wäre es eine besondere Kunst, schön zu verlieren. Bei dieser Niederlage war ich gerade fünf gewesen, jetzt war ich fast doppelt so alt.
Ein halbes Leben lag also das Spiel zurück, und ich fragte mich, warum die Erwachsenen immer noch darüber redeten. Genauso wie über dieses merkwürdige Wembley-Tor gegen England. Darüber konnten sie sich immer noch richtig aufregen.
Ich dagegen war nur mit deutschen Siegen groß geworden. Etwas anderes als einen Sieg konnte ich mir gegen Holland an diesem Tag einfach nicht vorstellen. Zwei Jahre zuvor hatte ich auf unserem alten Schwarz-Weiß-Fernseher mein erstes Länderspiel gesehen. Es war wieder im Wembley-Stadion, aber diesmal gewannen wir 3:1 gegen England. Mein Vater war vollkommen aus dem Häuschen. Beckenbauer, Netzer, so etwas Schönes habe er auf dem Fußballplatz noch nie gesehen, sagte er. Ich fand das vollkommen normal. Kurz darauf wurden wir Europameister, ganz locker 3:0 gegen die Sowjetunion, die bei uns aber alle nur die Russen nannten. Europameister werden war leicht. So viel stand fest.
Ich war also nicht überrascht, als Paul Breitner mit einem Elfmeter das 1:1 machte. Holz war im Strafraum zu Boden gegangen, mit ausgebreiteten Armen, als wollte er fliegen. Das war seine Spezialität. Ich kannte das schon aus der Bundesliga von ihm und spielte es auf der Wiese und auf dem Platz immer wieder nach: Elfmeter schinden. Das konnte auch ich irgendwann ziemlich gut.
Als ich dreißig Jahre später mit Bernd Hölzenbein für einen Rückblick auf den WM-Sieg von 1974 zusammensaß und wir noch einmal über jene Szene im Strafraum redeten, die viele für eine Schwalbe hielten, vor allem wenn sie aus Holland kamen, einigten wir uns schließlich auf die Formulierung, dass er sich in diesem Zweikampf gegen Wim Jansen nicht gegen die Schwerkraft gewehrt hatte. Holz hätte die schönste Schwalbe, die Fußball-Deutschland je gesehen hat, natürlich auch dreißig Jahre später niemals zugeben. Aber er grinste dabei so herrlich, wie es Ronald Biggs nach seinem legendären Postraubzug bestimmt auch getan hatte.
Als Gerd Müller kurz vor der Pause das 2:1 mit einem Drehschuss machte, flippte bei uns niemand aus. Nicht einmal der Reporter im Fernsehen. Auf unserer Dreierketten-Couch passierte das sowieso nie beim Fußball. Auch auf der Straße rührte sich nichts, nicht einmal nach dem Schlusspfiff, als Franz Beckenbauer den Pokal in den wolkigen Himmel hob und Sepp Maier ihn küsste. Erst den Pokal und dann bestimmt auch den Franz.
Unsere Nachbarn blieben wie wir mit dem zweiten deutschen WM-Titel allein zu Haus. Es war ja nur Fußball. Und nicht Silvester, wo man zusammen auf der Straße miteinander anstieß und feierte. Der Reporter im Fernsehen sagte nach dem Abpfiff, meine Herren, jetzt können Sie die besseren Sachen entkorken. Und Sie, meine lieben Damen, können mittrinken. Aber wir tranken nichts.
Auch von Autokorsos, die sich beim nächsten WM-Sieg 1990 in Deutschland erstmals, aber noch zögerlich durch die Stadt bewegten, fehlte damals in unserer Straße noch jede Spur. Von Public Viewing vor dem Brandenburger Tor oder am Mainufer ganz zu schweigen. Mein erster WM-Sieg war ein reiner Familien-Fernseh-Fußball-Tag. Das reichte, um mich glücklich zu machen.
Am Tag danach sind wir mit unserem taubenblauen Ford Taunus in den Urlaub gefahren. Es ging nach Italien, an die Adria. Es war meine erste Reise als Weltmeister, aber das ahnte ich noch nicht, als wir über den Brenner fuhren und unsere Pässe vorzeigten. Ich trug ein T-Shirt mit Tip und Tap drauf, den beiden WM-Maskottchen, die sich ziemlich hip in bauchfreien T-Shirts zeigten, aber ich dachte damals bloß, sie wären ihnen versehentlich aus der Hose gerutscht, so wie mir das immer passierte, wenn wir nach der Schule kickten und aus unseren Ranzen Torpfosten machten. Als der Grenzbeamte mich hinten in meinem WM-Shirt entdeckte, ging er in die Knie, um mir direkt ins Gesicht zu sehen. Mit Grenzern kannte ich mich aus. Ich merkte gleich, dass der ganz anders drauf war als die mürrischen Typen in Herleshausen, an denen wir immer vorbei mussten, wenn wir Verwandte in der DDR besuchten. Eine schickere Uniform hatte er auch. Durchs runtergekurbelte Fenster reckte er mir nun seinen Daumen entgegen und sagte grinsend: Muller, Muller. Dann winkte er uns fröhlich in die Ferien. So also reiste man als Weltmeister.
Gleich am nächsten Tag, nachdem wir unsere Liegestühle unter einem der akkurat aufgereihten azurblauen Sonnenschirme in der zweiten Reihe gemietet hatten, schnappte ich mir meinen Ball, um hinten am Strand zu kicken, bevor der Sand zu heiß wurde. Es waren auch schon ein paar andere deutsche Jungs in meinem Alter da. Wir spielten sofort das WM-Endspiel nach. Erst den Elfmeter von Paul Breitner, flach ins linke Eck. Das war leicht. Der Drehschuss von Müller um die eigene Achse war schon schwieriger, das bekamen wir im tiefen Sand kaum hin. Aber was sollen da erst die Jungs und Mädchen von heute sagen, wenn sie das Wahnsinnstor von Mario Götze aus dem WM-Finale gegen Argentinien nachspielen wollen? Das geht wirklich nur noch an der Playstation.
Es dauerte nicht lange, und wir machten ein Länderspiel gegen die italienischen Jungs am Strand von Alba Adriatica. Schon nach ein paar Minuten war sonnenklar, dass auch ich Weltmeister war, wie alle anderen deutschen Jungs in meinem Team. Das hatten unsere Gegner sofort und ganz selbstverständlich anerkannt. Sie nahmen unseren WM-Sieg als Herausforderung und wollten unbedingt den neuen Weltmeister schlagen. Wir wussten natürlich, was auf dem Spiel stand, was wir zu verteidigen hatten. Da spürte ich zum ersten Mal, dass etwas von dem Glanz der Nationalmannschaft auch auf mich übergegangen war, auf uns. Wir gewannen das Spiel. Nach der Wasserschlacht gegen Polen hatten wir nun auch in der Hitzeschlacht von Alba Adriatica gesiegt. Für den nächsten Tag verabredeten wir uns mit den italienischen Jungs zur Revanche, diesmal verloren wir. Aber gemeinsam stürmten wir auch nach diesem Spiel über den glühenden Sand ins Meer, am Strand der Erinnerungen.
Fast auf den Tag genau vierzig Jahre später wurden wir wieder Weltmeister. Aber in Berlin war vieles anders. Als die Nationalmannschaft zwei Tage nach ihrem Triumph von Rio de Janeiro in der deutschen Hauptstadt mit der von der Lufthansa zum „Siegerflieger“ getauften Maschine einschwebte, um den Weltmeistertitel am Brandenburger Tor zu feiern, schien das ganze Land für einen Moment stillzustehen. Aus den Büros winkten die Leute den Spielern in ihrem offenen Bus zu, das waren Bilder, wie man sie hierzulande nur aus alten Filmausschnitten kannte, die siegreich heimkehrende Truppen in Amerika zeigten. Über eine Million Menschen säumten im Juli 2014 die Straßen Berlins, Hunderttausende warteten in Feierlaune auf der Fanmeile auf ihre Helden. Die Washington Post hatte aufmerksam registriert, dass in jenen WM-Tagen, als Deutschland immer mehr zum Favoriten auf den Titel wurde, auf einmal ein Optimismus eine notorisch skeptische Nation erfasst habe. Und dass in der Nacht von Rio etwas in Deutschland explodiert sei, was man nur sehr selten erlebt habe seit dem Zweiten Weltkrieg: eine Welle deutschen Stolzes. Eines Stolzes allerdings, vor dem sich niemand fürchten musste.
Wie war das möglich? Woher kam dieser Stolz, den man jenseits des Atlantiks, in dieser scheinbar fußballfernen Kultur, so glasklar erkannte? Was war plötzlich los mit diesen Deutschen? Tatsächlich markierten diese Tage im Sommer 2014 den absoluten Höhepunkt in der traditionell ohnehin enormen Fußballbegeisterung des Landes. Die Nationalmannschaft hatte mit ihrem Spiel und ihren Siegen nach sechs Wochen eine Leichtigkeit und Fröhlichkeit in Deutschland entfacht, die man von den Deutschen nicht unbedingt kennt. Die Wurzeln dieser Begeisterung reichten dabei weit zurück in die uralte deutsche Fußballgeschichte, die mit einem Wunder von Bern 1954 ihren Anfang genommen hatte, die sich nun mit der neuen, leichten Zeit vermischte. Schon während des Sommermärchens 2006 hatte der Fußball neue Kraft, Energie und Lebensfreude gewonnen, die weit über den Fußballplatz hinausreichten – und die nun acht Jahre später mit dem Triumph in Brasilien zu einem fantastischen Ende gekommen war.
Dieses Buch handelt größtenteils, anders als man nach dem ersten Kapitel vielleicht denken könnte, nicht von schönen, alten, vergangenen Fußballzeiten. Es erzählt vor allem von der jüngsten deutschen Fußball-Ära, die 2004 unter Jürgen Klinsmann und seinem Assistenten Joachim Löw begann und die Löw nach dem Sommermärchen 2006 dann als Bundestrainer zusammen mit seinem Assistenten Hansi Flick weiterführte und schließlich in Rio mit dem Titel krönte. Es geht um die Veränderungen, die sich im deutschen Fußball vollzogen, um die Spieler, die dieses Team und diese Zeit prägten – und diejenigen, deren große Zeit erst noch kommt. Aber auch um all die Akteure, die im Profifußball und der Nationalelf mittlerweile eine Rolle spielen, die sich nicht mehr ignorieren lassen, weil sie längst auch ihr eigenes Spiel spielen, das die Nationalelf und den Fußball immer größer werden ließ, aber beiden mittlerweile nicht mehr nur guttut.
Im Sommermärchen schien alles noch wie selbstverständlich zusammenzukommen, wie in einem Hollywood-film, auch wenn das Happy End fehlte. Ein junges, frisches und unterschätztes Team betrat mutig die internationale Bühne, ihm flogen die Herzen zu, und bald begeisterte sich ein ganzes Land an diesem Team und irgendwann auch an sich selbst. Kurz vor dem Ziel endete der Traum in Tränen, aber das gute Gefühl dieser Tage und Wochen – es blieb.
All dies geschah in einem sorglosen Land, in einer Zeit ohne große Konflikte. Das war, wie man im Rückblick weiß, ein kostbarer und seltener Moment. Ein Moment, der es schaffte, eine gesellschaftliche Atmosphäre zu erzeugen, wie sie der Fußball und die Nationalelf, das Lieblingsspiel und die Lieblingsmannschaft unserer Zeit, auch braucht, um bei großen Turnieren wochenlang diese Leichtigkeit im ganzen Land zu entfalten, wenn Nationen auf dem Rasen nur zum Spaß gegeneinander antreten. So wie in jenem unvergessenen Sommer 2006, als die Fanmeilen pure Lebensfreude ausstrahlten und noch keine Terrorgefahr über ihnen schwebte; als Hassreden noch weitgehend unbemerkt unter der Oberfläche schwelten und die Flüchtlingskrise noch keine rassistische Gewalt, Übergriffe auf Frauen und eine gesellschaftliche Spaltung hervorgebracht hatte. Da war die Welt noch zu Gast bei Freunden gewesen.
Der Nationalmannschaft bin ich durch meinen Beruf nun so nahe, wie ich es mir als Kind nicht hätte träumen lassen. Abgesehen davon natürlich, dass ich damals fest davon überzeugt war, selbst einmal Weltmeister zu werden, so wie Holz, mein Idol.
Auf dem Nachttisch in meinem Kinderzimmer stand ein grauer, tragbarer Plattenspieler. Es gab drei Schallplatten, die ich vor dem Einschlafen immer wieder gehört habe. Sie überdauerten, mit tiefen Kratzern im schwarzen Vinyl, alle anderen Geschichten, die mit den Jahren kamen und gingen: die griechischen Sagen, Winnetou I-III – und Herbert-Zimmermann-Radioreportagen von der WM 1954. Es waren also immer die gleichen Erzählungen, von denen ich nicht genug bekommen konnte: große und tragische Heldengeschichten aus verflossener Zeit.
Die WM-Radioreportagen aus der Schweiz faszinierten mich genauso wie die unglaubliche Heimkehr von Odysseus nach endloser Irrfahrt durch die Ägäis. Der große Schmerz in diesen beiden Geschichten deutete sich jedoch immer nur an: die Möglichkeit des Scheiterns. Die nicht wiedergutzumachende Niederlage. Der Tod. Ein Schmerz, der anders als in den Geschichten Karl Mays mit dem schrecklichen Ende von Nscho-tschi und Winnetou zum Glück nie Wirklichkeit wurde. Das Wunder von Bern war mein Fußballmärchen, mit dem ich beseelt einschlief. Die Worte dieses ungetrübten Glücks klingen mir noch immer in den Ohren.
„Ungarn führt mit 2:0. Eine unerhörte Nervenbelastung für unsere Mannschaft. Unsere Hintermannschaft ist nervös, sie macht sich gegenseitig Vorwürfe. Das sollte sie nicht.“
„Sechs Minuten noch im Wankdorf-Stadion in Bern. Keiner wankt. Der Regen prasselt unaufhörlich hernieder.“
„Schäfer nach innen geflankt. Kopfball. Abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tooor! Tooor! Tooor! Tooor!“
„Aus! Aus! Aus! Das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit drei zu zwei Toren in Bern.“
Was sonst noch zu hören war nach dem ersten großen deutschen Sieg nach dem Zweiten Weltkrieg, aber lieber verschwiegen oder kleingeredet wurde, sollte ich erst später erfahren, als ich mich professionell mit dem Fußball beschäftigte. Bei der Siegesfeier im Münchner Löwenbräukeller ergriff der damalige DFB-Präsident Peco Bauwens das Wort. Er schwärmte in einem nur allzu bekannten Ton davon, was ein gesunder Deutscher, der treu zu seinem Land stehe, zu leisten vermöge und das nun, nach diesem Sieg, diese Schlacken nicht mehr am Sport und am deutschen Volk hingen. Und wenn andere Zuschauer bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz auf dem Spielfeld mit ihren Fahnen herumliefen, unseren Leuten aber verboten sei, die stolze deutsche Fahne zu führen, dann werde man sich das niemals gefallen lassen. Unsere Mannschaft habe dafür allen die Quittung gegeben.
Der Bayerische Hörfunk brach nach diesen Worten seine Liveübertragung mitten in der Rede des DFB-Präsidenten ab. Bundespräsident Theodor Heuss stellte später fest, dass für Bauwens gut kicken offenbar schon gute Politik sei, aber weitere Folgen hatte die Sache nicht für den DFB-Präsidenten, dessen Bauunternehmen auf einer offiziellen Liste der Alliierten stand, in der, wie es wörtlich hieß, 2500 „Sklavenhalter“ im NS-Lagersystem aufgeführt waren.
Damit war schon unmittelbar nach den düsteren Jahren klar, dass diejenigen, die die Nationalelf für ihre Zwecke missbrauchen wollten, früh begriffen, wie das am besten geht. Daran hat sich bis heute wenig geändert, auch wenn sich die Motive gewandelt haben.
Als ich den faszinierenden Reportagen von Herbert Zimmermann lauschte, hatte ich von dieser anderen Seite des Fußballs noch keine Ahnung. Und wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mir gewünscht, dass diese dunkle Seite gar nicht existiert. Auf meine Helden durfte kein Schatten fallen.
In meinem Kinderzimmer hingen zwei Schwarz-Weiß-Fotografien an der Wand, so groß wie Poster. Das eine Foto auf der weißen Raufasertapete zeigte Uwe Seeler, wie er mit dem Hinterkopf das Tor zum 2:2 gegen England bei der Weltmeisterschaft 1970 macht, und das andere das 3:2-Siegtor von Gerd Müller, ein artistischer Volleyschuss in der Verlängerung jenes Viertelfinals, der Revanche für das in Wembley verlorene Endspiel von 1966. Uwe Seeler und Gerd Müller waren also die Männer, meine Helden, die ich morgens als Erste sah, wenn ich die Augen aufschlug, und es waren die Letzten, bevor ich einschlief. Seelers und Müllers Tore, die ich nie im Fernsehen oder gar im Stadion gesehen hatte, haben sich dennoch viel stärker in meine Erinnerung eingegraben als die Hunderte von Toren, die ich später bei Europa- und Weltmeisterschaften mit eigenen Augen sah, live im Stadion und danach noch dutzendfach in Zeitlupe.
Mein Ziel damals war klar: Ich wollte später werden, was alle Jungs in unserer Straße, in meiner Schule und im Verein werden wollten: Fußballprofi, mindestens. Aber lieber noch: Nationalspieler. Und Weltmeister. Ich wollte auch so einen besonderen Moment erleben, einen, wie ihn Gerd Müller und Helmut Rahn hatten und später Andi Brehme und Mario Götze. Ich war gut darauf vorbereitet, sehr gut sogar, denn auf dem Kopfsteinpflaster in unserer Reihenhaussiedlung erlebte ich diese Momente jeden Tag. Wenn ich mich ins Garagentor stellte, flog ich den Bällen wie Sepp Maier entgegen, obwohl ich Wolfgang Kleff mit seinem giftgrünen Trikot und den langen Haaren cooler fand. Aber Sepp Maier war einfach besser. Und er war Weltmeister. Daran kam niemand vorbei. Wenn ich Lust hatte, im Feld zu spielen, und dann vorne die Dinger reinmachte, war ich natürlich Holz.
Verschiedene Identitäten anzunehmen gilt gemeinhin als nicht ganz unkompliziert. Doch nirgendwo ist das so spielend leicht wie als Kind auf dem Fußballplatz. In meinem Verein war ich erst Torwart (natürlich im Kleff-Trikot) – und dann Mittelstürmer. Mein Trainer wollte mich unbedingt im Tor lassen, weil ich ein recht brauchbarer Torwart war, wie er meinte. Vermutlich sagte er das nur, weil sonst niemand ins Tor wollte.
Die Spieler der Nationalmannschaft waren viele Jahre ein Teil meines Lebens, eigentlich rund um die Uhr. Sie schauten mich Tag und Nacht von den Wänden meines Kinderzimmers an, und ich fieberte den Länderspielen entgegen, weil ich meine Helden dann über die gesamte Spielzeit im Fernsehen bewundern durfte und nicht bloß für ein paar Minuten am Samstag, wenn in der Sportschau ein paar Ausschnitte aus der Bundesliga liefen.
Mit der Weltmeisterschaft 1978 begann jedoch meine Entfremdung von der Nationalmannschaft. In Argentinien durfte Franz Beckenbauer nicht mitspielen, weil er es gewagt hatte, Deutschland zu verlassen und bei New York Cosmos zu unterschreiben. Den damaligen DFB-Präsidenten Hermann Neuberger habe ich für die Verbannung meines Kaisers zum Teufel gewünscht, denn tatsächlich bestrafte er damit ja mich. Ich hätte alles dafür gegeben, unseren besten Spieler bei der Weltmeisterschaft zu sehen, sogar mein Taschengeld. Aber ohnmächtig musste ich erleben, wie mir diese Freude genommen wurde, und dass wir den Titel nicht verteidigen würden, war mir völlig klar. Dafür sollte dieser Typ auf ewig in der Fußballhölle schmoren. Das wäre eine gerechte Strafe gewesen. Das 2:3 gegen Österreich aber war auch nicht schlecht.
In diesem Spiel entdeckte ich eine Seite in mir, die ich bis dahin in meiner Beziehung zur Nationalmannschaft nicht kannte: Schadenfreude.
Als der blonde Engel auftauchte, hatte ich wieder Hoffnung. Aber sie zerstob so schnell, wie Bernd Schuster gekommen war. Er wurde beim EM-Sieg 1980 mit zwanzig Jahren zum besten Spieler des Turniers gewählt. Er spielte schon damals so, als gehörte er zu Jogis Jungs. Aber für den DFB war er zu eigensinnig, vor allem seine Frau, die ihn managte, konnte der Deutsche Fußballmänner-Bund nicht ertragen. So ging nach 21 Spielen seine Karriere in der Nationalmannschaft dahin, und zurück blieb nur künstlerische Leere. Statt blonder Engel sah ich bald nur noch deutsche Panzer auf dem Platz. Das war in der ausländischen Presse ein gängiger Ausdruck tiefer Verachtung für das Zerstörerische im deutschen Spiel, und nicht nur dort. Ich empfand genauso.
Auf meinen Fußballplätzen war ich nun kein deutscher Nationalspieler mehr. Kein Kraftbolzen wie der wirklich nette Hans-Peter Briegel und auch kein Halbstarker wie Toni Schumacher. Als Dominique Rocheteau und Alessandro Altobelli war ich nun in den wunderbar stürmischen Diensten Frankreichs und Italiens unterwegs. Die beiden spielten nicht nur hinreißend, sie hatten auch einen ziemlich coolen Style, wie man heute sagt, sie hätten auch Rockstars oder Schauspieler sein können. In der deutschen Nationalmannschaft hieß der neue Star Karl-Heinz Rummenigge, aber ich kannte niemanden, der Kalle mit den glühroten Bäckchen sein wollte.
Ich mochte den deutschen Fußball nicht mehr. Und noch weniger die Typen, die ihn verrieten. Erst mit etwas Abstand lässt sich heute für jeden klar erkennen, dass wir es in unserer Jugend mit einer selbstgefälligen, zynischen Generation von Profis zu tun hatten, die nicht mehr den als altmodisch angesehenen Anstand ihrer Vorgänger um Fritz Walter und Uwe Seeler besaß. Ohne dabei das professionelle Bewusstsein zu besitzen, das sich die nachfolgenden Generationen aneigneten.
1982 im Spiel gegen Österreich, der Schande von Gijón, schlug meine Ablehnung in Verachtung um. Während der Partie winkten die spanischen Zuschauer im Stadion mit weißen Taschentüchern, um gegen diese Gemeinheit zu protestieren. Die wütenden, verzweifelten algerischen Fans, deren Team durch den deutsch-österreichischen Nichtangriffspakt ausschied, wedelten mit Geldscheinen. Ich war damals gerade mal siebzehn Jahre alt und konnte einfach nicht verstehen, wie erwachsene Männer nicht begriffen, dass Fußball auch eine moralische Dimension besitzt. Diese Typen besaßen nicht einmal die Kraft, sich für ihre Haltung und dieses Spiel zu entschuldigen. Mein Verhältnis zur Nationalmannschaft war über viele Jahre gestört. Wir hatten uns nichts mehr zu sagen.
Wie sehr hätte ich mir damals gewünscht, Fan einer deutschen Nationalmannschaft mit Spielern wie Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Thomas Müller, Mesut Özil, Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Miroslav Klose, Sami Khedira, Philipp Lahm, Mario Götze oder Toni Kroos zu sein. Jungs, die so großartig Fußball spielten, wie es nur die Brasilianer oder Franzosen zu ihren besten Zeiten konnten, und die so viel mehr Respekt gegenüber dem Fußball und ihren Fans mitbrachten als ihre Vorgänger aus den Achtzigerjahren. Da hätte ich mich vielleicht einmal mal geärgert, wenn sie ein schlechtes Spiel gemacht und verloren hätten, vermutlich wäre ich aber nur traurig gewesen. Aber niemals hätte ich mich schämen müssen.
Meine Verachtung für unsere Mannschaft bei der WM 82 wuchs während des Halbfinals gegen Frankreich ins Unermessliche. Ich musste mir gar nicht erst die Zeitlupe ansehen, um zu wissen, dass Toni Schumacher den wehrlosen Patrick Battiston beim Rauslaufen mit der Wucht seines zur Waffe umfunktionierten Körpers absichtlich zur Strecke gebracht hatte. Ich war ja selbst Torwart, und ich wusste, wann und wie man seinen Körper zum Selbstschutz einsetzen musste und was nur ein rücksichtsloser Angriff auf den Gegner war. Die Brutalität, mit der Schumacher den völlig unvorbereiteten Battiston niederrammte, war das brutalste Foul, das ich in meinem Leben gesehen hatte. Aber vollkommen unerträglich wurde der Angriff erst, als man im Fernsehen sah, wie Battiston bewusstlos am Boden lag und Schumacher teilnahmslos darauf wartete, den Abschlag ausführen zu können, und auf seinem Kaugummi rumkaute. Auch kein anderer deutscher Spieler kümmerte sich um den Franzosen. Niemals habe ich mich für die deutsche Nationalmannschaft so geschämt wie in dieser Nacht von Sevilla.
Dann kam das Elfmeterschießen. Aus einem 1:3 hatte die Nationalelf nach dem Foul an Battiston noch ein 3:3 in der Verlängerung gemacht. Und Schumacher hielt, als wäre nichts gewesen, im Elfmeterschießen kaltblütig zwei Elfer. Er gewann damit das Spiel und wurde von seinen Mitspielern für den Einzug ins Endspiel wie ein Held gefeiert.
Das Elfmeterschießen hatte mich völlig aus der Fassung gebracht. Ich hatte trotz allem mit dieser schrecklichen Nationalelf mitgefiebert. Irgendwo im hintersten Winkel meiner Fußballseele hatte ich der Nationalmannschaft doch die Daumen gedrückt, auch wenn ich mir das nicht anmerken ließ und es auch niemals zugegeben hätte. Als Horst Hrubesch zum entscheidenden Elfmeter anlief und ich diesen Ball unbedingt im Netz sehen wollte, spürte ich eine merkwürdige tiefere Verbundenheit mit diesem Team, die gar nichts mit diesen arroganten, brutalen Typen zu tun hatte, denen ich eigentlich jede nur erdenkliche Niederlage an den Hals wünschte. Später wurde mir klar: Meine Liebe hatte sich in eine Hassliebe verwandelt.
Wie stolz wäre ich gewesen, wenn ich in meiner Jugend die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien hätte erleben dürfen. Nach diesem leichten, herrlichen Fußball, den die deutsche Mannschaft in ihren besten Momenten spielte, hatte ich mich früher jahrelang vergeblich gesehnt, aber mindestens genauso nach dieser inneren Haltung, die das Team von Jogi Löw in Brasilien an den Tag legte und von der ich gut dreißig Jahre zuvor, in den Rüpel- und Flegeljahren der Nationalmannschaft, nur hatte träumen können.
Das Team von Jogi Löw dagegen hatte bei der Weltmeisterschaft 2014 tief verinnerlicht, was die dunklen Helden meiner Jugend nicht einmal ahnten: dass es im Fußball nicht nur auf den Sieg ankommt. Sondern dass man auch ein guter Verlierer sein muss und ein würdiger Gewinner, wenn man den Fußball wirklich liebt.
Als ich als Reporter erlebte, wie in Belo Horizonte, nach dem größten Sieg, den es bei einer Fußball-Weltmeisterschaft jemals in einem Halbfinale gegeben hatte, dem sagenhaften 7:1, die deutschen Spieler die vernichtend geschlagenen und gedemütigten Brasilianer geradezu zärtlich trösteten, wie sie die Schmach spürten, die nach dieser Niederlage in ihren Gegnern brannte, weil sie ihren brasilianischen Landsleuten eine so furchtbare Enttäuschung bereitet hatten, kam mir wieder dieses WM-Halbfinale von Sevilla in den Sinn. Der hässlichste und kälteste aller deutschen Final-Einzüge. In diesem Moment konnte man über den deutschen Fußball wie auch sonst ganz oft im Leben sagen: Die Zeit heilt alle Wunden.
Damals, in den finsteren Fußballzeiten, war ich nach dem furchtbaren Sieg gegen Frankreich überzeugt, dass es mir nun wirklich egal wäre, ob wir das WM-Endspiel gegen Italien gewinnen. Und nach den irritierenden Gefühlen im Halbfinale war es mir dann tatsächlich egal. Es sollte das einzige Finale bleiben, von dem ich nicht mehr weiß, wo und mit wem ich es überhaupt gesehen habe. Zu Hause? Alleine? Mit Freunden? Im Urlaub? Ich habe keine Ahnung. Die Erinnerung an diese Begegnung – einen Klassiker gegen Italien! – ist wie ausgelöscht. Der Spielverlauf und die Dramaturgie dieser 1:3-Niederlage sind aus meinem Gedächtnis völlig verschwunden. Ich kann mich zwar noch schwach erinnern, das Altobelli eines der Tore für die Italiener geschossen hat, aber schon der deutsche Torschütze fällt mir nicht mehr ein. Der Schock über den Betrug von Gijon und die Brutalität von Sevilla sollten meine Beziehung zur Nationalmannschaft lange belasten.
Zwei Jahre später bei der Europameisterschaft in Frankreich drückte ich nun den Franzosen die Daumen, nicht dieser Ego-Truppe unter Jupp Derwall, die den blonden Engel, der in Spanien verletzt gefehlt hatte, nun endgültig aus ihren Reihen vertrieben hatte. Meine Begeisterung schenkte ich weiter dem französischen Dribbler und Wirbelwind Dominique Rocheteau, meine grenzenlose Bewunderung aber galt Michel Platini. Die Enttäuschung über den genialen Regisseur holte mich erst rund dreißig Jahre später ein, als ich über die Skandale in den Fußballverbänden berichtete, über die Schmiergelder und schmutzigen Geschäfte, auch über die dunklen Seiten des Sommermärchens. Aber wie hätte ich damals ahnen können, dass selbst in einem französischen Fußballgott ein korrupter Parvenü stecken kann? Und ein Kaiser tatsächlich einmal ohne Kleider dasteht?
In den Achtzigerjahren erschien mir Franz Beckenbauer jedoch wie eine Erlösung. Ein Teamchef, der ganz alleine wieder die auf dem Fußballplatz lange vermisste Eleganz und Lässigkeit im deutschen Fußball verkörperte. Mit ihm war es dann nicht so schlimm, dass wir im WM-Finale1986 gegen Maradonas Argentinien mit einem halben Dutzend gefühlten Innenverteidigern antraten. Karlheinz Förster, Ditmar Jakobs, Norbert Eder, Andreas Brehme, Thomas Berthold, Hans-Peter Briegel – all diese kantigen Namen und Abräumertypen wurden dank des Kaisers für mich in mildes Licht getaucht. Und auch der majestätische Zorn, von dem die Lichtgestalt immer wieder mal heimgesucht wurde, erschien mir nur als eine allzu verständliche Ungeduld mit den Unzulänglichkeiten der allzu Irdischen. Selbst Toni Schumacher wirkte nicht mehr ganz so selbstsüchtig, Kalle Rummenigge nicht mehr ganz so bieder. Als ihm dann im Finale der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang und Rudi Völler kurz darauf der Ausgleich, war mein Nationalmannschaftsgefühl wieder da. Und mit dem bitteren Tor zum 2:3 von Jorge Burruchaga betrauerte ich den verlorenen WM-Sieg, der nach der grandiosen Aufholjagd schon unser zu sein schien.
Das nächste große Turnier, die Europameisterschaft in Deutschland, erlebte ich 1988 als junger Journalist im Alter von 23 Jahren. Die unschuldige Zeit als Fußballfan war vorbei. Danach war alles anders. Fast alles.
„Horenis Ende April veröffentlichte ›Gebrauchsanweisung‹ liest sich heute doppelt spannend: als Dokument einer Hoffnung, die zerstieb, und als Analyse eines Problems, das blieb.“
„Wer nachlesen will, was den Fußball von heute von den Generationen Ballack oder Matthäus unterscheidet, wie sich Joachim Löw zum flexiblen Taktiker entwickelt hat und wie diese Nationalmannschaft überhaupt funktioniert, ist bei Horeni mit seinem enormen Hintergrundwissen genau richtig.“
„Wer nachlesen will, was den Fußball von heute von den Generationen Ballack oder Matthäus unterscheidet, wie sich Joachim Löw zum flexiblen Taktiker entwickelt hat und wie diese Nationalmannschaft überhaupt funktioniert, ist bei Horeni mit seinem enormen Hintergrundwissen genau richtig.“
„Genau die richtige Lektüre, um die bevorstehende Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht noch besser zu verstehen.“
„Das Buch begleitet die Elf mit viel Sympathie sowie nicht alltäglicher, weiterführender Kritik.“
„Lesefutter für echte Fans.“
„Unterhaltsam und gut recherchiert.“
„Das Beste am Buch sind Stil und Perspektive, weil der Sportjournalist als teilnehmender Beobachter schreibt, der sich von der Magie des Spiels mitreißen lässt.“
„Kenntnisreich, witzig und mit vielen kleinen Anekdoten blickt Horeni tief in das Innenleben der beliebtesten deutschen Sportmannschaft.“
„›Gebrauchsanweisung für die Fußball-Nationalmannschaft‹ ist höchst unterhaltsam, aber auch tiefschürfend.“
„Mit diesen lesenswerten Hintergrundinformationen eines Insiders gefüttert, können die Spiele beginnen!“
„Streng genommen handelt es sich bei Horenis Werk natürlich nicht um eine Gebrauchsanweisung im eigentlichen Sinne. Sein Buch ist eher als Liebeserklärung an die Nationalmannschaft der Jahre 2004 ff. zu verstehen.“
„Für jeden Fan der ›Mannschaft‹ ist dieses Buch absolut lesenswert, Sie erhalten nicht nur Fachwissen, sondern auch spannende Geschichten rund um die Spieler, Trainer und Fans und sind damit bestens ›eingespielt‹ auf die WM 2018 in Russland.“
„Für jeden Fan der ›Mannschaft‹ ist dieses Buch absolut lesenswert.“
„Er bereitet seine intimen Kenntnisse in ›Gebrauchsanweisung für die Fußball-Nationalmannschaft‹ anekdotenreich auf und verrät, wie der fünfte Stern aufs Nationaltrikot kommen könnte.“
„Horeni erzählt uns so detail- und kenntnisreich von der Aura und den Emotionen, von der Geschichte und den Strategien dieses Teams, dass man die Nationalelf mit anderen Augen sieht.“
„Ein Lehrgang in Fußballbegeisterung und Expertentum, reich an aktuellsten Hintergrundinformationen.“
„Michael Horeni erzählt uns mit großem Insiderwissen detail- und kenntnisreich von der Aura und den Emotionen, von der Geschichte und den Strategien dieses Teams, dass man die Nationalelf mit anderen Augen sieht.“


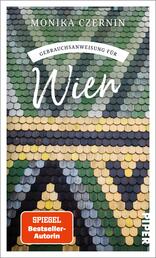
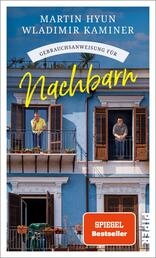






DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.