
Eine vorläufige Theorie der Liebe
Roman
„Dieser Roman stellt die Liebe ins Zentrum beim Versuch, das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine zu klären - denn erst die, wenn auch vorläufige, Theorie der Liebe, so Hutchins, mache aus dem Wust an Informationen aus dem Computer so etwas wie ein Wesen, mit so etwas wie einer Seele.“ - Der Spiegel
Eine vorläufige Theorie der Liebe — Inhalt
„Vaterlose Töchter, von Mutterliebe erdrückte Söhne, verführerische Exfrauen, großmäulige Schulabgänger – verdammt, dieses Buch hat was für jeden Leser!“ Gary Shteyngart
Mit Mitte dreißig steht Neill Bassett jr. wieder ganz am Anfang. Seine Frau hat ihn abserviert – jetzt muss er sich auf erniedrigende Single-Abende einlassen, nur um Anschluss zu finden. Ein neuer Job im Silicon Valley bringt zunächst zumindest Ablenkung: Bei einem Software-Unternehmen arbeitet Neill ausgerechnet daran, den ersten Computer zu entwickeln, der Gefühle verstehen und äußern kann. Ob ihm das hilft, bei der schrägen Kollegin Rachel zu landen?
Leseprobe zu „Eine vorläufige Theorie der Liebe“
1
Vor ein paar Tagen hielten ein Feuerwehrauto und ein Krankenwagen vor meinem Wohnhaus auf dem Hügel südlich des Dolores Park. Mehrere Sanitäter stiegen aus, der Größte von ihnen hatte eine schwarze Trage mit roten Gurten und Schnallen dabei. Sie waren wegen des Nachbarn gekommen, der über mir wohnt, Fred, ein Trinker und Einsiedler, für den ich seltsamerweise eine gewisse Bewunderung hege. Nicht, dass ich mit ihm tauschen wollte. Er verbringt den Großteil seiner Zeit vor einem kleinen Flachbildfernseher, den er vor der Wand am hinteren Ende seines [...]
1
Vor ein paar Tagen hielten ein Feuerwehrauto und ein Krankenwagen vor meinem Wohnhaus auf dem Hügel südlich des Dolores Park. Mehrere Sanitäter stiegen aus, der Größte von ihnen hatte eine schwarze Trage mit roten Gurten und Schnallen dabei. Sie waren wegen des Nachbarn gekommen, der über mir wohnt, Fred, ein Trinker und Einsiedler, für den ich seltsamerweise eine gewisse Bewunderung hege. Nicht, dass ich mit ihm tauschen wollte. Er verbringt den Großteil seiner Zeit vor einem kleinen Flachbildfernseher, den er vor der Wand am hinteren Ende seines Küchentischs aufgestellt hat und in dem ausschließlich Sportsender laufen. Fred raucht bedächtig und ohne jede Pause (meine Exfrau hat sich regelmäßig über den Gestank beschwert) und verfolgt wie gebannt Tennismatches, Football- und Basketballspiele, ja sogar europäische Fußballturniere. Er interessiert sich nicht für den Sport an sich, sondern für die Wetten, die er auf die Spiele abgeschlossen hat. Sein einziger regelmäßiger Besucher, der Postbote, ist zugleich sein Buchmacher. Früher war Fred selbst bei der Post.
Wie ich schon sagte, ich würde nicht mit ihm tauschen wollen. Die Einsamkeit und Eintönigkeit seiner Tage erscheinen mir wenig verlockend. Und trotzdem ist er für mich ein Vorbild an Selbstgenügsamkeit. Er trinkt und raucht zu viel, und wenn er überhaupt einmal etwas isst, dann eine aufgewärmte Dose Eintopf. Aber er verlässt das Haus und kauft alles selbst ein – Zigaretten, Alkohol, Konserven –, er stakst auf steifen Beinen zum Laden an der Ecke und kommt mit einer vollgestopften Papiertüte wieder zurück. Dann erklimmt er die drei Treppen zu seinem Apartment – eine schmutzige, spartanische Version meines Apartments –, das er ganz allein bewohnt, was auf dem brutalen Immobilienmarkt von San Francisco für sich schon eine Leistung ist. Er ist immer herzlich, wenn wir uns im Treppenhaus begegnen, und sogar in den traurigen Monaten nach meiner Scheidung, als mir ein anderer Nachbar vorschlug, eine Drehtür einzubauen (um dem hohen Durchgangsverkehr gerecht zu werden – eine abfällige Stichelei), hatte Fred stets ein freundliches Wort für mich übrig. Eines Tages klopfte er an meine Tür; ich solle ihn wissen lassen, falls er in der Wohnung über mir zu laut herumpoltere. Es sei ihm sehr wohl klar, dass er zum Trampeln neige. Ich hatte das Gefühl, er wollte mir sagen: Wir sind Nachbarn, mehr nicht, aber ich finde dich in Ordnung. Obwohl ich da vielleicht zu viel hineininterpretiere.
Als die Sanitäter an jenem Tag die Treppe hinaufstiegen, hörte ich zunächst Gemurmel und dann Fred, der ein Geräusch ausstieß, das irgendwo zwischen Jaulen und Schreien lag. Ich trat ins Treppenhaus, als ihn die Sanitäter gerade heruntertrugen. Sie schrien auf ihn ein wie die Offiziere auf Auszubildende beim Militär. Sir, bitte behalten Sie die Arme am Körper. Sir, Arme an den Körper. Sonst werden wir Sie festschnallen, Sir. Der Umgangston kam mir für einen so alten Mann völlig unangemessen vor, aber als sie mit dem auf die Trage geschnallten Fred um die Ecke kamen, sah ich, wo das Problem lag. Er versuchte, sich am Geländer festzuhalten und seinen Abtransport zu verhindern. Sein Gesicht war verzerrt, seine milchigen Augen glasig und voller Tränen.
„Tut mir leid, Neill“, sagte er, als er mich bemerkte. Flehentlich streckte er die Hände nach mir aus. „Es tut mir leid. Es tut mir so leid.“
Ich sagte ihm, er solle sich beruhigen. Ihm brauche nichts leid zu tun. Aber er hörte nicht auf, um Verzeihung zu bitten, während die Sanitäter ihn, fest auf die medizinische Trage gefesselt, an meiner Tür vorbeitrugen.
Anscheinend war er zwei Tage zuvor gestürzt und hatte sich die Hüfte gebrochen. Er hatte erst jetzt den Notruf gewählt. Er war achtundvierzig Stunden in seiner Wohnung herumgekrochen und hatte gewartet – Gott weiß, worauf. Dass der Schmerz von allein verschwinden würde? Dass ein Nachbar an seine Tür klopft?
Ich habe mich erkundigt, wohin man ihn gebracht hat. Er hat die OP schon hinter sich und erholt sich gerade in einer schicken Rehaklinik. Die Geschichte ist im Grunde also gut ausgegangen. Trotzdem muss ich immer wieder an seine Worte denken. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Wofür hat er sich entschuldigt, wenn nicht für seine Existenz an sich, für die Unannehmlichkeiten, die sein Leben und Atmen den anderen macht? Ja, er war verwirrt, aber ein Körnchen Wahrheit steckte darin. Fred ist nicht selbstgenügsam, sondern einsam. Die Erkenntnis sollte mir egal sein, sie sollte mein Leben nicht beeinflussen, und doch beschäftigt sie mich auf unerklärliche Weise. Vermutlich habe ich mich zu sehr darauf verlassen, dass Fred mein Vorbild sein könnte. Mein Vater, der eigentlich kein Intellektueller war, hatte ein Lieblingszitat von Pascal: Der einzige Grund für das Unglück des Menschen ist sein Unvermögen, still in seinem Zimmer zu sitzen. Ich hatte mir Fred immer als einen Menschen vorgestellt, der still in seinem Zimmer sitzt.
Nicht jeder erlebt die große Liebe. Das weiß ich. Meine erste Ehe ging vor ein paar Jahren in die Brüche, und abgesehen von den Drehtürmonaten im Anschluss an die Scheidung habe ich meine Zeit mehr oder weniger allein verbracht. Gelegentlich habe ich eine Frau zum Essen ausgeführt oder mich mit einem One-Night-Stand zu trösten versucht, was tatsächlich funktionieren kann, solange man mit der richtigen Einstellung an die Sache herangeht. Ich habe meinen Alkoholkonsum stark erhöht und dann wieder stark zurückgefahren. Ich selbst bestimme die Bahnen, in denen mein Leben verläuft. Das Junggesellenleben, so viel habe ich begriffen, braucht feste Gewohnheiten. Kleine Rituale und kleine Freuden. Ich sage das ganz ohne Selbstmitleid. Wen interessiert es, dass ich genau zwei Schluck Sahne in meinen ersten Kaffee kippe, aber nur einen in den zweiten (und letzten des Tages)? Niemanden – und trotzdem sind diese drei Schluck Sahne ein wichtiges Strukturelement in meinem Vormittag.
Die festen Gewohnheiten haben zur Folge, dass ich nie zu viel trinke und paradoxerweise als sechsunddreißigjähriger Junggeselle unflexibler bin als damals, als ich noch verheiratet war. Jeden Morgen um sieben füttere ich die Katze. Ich mache mir eine Frühstückstaco – Rührei, eine Scheibe Chilikäse, Maistortilla, grüne Salsa – und koche Espresso auf der Herdplatte. Ich esse im Stehen. Bis sieben Uhr vierzig sitze ich mit der Katze auf dem Schoß in der Küche und lese die E-Mails, die über Nacht in meinem Postfach eingegangen sind. Lauter interessante Angebote: Restposten, Gratisproben, zwanzig Prozent Rabatt. Ich lösche das meiste, springe unter die Dusche und verlasse die Wohnung um Punkt acht. Die Fahrt zur Arbeit dauert fünfzig Minuten, von San Francisco nach Menlo Park.
Arbeit, das heißt Amiante Systems, ein pompöses linguistisches Computerprojekt. Das unternehmerische Konzept weist Mängel auf – der Firmengründer dachte, Amiante sei Lateinisch für Magnetismus; erst meine Exfrau Erin wies mich darauf hin, dass es sich um das französische Wort für Asbest handelt –, aber ich mag meinen Job und werde pünktlich bezahlt. Es gibt einen Chef und neben mir noch einen weiteren Angestellten. Zu dritt trainieren wir ein komplexes Computerprogramm, das auf einem ausführlichen Tagebuch basiert: Der Text umfasst volle zwanzig Jahre. Der Verfasser wurde von der einzigen historischen Fachzeitschrift, die je einen Auszug abgedruckt hat, als der „Samuel Pepys der Südstaaten“ bezeichnet. Die Tagebücher sind ein Konglomerat aus Gedanken und Anekdoten, über fünftausend Seiten voller Meinungen, Geschichten, Sprichwörter, Lebensphilosophien und medizinischer Ratschläge. Das Programm soll lernen, sprachliche Aussagen zu generieren, mit anderen Worten: Es soll Unterhaltungen führen. Es soll sprechen. Die Idee dahinter ist, dass die verborgenen Bezüge der Einträge einen logischen Zusammenhang darstellen, eine Persönlichkeit also, die allen vorangegangenen derartigen Projekten – Spielereien, die in „digitalen Assistenten“ mündeten – fehlte. Der Tagebuchschreiber, ein Arzt aus Arkansas, war mein verstorbener Vater. Was mir letztendlich meinen Job verschafft hat: Juristisch betrachtet sind die Tagebücher mein Eigentum. Mein Boss hat mich trotzdem ins Herz geschlossen. Von Computern verstehe ich nur wenig – nach dem Studium habe ich als Werbetexter gearbeitet –, aber als einziger Muttersprachler in unserem Unternehmen ist es mir immerhin gelungen, das Programm wie einen echten, wenn auch leicht verwirrten Menschen klingen zu lassen.
Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, füttere ich die Katze und koche mir ein Abendessen. Ich setze mich auf mein neues Sofa. An den Wochentagen trinke ich ein Glas Wein und schaue einen Film an. Am Wochenende treffe ich mich manchmal mit einem alten Freund oder mit einem neuen (obwohl ich nur wenige neue und noch weniger alte Freunde habe), oder ich verabrede mich mit einer Frau (alles wird geplant, nichts dem Zufall überlassen). Gelegentlich steuere ich eine Bar mit einem mir vertrauten Wirt an. Ich betrachte das als Luxus, wobei es entscheidend für ein gelungenes Junggesellenleben ist, sich hin und wieder einen kleinen Luxus zu gönnen. Dazu gehören auch das Parken – für dreihundert Dollar im Monat bleibt es mir erspart, Abend für Abend endlos um den Block zu fahren – sowie verschiedene Zeitschriftenabos, zweimal im Monat eine Putzfrau, eine gut bestückte Hausbar und eine beheizbare Fußbadewanne. Wenn ich überarbeitet bin, gebe ich meine Kleider in die Reinigung. Etwa zweimal im Jahr gönne ich mir eine Ganzkörpermassage. Einmal pro Woche lasse ich mir das Abendessen ins Haus kommen, und manchmal, wenn ich einen besonders selbstbewussten Moment habe, setze ich mich mit einem Buch in ein nettes Restaurant.
Ich bin in den Südstaaten aufgewachsen, habe meinen Lebensmittelpunkt aber aus Lifestylegründen nach San Francisco verlegt. Ich liebe die regennassen Straßen und den Anblick der sauberen Downtown, die Restauranttrends, die mit blindem Gehorsam befolgt werden (im Moment sind Innereien schwer angesagt). Ich liebe das üppige Gemüseangebot der kleinen Eckläden, der Bauernmärkte und der fliegenden Händler mit ihren Pick-up-Trucks. In dieser Stadt gibt es viele gestrandete Singles wie mich, und immer wieder lasse ich mich auf flüchtige Bekanntschaften und Kurzbeziehungen ein. Nach dem Ende meiner Ehe habe ich mich auf eine verrückte Wohnungssuche im Silicon Valley begeben, um näher an meiner Arbeitsstelle zu sein, aber zum Glück habe ich rechtzeitig erkannt, was in der Vorstadt aus mir werden würde. Ich würde in meinem Haus verschwinden und von Instandhaltungs- und Gartenarbeiten absorbiert werden. Ich würde zu einem Phantom verblassen, denn das ist die große Gefahr des Junggesellendaseins: Eines Tages wird man so unverbindlich und vage, dass die Leute durch einen hindurchsehen.
Ich entschied mich für eine andere Lösung, was ich nicht zuletzt Fred zu verdanken hatte. Ich beschloss, in der Stadt zu bleiben, in jener Wohnung, in der ich mit Erin zusammengelebt hatte, und mich mit der Junggesellenlogik vertraut zu machen. Ein schnörkelloses System ohne Raum für Sentimentalitäten. Grundvoraussetzung ist die Erkenntnis, dass man sich als Junggeselle in einem permanenten Übergangsstadium befindet. Feste Überzeugungen sind eher hinderlich. Die Junggesellen, mit denen ich lockere Freundschaften geschlossen habe, waren durchweg nette Kerle. Mit Männern, die Frauen als Zicken und Schlampen bezeichnen, habe ich noch nie etwas anfangen können, auch wenn diese Männer in San Francisco so häufig vorkommen wie im Rest der Welt. Es ist nicht einmal ihre Frauenfeindlichkeit, die mich abschreckt – es ist ihr Selbstbetrug. Frauenhasser sind unfähig, orientierungslos und kleinlich. Die erfolgreichen Junggesellen hingegen, die Nichtverbitterten, haben mich viel gelehrt: Freundschaften zu pflegen, beispielsweise, und niemals Löffel und Gabel zu benutzen, wenn eins von beidem reicht. Wenn es um das ideale Frühstück, soziale Interaktionen und die Liebe geht, sollte man das Einfache dem Komplizierten vorziehen. Ich kenne einen Mann, der in einer Hängematte schläft; einen Mann, der nichts Organisches in seiner Wohnung duldet, nicht einmal Lebensmittel; einen Mann, der vom kinderlosen Junggesellendasein so überzeugt ist, dass er sich einer Vasektomie unterzogen hat (von ihm stammt das Rezept für die Frühstückstaco). Ein anderer Junggeselle weihte mich in seine Strategie ein, die traurigen Phasen körperlicher Einsamkeit zu überstehen. Wenn er nicht in der Stimmung war, um tanzen zu gehen oder sich zu verabreden, wenn er nichts weiter wollte als eine sinnliche Nacht mit einem weiblichen Körper, eine windstille Ecke, um das Nomadenzelt seiner Seele aufzuschlagen, dann checkte er in eines der großen Hostels der Stadt ein. Ich habe angemerkt, das klinge etwas aufdringlich und gestört, aber er wies mich darauf hin, dass aufdringlich und gestört keine Kriterien seien. Es sei nicht unmoralisch, und nur das zähle. Er sehnte sich nach Zärtlichkeit, und Durchreisende würden dieses Bedürfnis ebenso empfinden. Er drängte sich niemandem auf, im Gegenteil, er stellte seine guten Ortskenntnisse und seine gut gefüllte Brieftasche zur Verfügung. Heikel wurde es nur, wenn es darum ging, eine gute Ausrede für den Aufenthalt in der Jugendherberge zu erfinden. Man hatte Besuch von älteren und gebrechlichen Verwandten bekommen, denen man sein Bett zur Verfügung stellen musste. Man hatte zu Hause einen Wasserrohrbruch. Oder man nahm seinen Reisepass mit und gab vor, selbst auf Reisen zu sein.
„Mehrere Fliegen mit einer Klappe“, sagte mein Freund. Ich konnte nicht anders, als seine Junggesellenlogik zu bewundern.
Lag er am Ende falsch? Wird auch dieser Freund, dieser gute Mann eines Tages angeschnallt auf einer Trage liegen, die Hände verzweifelt nach dem Treppengeländer ausgestreckt?
Es tut mir so leid, Neill.
Mein Vater – seit dem Selbstmord nenne ich ihn nicht mehr Dad, das käme mir zu rührselig vor – hätte sogar dieser Geschichte eine spezielle, ganz eindeutige Moral abgewonnen. Er war Traditionalist durch und durch; fast wundert es mich, dass er zu Lebzeiten keine historischen Kostüme getragen hat. Gern zitierte er die Grabinschrift seiner Eltern: „Trost gab es kaum, aber da er nie gekannt, ward er nicht vermisst.“ Ein Satz aus Ivanhoe. Mein Vater stammte aus „altem“, erzkatholischem Südstaatenadel und hätte, wäre er noch am Leben, von mir verlangt, meine Pflicht zu erfüllen – vermutlich irgendeine Variante von „sich für die Gemeinschaft einsetzen“. Als er sich umbrachte, war ich noch auf dem College. Sein Tod traf mich zutiefst, befreite mich gleichzeitig aber von einer gewissen Ängstlichkeit, von einer eingeschränkten Sicht auf die Welt. Ich entband mich von meinen Pflichten als „Stammhalter“ einer „alten“ Familie und zog nach Kalifornien (ebenso gut hätte ich die Wörter „Pflichten“ und „Familie“ in ironische Anführungszeichen setzen können). Ich übernahm die Aufgaben eines verantwortungsvollen Mitbürgers: Müll trennen, Fahrrad fahren, an Umweltschutzorganisationen und das Obdachlosenheim der Glide Memorial Church spenden. Ich gehöre dem SFMOMA und der Film Society an. Ich habe mich in meinem Leben eingerichtet, und meistens geht es mir gut. Nicht schlechter als meinem Bruder, der sich für ein Leben mit weißem Holzzaun in Michigan entschieden hat, für das unablässige Streben nach dem Banalen. Und besser vermutlich als meiner Mutter, die unser altes Haus in Arkansas zu behalten und ihm gleichzeitig zu entfliehen versucht, ein Kompromiss, der sie in einer endlosen Schleife aus Bildungsreisen und Kreuzfahrten an die verlassenen Küsten dieser Welt gefangen hält.
Meinem Vater wäre mein Lebenswandel ein Rätsel. Mein Alltag wäre ihm keine Erwähnung wert. Trotzdem findet das Tagebuch meines Vaters – Dr. Bassett, wie er bei Amiante Systems genannt wird – eine Antwort auf jede meiner Fragen. Wobei ich, da es sich um ein recht simples Programm handelt, eine mit Konversationstricks und Suchfunktionen angereicherte Version der Tagebücher, kaum behaupten kann, er würde mich „verstehen“. Dr. Bassett kann keine Gedanken weiterverfolgen oder auch nur unterscheiden, wer gerade mit ihm spricht. (Er weiß zum Beispiel nicht, dass ich sein Sohn bin.) Aber manchmal gebe ich ein paar Wörter ein, und der Computer pariert wie ein Furby mit einem Satz, in dem eine versteckte Einsicht aufblitzt. Heute Morgen kam es zu folgendem Austausch:
frnd1: soll ich heute abend ausgehen oder zu hause bleiben?
drbas: freitage sind freundtage
frnd1: schöner gedanke, aber heute ist donnerstag
drbas: ????
Sobald ich mehrere Aussagen hintereinanderstelle oder ein „und“ oder „oder“ benutze, verliert er den Überblick.
frnd1: diese ansicht ist ein schöner gedanke
drbas: wie findest du es, dass meine ansicht ein schöner gedanke ist?
frnd1: ganz gut. soll ich heute abend also ausgehen oder zu hause bleiben?
drbas: du hast lange genug geschmollt. du solltest dich amüsieren
Diese Antwort musste ich natürlich korrigieren. Nichts in der vorherigen Unterhaltung wies darauf hin, dass ich geschmollt hätte. Aber er hatte trotzdem recht. Nun sitze ich zu Hause, und draußen vor dem Fenster senkt sich die Dunkelheit wie eine Bleidecke herab. Wenn ich mich jetzt nicht von meinem Sofa losreiße, bleibe ich hier kleben. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auf die schwarze, unbarmherzige Stadt meiner verlorenen Dreißiger hinauszustarren, während unter meinem Fenster wie so oft das Gelächter der anderen durch die Straße hallt.
An der Fisherman’s Wharf, die nur eine kurze Taxifahrt entfernt liegt, erwacht die Ghirardelli-Leuchtschrift flackernd zum Leben. Ich werde von einer großen Blondine namens Rachel und einer kleinen Brünetten namens Lexie begleitet, die aus Tel Aviv angereist sind. Keine der beiden ist eine Schönheit, aber ihre Jugend macht sie attraktiv. So soll es auch sein, schließlich habe ich die beiden in einer Jugendherberge kennengelernt. Es war so einfach, wie mein Bekannter angekündigt hatte. Ich zeige euch die Stadt, habe ich gesagt. Okay, haben die Mädchen geantwortet. Es lief genau so, wie ich es mir gewünscht hatte, und doch liegen mir die Umstände schwer im Magen. Statt mich für einen Touristen auszugeben, hätte ich mir ein schlichteres Alibi einfallen lassen sollen. Dass in meiner Wohnung das Wasser abgestellt ist, zum Beispiel. Ich hatte mich jedoch nach dem Gefühl der Entwurzelung gesehnt, das mit dem Reisen einhergeht und sich nun tatsächlich eingestellt hat. Da ist es, das San Francisco, wie man es von Postkarten kennt. Der Duft von gekochten Krebsen hängt in der eisigen Luft, und die Ladenschilder des riesigen T-Shirt-Basars glitzern in der Abenddämmerung. Der Nebel hat die Golden Gate Bridge eingehüllt, während das hell erleuchtete Alcatraz einsam aus dem grauen Wasser ragt. Fehlt nur noch das Klingeln eines Cable Car, das prompt zu hören ist – dingding. Die Powell-Hyde-Linie.
Die Mädchen sind so dünn angezogen, als wollten wir in Miami auf Klubtour gehen: Miniröcke mit Lammfellstiefeln, dazu hautenge, schlauchartige Oberteile. Sie ziehen Grimassen. Sie zittern. Rachel, die Blonde – attraktiver, aber weniger niedlich als ihre Freundin – bekommt in der Kälte rote Flecken auf der Haut.
„Was für eine Aussicht“, sage ich. Sie sind zum ersten Mal in San Francisco.
„Unglaublich“, sagt Rachel.
„Ich kann nicht glauben, dass das hier Kalifornien sein soll, verdammt“, sagt Lexie und reibt sich die Oberarme. Sie ist rundlich, frisch gepudert und jung, aber sie hat die tiefe, heisere Stimme einer Patientin mit Lungenemphysem. „Wo steigt denn nun die Party?“
„Können wir nicht einfach für drei Sekunden die Aussicht genießen?“, fragt Rachel.
„Das hier ist unsere letzte Stadt.“ Lexie wirft mir einen bitterbösen Blick zu. Ich verstehe auf Anhieb: Sie will mich loswerden. Wahrscheinlich ist ihr meine Ausstrahlung zu negativ.
„Und du willst machen, was du in jeder Stadt machst“, sagt Rachel.
„Bislang hat es doch gut geklappt, oder?“, giftet Lexie. „Wir hatten jede Menge Spaß, oder?“
Rachel schüttelt den Kopf, sie sieht angewidert aus.
„Komisch, dass du ganz allein reist“, sagt Lexie zu mir.
Ganz allein. Ich taste die Worte mit der Zunge ab wie eine frische Zahnlücke. „Allein zu sein hat seine Vorteile“, sage ich.
„So was sagt doch nur ein Loser ohne Freunde.“
Gutes Argument. „Auch ein Loser ohne Freunde hat manchmal recht“, sage ich.
„Bist du einer von diesen verheirateten Typen?“, fragt Lexie. „Die nur auf Sex aus sind?“
„Ich bin nicht verheiratet.“
„Du gehst wie einer, der verheiratet ist“, sagt sie. Sie macht die Arme steif und schiebt sich mit roboterhaften Bewegungen über den Gehweg wie ein Aufziehspielzeug.
„Ich glaube“, sage ich, „du verwechselst verheiratet mit fußlahm.“
„Sie verwechselt alles Mögliche“, sagt Rachel.
„Sie verwechselt alles Mögliche“, äfft Lexie sie mit schiefem Mund und Babystimme nach – ein Baby mit schwarzer Lunge.
Wind kommt auf und bläst den Dunst von den Imbissbuden herüber, bis er auf unseren Gesichtern kondensiert. Ich muss mich daran erinnern, dass ich hergekommen bin, um Spaß zu haben. Das Ganze sollte ein lustiger Streich sein, ein befreiender Jubelschrei. Mein Boss, Henry Livorno, behauptet, es gebe keinen messbaren Unterschied zwischen Schein und Sein. Auf diesem Konzept des Operationalismus basiert unser Projekt, aber genauso gut ließe es sich auf den heutigen Abend anwenden. Wenn ich mich ausgelassen gebe, fühle ich mich vielleicht tatsächlich so.
„Wie geht ein Single?“, frage ich.
Die Mädchen ignorieren mich. Lexie starrt in die Ferne, als könnte sie dort hinten vielleicht die Leute entdecken, mit denen sie eigentlich verabredet ist. Rachels Aufmerksamkeit richtet sich derweil auf einen Imbissstand ganz in der Nähe. Sie beobachtet den Angestellten, der sich die Mütze in die Stirn schiebt und eine Reihe dampfender weißer Krebse aus einem brodelnden Bottich fischt.
„Die Dinger sind ja riesig“, sagt sie.
„Das sind Taschenkrebse“, erkläre ich. Sie hat die gertenschlanke Figur einer Tänzerin und ist ungeschminkt – die Ausgehklamotten stehen ihr nicht. Sie wirken merkwürdig an ihr, wie eine Verkleidung. „Magst du einen probieren?“
„Rachel ist koscher“, sagt Lexie mit einem höhnischen Grinsen.
„Treib es nicht zu weit“, sagt Rachel und verschränkt die Arme vor dem Körper. „Mir ist kalt, meinetwegen können wir nach Hause gehen.“
„Mark Twain hat mal gesagt …“, fange ich an.
„Es ist wirklich scheißkalt“, sagt Lexie, die plötzlich ernst geworden ist. „Willst du dir was überziehen?“
„Ja, gute Idee“, sagt Rachel.
Es wäre nicht das erste Mal, dass mir ein Abend entgleitet. Ich gehöre nicht zu jener glücklichen, unverhohlen gierigen Sorte Männer, die sich zielstrebig ins Spiel des Lebens werfen. Aber dann denke ich an Fred und reiße mich zusammen. Ich ziehe die Mädchen unter die Markise des nächsten T-Shirt-Ladens – „Olde Time Sourdough Souvenirs“ – und biete ihnen an, bunte Sweatshirts mit Namensdruck zu kaufen. Damit sie nicht frieren. Damit sie nicht nach Hause gehen.
„Ich versuche, nicht so viele Dinge, na ja, anzuhäufen“, sagt Rachel verlegen. „Simplify!“
„Du hast Thoreau gelesen?“, frage ich und ernte einen neuen Blick von ihr – überrascht und ein bisschen dankbar.
In einer dunklen Bar im Marina District glimmen wir in unseren himmelblauen Sweatshirts vor uns hin. Lexie ist David. Rachel ist José. Ich bin Gina. Der schwarze Teppich riecht nach Bier, wovon ich eine Menge getrunken habe. Es geht mir besser. Aus irgendeinem Grund ist es hier drinnen so diesig wie draußen – vielleicht steht in der Ecke eine Nebelmaschine? Rachel und ich sitzen auf Barhockern, und Lexie hält sich an der Platte des Stehtischchens fest, das ihr fast bis ans Kinn reicht. Sie trägt eine geschmacklose French Manicure, ihre Perlmuttnägel schimmern wie Plastik und sind so eckig wie kleine Meißel. Aus den Boxen wummern die Bässe; Lexie lässt die Hüften so widerwillig kreisen, als würde sie dazu gezwungen. Sie könnte damit zwar nicht Herodes dazu verführen, ihr den Kopf des Täufers zu bringen, aber sie hat vier oder fünf Hüftschwünge drauf, die sonst eher beim Geschlechtsverkehr zum Einsatz kommen. Wer ist dieses Mädchen? Sicher repräsentiert sie einen bestimmten Typ Frau, einen Typ, der mir unbekannt ist. Ganz offensichtlich schwimmt sie mit dem Strom – eine Einstellung, die unverdientermaßen einen schlechten Ruf hat; was ist egalitärer, als mit dem Strom zu schwimmen? Aber ich weiß nicht, wovon genau sie beeinflusst ist. Bestimmt gibt es irgendeine Fernsehserie, die ich als Einziger in dieser Bar nicht gesehen habe. Einen absoluten Quotenhit. Eine Serie, die offenbar die Träume dieser Klientel bedient, denn Lexie erregt deutlich die Aufmerksamkeit der Männer an den Tischen, der Männer an der Bar, der Männer in der dunklen Ecke neben der Jukebox. Männer, die in Marina ausgehen, die größer sind als der Durchschnitt, die regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und spitze Schuhe tragen. Eine seltene Unterspezies der Mit-dem-Strom-Schwimmer.
Lexie dreht sich mitten im Hüftschwung zu mir um. „Willst du uns nicht noch ein paar Drinks ausgeben?“, ruft sie.
„Du klingst nicht, als wärst du aus Tel Aviv.“
„Weil ich keinen Akzent habe? Was bist du, Antisemit?“
Rachel greift in ihre Bauchtasche, die sie statt einer Handtasche trägt, und schiebt Lexie einen Zwanziger hin. „Geh selbst.“
„Das reicht nicht!“, ruft Lexie. „Ich will einen Sambuca-Slammer.“
Ich schiebe einen zweiten Zwanziger hinterher. „Hol dir, was du willst“, sage ich.
„Mit dem stimmt doch was nicht“, sagt Lexie. „Der hat doch bestimmt K.o.-Tropfen dabei.“
„Kein Problem“, sagt Rachel. Sie legt eine Hand über ihre Bierflasche, zum Beweis ihrer Unbetäubbarkeit.
„Du weißt, dass wir Freundinnen sind“, sagt Lexie. „Und damit meine ich nicht bloß Freundinnen, die zufällig Mädchen sind.“ Um ihre Aussage zu untermauern, macht sie eine bemerkenswert vulgäre Geste mit zwei Fingern und ihrer Zunge. Rachel bekommt einen Hustenanfall. Ich glaube, sie ist entsetzt über das Benehmen ihrer Freundin. „Ich weiß ja nicht, wie du dir das heute Abend vorgestellt hast, aber dazu wird es garantiert nicht kommen“, sagt Lexie zu mir.
Ich zeige in Richtung Bar. „Vergiss das Trinkgeld nicht.“
Lexie tätschelt Rachels Hand auf der Bierflasche. „Bis ich wieder da bin“, sagt sie und geht rückwärts vom Tisch. Sie richtet zwei Finger auf ihre Augen, dann zeigt sie auf mich. Ich behalte dich im Auge.
„Sie weiß, was Trinkgeld ist.“ Rachel sieht ihrer Freundin mit gerunzelter Stirn nach. Draußen waren Rachels Augen von einem hellen, kristallinen Grün, aber hier drinnen wirken sie dunkel und trüb, wie alte Limetten. Ihre Haut ist wächsern weiß, nur ihre gut durchbluteten Wangen sind gerötet. „Wir sind nicht aus Israel. Wir sind aus New Jersey. Und wir sind kein Paar. Ich weiß auch nicht, warum sie ständig solchen Mist erzählt.“
Ich verstehe. „Es ist doch lustig, hin und wieder in eine andere Rolle zu schlüpfen.“
„Ich dachte, der Sinn des Reisens wäre, herauszufinden, wer man eigentlich ist?“ Sie trommelt mit den Fingern auf die Tischplatte, streicht sich eine lose Haarsträhne hinters Ohr. „Aber ich wollte euch nicht dazwischenfunken. Ich weiß, sie ist ziemlich scharf.“
Ich bin überrascht. Habe ich Interesse an ihrer Freundin bekundet? Bin ich an ihrer Freundin interessiert? Ich beobachte, wie Lexie die Arme hebt und den Barmann auf sich aufmerksam macht, wobei ihr Minirock an ihren ausladenden Oberschenkeln hochrutscht. Das Kriterium der Einfachheit würde tatsächlich für Lexie sprechen.
„Warum glaubst du, ich könnte an ihr interessiert sein?“, frage ich.
Rachel trinkt einen Schluck Bier. „Sie hat echt gute Titten. Schön rund. Und echt sind sie auch noch.“
„Bessere Frage: Warum glaubst du, sie könnte an mir interessiert sein?“
„Für sie liegst du ziemlich genau im Durchschnitt.“
Durchschnitt. Ich weiß nicht, ob man mich überhaupt zutreffender beschreiben kann. Was vermutlich für Rachels Meinung über mich nichts Gutes bedeutet. Sie ist nett, ein bisschen zu nett vielleicht. Wahrscheinlich gehört sie zu der Sorte Mädchen, die immer einen Freund haben. Ich sehe Lexie mit drei Flaschen in der einen und drei Schnapsgläsern in der anderen Hand zurückkommen. Sie überreicht uns die Getränke, als wären sie ein Geschenk.
„Die Amerikaner müssen immerzu schreien.“ Sie wirft sich das Haar in den Nacken. „Und sie stehen nur blöd rum.“
„Stehen die Leute in Tel Aviv nicht rum?“, frage ich.
Sie schenkt mir den Hauch eines Lächelns, das erste an diesem Abend. Es ist nahezu kokett. „Sie tanzen, Dummi. Wir haben die allerbesten Klubs. Das Dome. Das Vox.“
„Kann ich bei dir wohnen, wenn ich zu Besuch bin?“
Sie zuckt die Achseln, dreht sich zur Menge um und nimmt ihre Hüftrotation wieder auf. Falls sie Interesse an mir hat, ist es nicht allzu groß. Oder vielleicht war ich auch nur zu forsch. Oder sie versucht, mich eifersüchtig zu machen. Im Halbdunkel checkt sie andere Bewerber ab, mehr oder weniger unauffällig beobachtet sie, wer sie beobachtet. Die Gesichter der Männer sind ausdruckslos und feindselig. Sie betrachten Lexie, Rachel und die anderen Frauen mit unverhohlener Aggressivität, als wollte sie ihnen die Kehle durchschneiden. Alles nur Theater, und das Drehbuch für den Abend haben sie aus einem Vampirfilm geklaut, in dem die kluge Frau den Wilden zähmt. Und doch kommt mir die Konvention irgendwie niedlich vor. Ich fühle mich wohler als unter den Hipstern und Intellektuellen, die normalerweise mein Umfeld bilden, die saufen und sich den Mund fusselig reden, nur um alles und jeden zu überzeugen: Wir könnten tiefe Gefühle für diese Person entwickeln, wir tun es bloß nicht. Hier hat das Spiel Regeln, so deutlich, als hingen sie eingerahmt neben der Dartscheibe; der Handel wird durch die offene Zurschaustellung der Ware erleichtert. Der Stoff klebt an Brüsten, Deltamuskeln, Pobacken und Waschbrettbäuchen. Sie wissen, wir alle haben einen Preis; und obwohl sie insgeheim immer noch die Hoffnung hegen, den ultimativen Liebeseinkauf zu tätigen, sind sie bis dahin einem Mietverhältnis nicht abgeneigt. Die zielorientierte Funktionsweise des Fleischmarktes ist verstörend logisch.
„Du kannst bei mir wohnen“, sagt Rachel, „dann gehen wir im Dome und Vox feiern.“
„Ist das ein Laden oder zwei?“
„Frag doch Lexie. Sie ist da überall Stammgast.“
„Ich wusste gar nicht, dass du Stammgast bist!“, rufe ich Lexie zu.
„Was?“ Sie sieht gekränkt aus. „Ich weiß nicht, wovon du redest.“
Wovon rede ich? Ich habe keine Ahnung. Wieder muss ich an die Fernsehserie denken, die ich als Einziger in dieser Bar nicht gesehen habe. Worum geht es in der Sendung? Zwei verrückte Mädchen in engen Tops, die durch die USA reisen? Wie sehen die männlichen Darsteller aus? Ganz bestimmt nicht so wie ich. Ich bin eine Fehlbesetzung. Vielleicht sehen sie aus wie die Typen hier – wie der Yuppie, der mit spitzen Schuhen, weiten Jeans und hochgegelten Haaren neben den Toiletten an der Wand lehnt. Er sieht aus, als hätte jemand mit nacktem Hintern auf seinem Kopf gesessen. Wen stellt er eigentlich dar?
Ich rutsche von meinem Barhocker. „Klo!“, rufe ich den Mädchen zu.
Aus der Nähe sieht der Yuppie noch größer aus. Er geht wohl regelmäßig ins Fitnessstudio, er strotzt vor Kraft, und auf der halb nackten rasierten Brust trägt er eine Tätowierung, die aussieht, als hätte er sie sorgsam auf die Ornamentik seines T-Shirts abgestimmt. Ich hoffe, dass ich mich täusche und die Sache genau andersherum abgelaufen ist. Sein Rasierwasser kann ich nicht einordnen, es riecht seltsam blumig. Er hat die Arme vor der Brust verschränkt und hält die Bierflasche wie eine Keule. Er starrt mit böser Psychopathenmiene auf mich herunter.
Ich drehe mich zu den Mädchen um. Sie schauen in entgegengesetzte Richtungen und unterhalten sich nicht. Die lange Reise fordert ihren Preis.
„Was hältst du von der Brünetten?“, frage ich.
Der Yuppie mustert mich von oben bis unten. Von seiner Coolness sollte ich mir vermutlich eine Scheibe abschneiden.
„Wenn du deine Schwestern hier anschleppst“, sagt er, „werden sie gefressen, dude.“
„Ich liebe das Wort dude“, sage ich. Dude. „Und das sind nicht meine Schwestern.“
„Heißt du Gina?“, fragt er.
„Ha!“, sage ich. „Gina! Nein, ich rede von der Brünetten. Warum gehst du nicht einfach rüber und lässt, du weißt schon, deinen Zauber auf sie wirken?“
„Die Kleine?“ Sein Gesicht entspannt sich, als würde er mich wiedererkennen, einen alten Freund von ganz früher. Er boxt mir gegen den Oberarm. Er lächelt. Ich lächele. Bruder vor Luder, so sieht es plötzlich aus. „Ich stehe auf klein“, sagt er.
„Cool“, sage ich. Und auf dem Klo denke ich: Es ist wirklich cool. Es wirkt cool, und es ist cool. Schein und Sein. Heute ist Donnerstag. Donnerstag! Da bin ich, in meiner Heimatstadt, ein abenteuerlustiger Fremder mit zwei Mädchen aus New Jersey, die über Tel Aviv eingereist sind. Und nun kenne ich auch noch diesen seltsamen Typen, der aussieht wie ein Promi aus einer Fernsehserie, die ich als Einziger nie gesehen habe, und der mir als Kopilot zur Seite stehen wird. Womöglich ist er der Pilot des heutigen Abends? Natürlich ist er das. In seiner Einbildung. Es ist alles nur eine Frage der Sichtweise! Ich stehe kopfschüttelnd vor dem Waschraumspiegel und seife mir die Hände ein. So vieles im Leben – einfach nur eine Frage der Sichtweise!
Ich gehe zurück in die Bar und sehe Rachel allein am Tisch sitzen. Ich zeige auf meine Ohren, um ihr zu bedeuten, wie laut es hier ist. Sie nickt, spiegelt meine Geste.
„Wo ist Lexie?“, frage ich.
„Motorrad!“, ruft sie.
„Das ging aber schnell.“ Ich versuche, einen Blick durch die lila getönte Fensterscheibe nach draußen zu werfen, kann aber nichts erkennen.
„Du hättest sie mal in Phoenix sehen sollen“, sagt Rachel. „Es ist peinlich.“ Sie lallt ein bisschen: sispeinlich.
„Phoenix?“
„Tucson. Austin. Santa Fe.“
„Ach so“, sage ich. Tucson, Austin, Santa Fe – es klingt wie eine Zugansage. Ich versuche, guten Mutes zu bleiben.
„So machen wir das“, sagt sie. „So machen es alle Mädchen, da, wo wir herkommen.“
„Ich kenne viele Mädchen aus New Jersey. Die kamen mir gar nicht so schlimm vor.“
Sie stützt beide Ellenbogen auf den Tisch. „Und waren die auch frei?“
„Sie haben zumindest einen befreiten Eindruck gemacht.“
„Von befreit spreche ich nicht.“
Ich schaue wieder zum Fenster hinaus. „Lexie scheint frei zu sein.“
„Mein Freund, du verwechselst frei mit leicht zu haben.“
Die Jugendherberge ist eine alte Militärbaracke, kalt, zugig und hellhörig. Gelegentlich höre ich Stimmen aus dem Gemeinschaftsraum oder die einsamen Schritte eines nächtlichen Ausflüglers auf dem Weg zur Toilette. Rachel sitzt in meinem winzigen Zimmer auf der Bettkante und zerrt an ihrem Stiefel wie ein erschöpfter Landarbeiter. „Sprechende Computer“, sagt sie und schwankt im Licht der nackten Glühbirne hin und her. Auf dem Rückweg durch die Eiseskälte habe ich versucht, ihr meine Arbeit zu erklären (nur den Firmenstandort habe ich verschwiegen). Sie war angeblich interessiert, scheint aber nicht allzu viel behalten zu haben. Sie ist so betrunken, dass sie wirkt, als hätten sämtliche Knochen ihren Körper verlassen.
„Möchtest du einen Schluck Wasser?“, frage ich. Ich nehme ihren Unterschenkel in die Hand und befreie einen Fuß. Dann den anderen. Frei und leicht. Ich bin kurz davor zu sagen: Wir müssen das jetzt nicht tun, aber dann denke ich: Wieso eigentlich nicht? Was sonst sollten zwei Menschen in dieser Situation tun? Ich schiebe meine Hand unter das stramme Bündchen ihres Sweatshirts und helfe ihr beim Ausziehen, spüre das Wellenmuster ihrer Rippen. Ihr Deo riecht warm und würzig, nach Nelken. „Weiter“, sagt sie, und ich rolle ihr Top auf wie einen Fahrradschlauch.
„Bist du traurig, dass sie weg ist?“, fragt sie.
„Wer?“
„Gute Frage.“
Ich stehe auf und lege den Lichtschalter um. In der plötzlichen blauen Dunkelheit macht sich das schwache Glühen von Sausalito bemerkbar, das sich scheinbar in den Ästen der Bäume verfangen hat. Ich trete ans Fenster und lehne die Stirn an das kühle Glas. Sausalito ist nur ein kleines Städtchen auf der anderen Seite der Bucht, aber in diesem Moment sieht es aus wie ein fernes Heiligtum, eine Fata Morgana.
„Dein Computer“, sagt Rachel. „Hat der so eine komische Roboterstimme?“
„Genau genommen spricht er gar nicht. Er chattet.“
„Erzählst du ihm alles? Wirst du ihm von deiner Reise erzählen?“
„Keine Ahnung.“ Der Wind peitscht durch die Bäume, die sich wie Schilfgras wiegen. Es klingt nach tausend Klingen, die sich an tausend Wetzsteinen schärfen. Sausalito ist ausgelöscht. Ich drehe mich zu ihr um. „Was gibt es da zu erzählen?“
„Du könntest ihm sagen, dass du ein ziemlich cooles Mädchen kennengelernt hast“, sagt sie. „Das nach Kalifornien ziehen wird, um ein neues Leben anzufangen.“
„Du ziehst nach San Francisco?“
„Bolinas. Ich ziehe zu meinem Onkel und meiner Tante nach Bolinas. Und hole den Highschool-Abschluss nach.“
Der Wind verstummt wie ein abrupt zugedrehter Wasserhahn. Die Geräusche aus der Jugendherberge werden hörbar – das Murmeln der Fernseher, Gläserklirren.
„Du liebe Güte. Wie alt bist du?“
„Zwanzig. Frag bloß nicht, warum ich noch keinen Abschluss habe.“
„Zwanzig“, sage ich.
Sie lässt sich mit einem Plumps auf die Matratze zurückfallen. Die Sprungfedern quietschen. „Versprich mir, dass du es ihm erzählst. Ein ziemlich cooles Mädchen zieht nach Kalifornien. Neuanfang.“
„Neuanfang.“
„Genau.“ Sie stützt sich auf, streckt eine Hand nach mir aus, winkt mich heran. „Ich muss dir was verraten.“
„Hoffentlich darf mein Computer das auch wissen.“ Ich stoße mich vom Fensterrahmen ab. Ich nehme sie als warme, dunkle Gestalt auf dem weißen Bett wahr. Ich stehe so dicht vor ihr, dass ich sie riechen und ihr gewelltes Haar berühren kann. Sie legt den Kopf in den Nacken und betrachtet mich ernst, so als wären wir dabei, einen Pakt zu schließen.
„Zuerst musst du mir verraten, was deine Phantasie ist.“ Sie spricht mit leiser, aber fester Stimme, kein bisschen verschämt oder geniert. Ihr Körper leuchtet im Dunkeln wie eine monochrome Einheit. Die kleinen Brüste, der Ansatz einer Speckfalte in der Taille, die langen Beine, das stumpfbraune Aufblitzen ihrer Unterwäsche. Ihr Gesicht kann ich nicht sehen. Oberhalb des Halses besteht sie nur aus Schatten.
„Du kannst mir alles anvertrauen“, sage ich. Ich werde ihr Geheimnis bewahren – so etwas können Fremde füreinander tun.
„Deine Phantasie. Verrate mir deine.“
Ich beuge mich hinunter. Kein Blut rötet ihre Wangen; ihre Augen sind nicht grün. Ihr Gesicht ist weiß, schwarz, grau – eine Maske. Eine Phantasie, denke ich. Irgendeine. Nur eine Sache, von der ich träume, wenn ich allein im Bett liege, eine Berührung, nach der ich mich sehne. Was sie mit ihren Händen machen soll, mit ihrem Mund, was sie sagen soll. Irgendetwas. Ich muss mir irgendetwas einfallen lassen.
Was bedeutet es zu denken? Was ist der Mittelpunkt des Seins? Woher kommt dieses schwer zu fassende menschliche Bewusstsein? Diese Fragen zielen alle auf das Wesen des Menschseins und sind zugleich aktuelle Forschungsgegenstände auf dem Feld der künstlichen Intelligenz. Ich finde, jeder sollte über künstliche Intelligenz nachdenken. Aber – und das führt mich zur zweiten Frage – mein Arbeitsplatz in Stanford, im Herzen des Silicon Valley, hat mich in da bestimmt beeinflusst. In der IT-Branche ist künstliche Intelligenz kein Science- Fiction-Stoff sondern alltäglicher Arbeitsgegenstand.
Wie haben Sie für Ihr Buch recherchiert? Wie nah an der Wirklichkeit ist Neills Forschungsprojekt?
Entscheidend waren meine Recherchen rund um den Turing Test, der einmal im Jahr von einem sehr interessanten, exzentrischen Mann namens Hugh Loebner ausgeschrieben wird.
Ich war dort einmal Juror. Die Juroren müssen sich dort über eine Tastatur mit zwei Gesprächspartnern unterhalten, wobei der eine Gesprächspartner ein Mensch ist, der andere ein Computer. Wenn die Juroren nach der Befragung nicht klar sagen können, welcher von beiden der Computer ist, hat der Computer den Turing-Test bestanden. Der Test war erstaunlich amateurhaft, die sprechenden Computer waren eher Hobby-Projekte von Freizeit-Programmierern. Auch wenn die Programme eine geniale Mixtur aus Strategien und Tricks waren, klang keines auch nur annähernd echt. Es fehlte einfach das Bewusstsein.
Im Buch wollte ich mich nicht dem aktuellen Stand der Wissenschaft unterwerfen, aber ich habe immer versucht, der Logik realer Möglichkeiten zu folgen. Eine wirklich große Hilfe war mir auch ein Erfinder namens Rich Wallace, der AIML, eine Programmiersprache für künstliche Intelligenz erschaffen hat. Ich habe mit dieser Sprache sogar meinen eigenen sprechenden Computer programmiert.
Neills zunehmend emotionale Unterhaltung mit dem Computer wirft die Frage auf, was Menschsein und Liebe heute eigentlich bedeutet. Glauben Sie, Computer können uns eine „vorläufige Theorie der Liebe“ liefern? Sind die Menschen den Computern ähnlicher als wir dachten?
Die letzte Frage würde ich umdrehen: Computer sind eine Projektion von uns. So wie ein Auto eine erweiterte Fortbewegungsart des Menschen ist, so sind Computer erweiterte Versionen einer bestimmten olympischen Denkweise des Menschen. Die künstliche Intelligenz hat uns unter anderem gelehrt, dass wir nicht denken wie wir zu denken dachten.
Menschliche Intelligenz erfordert emotionale Intelligenz – nur so können wir uns ein Wertesystem schaffen. Computer scheitern an dieser grundlegenden Aufgabe. Ich bin überzeugt, wir haben mit den Robotern e faszinierende Jahre vor uns. Programmierer arbeiten mit Nachdruck an Robotern, die in sehr sensiblen Momenten unseres Lebens eine Rolle spielen werden. Die ersten Roboter dieser Art werden uns nicht lieben, aber vermutlich werden wir sie lieben. Das kann dann schmerzhaft für uns sein.
San Francisco spielt in Ihrem Buch eine wichtige Rolle – als Zufluchtsort für Menschen, die nach Liebe, Sex oder Selbstverwirklichung suchen. Und als Ort mit einem sehr technikliebenden, futuristischen Ambiente. Kann diese Geschichte nur dort spielen?
Ich glaube nicht, dass die Geschichte auf die gleiche Art irgendwo anders spielen könnte. San Francisco hat eine lange und meist stolze Geschichte als Stadt für Sinnsucher und Selbstverwirklicher. In dieser Suche liegt viel Menschliches, aber auch ein Eifer, der ans Komische grenzen kann. Wenn IT-ler sich auf der Straße über bahnbrechende Technologien unterhalten und dann gemeinsam im neuesten New-Age-Tempel verschwinden, dann ist das einfach typisch für San Francisco.
„Unterhaltsamer Debütroman über das Verhältnis Mensch-Technik und Liebe im digitalen Zeitalter geschrieben.“
„Sensibel und mit Humor erzählt, erweist sich seine Geschichte um Selbstfindung, Liebe und späte Vergebung nicht nur als beunruhigendes Denkmodell, sondern auch als äußerst unterhaltsame Lektüre.“
„Ein nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Forschungen im Silicon Valley höchst aktuelles Buch, das vor allem von seiner Selbstironie lebt; und ein äußerst bemerkenswertes Debüt.“
„›Eine vorläufige Theorie der Liebe‹ regt zum Nachdenken und Philosophieren an und ist dabei ausgezeichnete Unterhaltung.“
„Ein kluger, witziger Roman über das Menschsein und das Maschinesein.“
„Mit untrüglichem Auge für die Paradoxien des Lebens und angenehmem Humor führt dieser Roman vor Augen (...), was die menschliche Existenz im 21. Jahrhundert gefährdet. (...) Vielleicht wird man ›Eine vorläufige Theorie der Liebe‹ in einigen Jahren einen der definierenden Romane unseres Jahrzehnts nennen.“
„Hutchins Roman über künstliche Intelligenz ist intelligente Kunst: komisch, bitterernst und vergnüglich zu lesen.“
„Bewegend und einfühlsam.“
„Ein nachdenklich stimmender, mit einer wohltuenden Leichtigkeit geschriebener, witziger Roman.“
„Neill selbst weiß am Ende kaum noch, ob er mit einer Maschine chattet oder ob sein Vater in Form des Computers von den Toten auferstanden ist. Das ist zuweilen fast ein bisschen unheimlich.“
„Ein bezaubernder Roman, der für jeden Leser etwas zu bieten hat.“
„Dieser Roman stellt die Liebe ins Zentrum beim Versuch, das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine zu klären - denn erst die, wenn auch vorläufige, Theorie der Liebe, so Hutchins, mache aus dem Wust an Informationen aus dem Computer so etwas wie ein Wesen, mit so etwas wie einer Seele.“
„Scott Hutchins schafft es mit seiner leichten, aufgeräumten und stets ein wenig traumverhangenen Sprache das Buch wie einen Trip wirken zu lassen.“
„Das Romandebüt des Amerikaners Scott Hutchins (...) erreicht durch den ungeschönten Blick auf die emotionalen Defizite seines Helden Lebensnähe.“
„Sprachlich und in der Dynamik der Beziehungen zwischen den Personen und zwischen Personen und ›der Maschine‹ ein unterhaltsam und anregend zu lesendes Buch.“
»Mensch versus Menschlichkeit .(...) Szenarien, die allzu fern nicht wirken - die Frage bleibt: Utopie oder Dystopie?
„Warmherzig, offen, genial!“



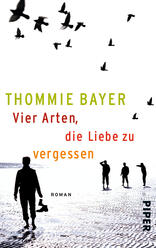




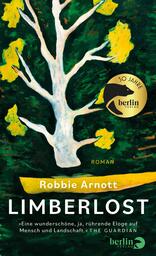
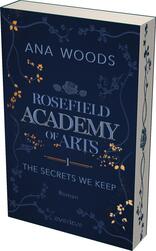





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.