
Die Sterne an unserem Himmel — Inhalt
Seit zehn Jahren hat Ravine Roy ihr Zimmer nicht mehr verlassen, denn sie leidet am Chronischen Schmerzsyndrom. Kleinste Bewegungen, Berührungen, ja sogar Geräusche bereiten ihr fürchterliche Qualen. Kein Wunder also, dass die junge Engländerin ihre Umwelt meidet. Alles hat mit einem Schicksalsschlag angefangen, der ihr auch ihre beste Freundin Marianne genommen hat. Jetzt bleiben Ravine nur noch Erinnerungen. Doch als ihre Mutter ihr zum Geburtstag ein Tagebuch schenkt, werden diese nach und nach – mit jeder Seite, die sie füllt – wieder lebendig und verleihen ihr Kraft. Und plötzlich beginnt sich ihre Welt neu zu drehen …
Leseprobe zu „Die Sterne an unserem Himmel“
Ein Sternbild wird geboren
1999
Du kamst um Mitternacht, um mich zu wecken. Weiche Finger, die an meiner Hand zogen, mich wach rüttelten. Ich rieb mir die Augen und fragte, was zum Teufel denn los sei (Ich brauchte meinen Schlaf. Ich war ein Mädchen im Wachstum). Du kichertest durch deine Zahnlücken, hieltest mir meinen Morgenmantel hin, um dann weiter an mir zu zupfen und zu ziehen, während wir meine Höhle verließen, vorbei am dröhnenden Schnarchen aus Ammas Fuchsbau, die Treppen hinunter und aus der Wohnung.
Dein Bruder stand in einem mit Blitzen [...]
Ein Sternbild wird geboren
1999
Du kamst um Mitternacht, um mich zu wecken. Weiche Finger, die an meiner Hand zogen, mich wach rüttelten. Ich rieb mir die Augen und fragte, was zum Teufel denn los sei (Ich brauchte meinen Schlaf. Ich war ein Mädchen im Wachstum). Du kichertest durch deine Zahnlücken, hieltest mir meinen Morgenmantel hin, um dann weiter an mir zu zupfen und zu ziehen, während wir meine Höhle verließen, vorbei am dröhnenden Schnarchen aus Ammas Fuchsbau, die Treppen hinunter und aus der Wohnung.
Dein Bruder stand in einem mit Blitzen bedruckten Pyjama auf der Straße. Sein strähniges Strubbelhaar passte perfekt zum Zickzackmuster. Er sah gleichzeitig verschlafen und sauer aus.
„Marianne …“, sagte ich und versuchte, eine gewisse Strenge in meine Stimme zu legen, mein Körper aber war immer noch ein einziges großes Gähnen.
Doch du legtest nur einen Finger auf die Lippen, drehtest dich um und führtest uns durch die Nacht. Unsere Füße stolperten über Betonstufen, Hände streckten sich nach Metallgeländern, die so kalt waren, dass ich schauderte.
Im vierten Stock gabst du uns ein Zeichen, dass wir uns auf unsere üblichen Plätze setzen sollten. Unsere Beine baumelten durch die Stäbe des Balkongeländers, und du schlüpftest zwischen uns und haktest dich bei uns unter. Deine Haarlocken streiften meine Wange.
Du zeigtest zum Himmel.
„Schaut mal da“, sagtest du.
Ich schaute. Und ich sah. Millionen von Sternen am indigoblauen Himmel. Ihre Helligkeit. Ihre überwältigende Zahl.
„Das da“, sagtest du und zeigtest genau nach oben, „das Sternbild des Radschlags.“
Mit einem Halbmondgrinsen legtest du den Kopf in den Nacken.
Verstohlen schob ich die Hand in die Tasche meines Morgenmantels und spürte die Kanten des Buches, das darin steckte.
„Und das da“, sagte ich und deutete auf ein zartes Sternenhäuflein, „ist das Sternbild der Taschenwörterbücher.“
Ich schaute zu Jonathan und wartete auf seinen Widerspruch.
„Nein“, sagte er. Er schüttelte so heftig den Kopf, dass ihm die Brille auf der Nase wackelte. „Das ist das Sternbild der Gewitter.“
Du sahst mich an, und ich sah dich an, ebenso übermütig wie verblüfft. Wir streckten die Arme aus und deuteten mit dem Finger in den Himmel.
„Das Sternbild des Zitronenbrausepulvers …“, sagtest du.
„Das Sternbild der Hurrikans …“, sagte dein Bruder.
„Das Sternbild des Gemüse-Dhansak …“, sagte ich.
Und wir benannten die ganze Nacht lang die Sternbilder, bis wir keine Wörter mehr benutzten, sondern nur noch ein Durcheinander von erfundenen Klängen. Ich spürte deinen Körper neben mir, er wärmte mich wie eine Decke. Als ich zum Horizont blickte, sah ich eine Sternschnuppe. Ein zuckendes Licht schoss durch die samtige Nacht.
Vielleicht habe ich aber auch gar keine gesehen. Vielleicht war es nur das, was ich sehen wollte.
Das Sternbild des Bettes
2010
Ich wache auf und stelle fest, dass in der Nacht irgendjemand wie ein Ninja in mein Zimmer eingedrungen sein muss. An der Decke baumeln Luftschlangen, in den Zimmerecken sind Luftballontrauben befestigt, und ein riesiges glitzerndes Transparent hängt schief an der Wand. Darunter wurden ein Dutzend Fotos gepinnt. Es sieht aus wie eine Zeitleiste in einem Museum, nur billig gemacht.
Foto 1: 1992 – Geburt von Ravine (schrumpeliges Neugeborenes mit zu viel Haar)
Foto 3: 1996 – Krippenspiel (als Schaf verkleidetes Mädchen, Strohhalme hängen aus dem Mund)
Foto 8: 2009 – Silvester (Teenager liegt im Bett, ein keck aufgesetztes Papierhütchen auf dem Kopf)
Wenn es eine Auszeichnung für den schlechtesten Zuhörer der Welt gäbe, würde meine Mutter diesen Preis konkurrenzlos gewinnen. Sag ihr einen stinknormalen Satz, und schon kannst du dabei zusehen, wie die Zahnrädchen in ihrem Hirn die Worte auseinanderzerren und verdrehen und am Ende einen völlig anderen Sinn ausspucken. Du sagst, du willst ein Kätzchen – sie kauft dir einen Mantel. Du sagst, du magst keinen Kohl – sie kocht sieben verschiedene Kohlgerichte. Du sagst, du willst keine Party, und schon wachst du in einem Zimmer auf, bei dessen Anblick dir dermaßen der Schweiß ausbricht, dass dir der Schlafanzug an der Haut klebt und du einen Blick in die Unterhose werfen musst, um dich zu vergewissern, dass du nicht hineingepinkelt hast.
Ich reibe mir die Augen. Der Geruch von Zwiebel-Bhajis aus der Küche zieht herein. Er mischt sich mit dem Geruch von Lufterfrischer Marke Zitrusbrise. Ich hoffe, dass das alles nur ein böser Traum ist. Doch als ich mich halb aufrichte, bestätigen es mir die schmerzenden Muskeln in meinem Arm: Das hier ist echt.
„Du bist wach!“, ruft Amma. Mit einem Kuchen von der Größe eines Beistelltischs kommt sie zur Tür hereingewackelt.
Sie trägt einen orangen Sari mit einer Falte genau in der Mitte und hat sich etwa fünf Liter Kokosöl ins Haar gekämmt. Gekonnt lehnt sie sich zur Seite und tritt mit dem Absatz auf die Play-Taste an meiner Anlage. Die elektronischen Beats erbrechen sich ins Zimmer. Sie grinst mich an, als wäre das alles das Finale einer tollen Show und ich müsste nun endlich applaudieren.
Ich ziehe mein Kissen hinter mir hoch und sinke zurück.
„Amma …“, setze ich an.
Sie legt den Kopf schräg, um dem Song zu lauschen. Ich sehe, wie sie im Takt mit nickt. Die Musik spielt, der Kuchen kommt ins Rutschen.
„Amma!“, rufe ich.
„Moment, Moment!“, sagt sie und hält die Kuchenplatte wieder waagrecht.
Die Becken schlagen über den Trommeln zusammen, und Stevie Wonder hebt an zum Refrain.
„… Happy biiiiiiiirthday!“
Ich warte, bis es vorbei ist. Dann wackelt Amma auf mich zu und platziert den Schokoladengrabstein auf meinem Schoß.
„Für den habe ich drei Tage gebraucht“, sagt sie.
Den Kuchen mit der braunen Glasur und der Garnitur aus Plastikrosen ziert eine Reihe schon mal benutzter Kerzen. In der Mitte steht in rosa Zuckerguss-Schnörkelschrift geschrieben: „Alles Gute zum 18. Geburtstag, Ravine Roy!!!“ Die Buchstaben werden immer kleiner, je weiter es auf meinen Namen zugeht, aber irgendwie ist es Amma gelungen, doch noch einen Smiley hinter die Ausrufezeichen zu quetschen.
Meine Wirbelsäule krümmt sich wie ein Schössling, der vom Wind geknickt wurde, was Amma als Zeichen ehrfürchtigen Staunens interpretiert.
„Gern geschehen!“, sagt sie und wedelt mit der Hand in der Luft herum. „Für meinen Schatz Ravine würde ich alles tun!“
Erst letzte Woche hatte ich eigentlich klargestellt: keine Luftballons, keinen Kuchen, keine Party. Aber irgendwie hat Ammas Hirn meine Worte mal wieder verhackstückt, und herausgekommen sind so viele Ballons, wie sie nur aufblasen konnte, der größte Kuchen, den sie backen konnte, und so viele Partyartikel, wie sie nur in mein Zimmer stopfen konnte.
Jetzt zündet Amma die Kerzen an. Weil es so viele sind, nimmt das Manöver gut zwei Minuten in Anspruch. Als sie das vierte Streichholz anreißt, ist mein Gesicht schon ganz feucht, und das Pochen in meinen Gliedern so stark, dass es mir den Blick vernebelt. Ich hole tief Luft, um den Monsterkuchen ins nächste Haus zu pusten, doch sowie die letzte Kerze angesteckt ist, klatscht Amma sich auf den Oberschenkel und stimmt „Happy Birthday“ auf Bengali an.
Amma hat mir schon Lieder auf Bengali vorgesungen, als ich noch in ihrem Bauch war. Um mir heimlich, still und leise ihre Sprache unterzujubeln. Als ich noch ein kleiner Hosenmatz war, übersetzte sie jeden Abzählreim und änderte alle Tiernamen, aber baa baa kala chaagal klingt eben einfach nicht so schmissig wie „Mäh, mäh, schwarzes Schaf“. Beim Schlafengehen sang sie mir Volkslieder von Booten und Reisfeldern vor, bis ich ohne sie nicht mehr einschlafen konnte. Ich rebellierte gegen die musikalische Gehirnwäsche, indem ich die Bedeutung sämtlicher Bengali-Wörter ausblendete. Heute kann ich die komplette Nationalhymne von Bangladesch herunterleiern, ohne dass ich einen Schimmer davon hätte, was ich da eigentlich singe. Das einzige Bengali-Wort, das ich wirklich benutze, ist „amma“, und das heißt „Mutter“.
Ich blase die Backen auf und befürchte, dass entweder ich ohnmächtig werde oder Ammas Sari Feuer fängt, dann puste ich die Kerzen aus. Mitten im Lied hält sie inne.
„Du hast dir doch was gewünscht, oder?“, fragt sie.
Kleine Rauchspiralen kringeln sich um meinen Körper. Ich schließe die Augen und räuspere mich.
„Ich wünsche mir keine weiteren Feierlichkeiten.“
Erwartungsvoll öffne ich die Augen. Amma runzelt die Stirn und schüttelt den Kopf. „Wenn du ihn laut aussprichst, geht er nicht in Erfüllung“, sagt sie. „Das weiß doch jeder, Ravine.“
Und natürlich behält sie recht.
Im Verlauf der nächsten halben Stunde strömen lauter Nachbarn in mein Zimmer. Ein paar kenne ich persönlich (Sandy Burke und ihre Zwillinge), andere nur vom Sehen (Mrs Patterson und ihre berühmten Riesenbrüste), ein paar von ihnen bin ich noch nie in meinem Leben begegnet.
Erstere sagen Hallo, die, die ich vom Sehen kenne, gratulieren mir mit schmerzverzerrt-gekünsteltem Lächeln. Die, denen ich noch nie in meinem Leben begegnet bin, begaffen staunend meine Shiva-Statuette, den Stapel ungelesener Bücher auf dem Boden und die altmodische CD-Sammlung neben der Anlage. Die ganze Zeit über hoffe ich, dass ihnen die Foto-Zeitleiste an der Wand nicht auffällt oder die My-Little-Pony-Vorhänge, aber gerade darauf starren sie am meisten. Ich warte darauf, dass Amma ein missbilligendes Zungenschnalzen hören lässt, damit sie aufhören. Aber sie wuselt nur durch die Menge, berührt die Hände eines jeden Gastes und bedankt sich mit kleinen Verbeugungen, die eines Maharadschas würdig wären.
Mir ist klar, was sie gemacht hat. Amma, diese clevere Frau, hat persönlich an jede Wohnungstür von Westhill Estate geklopft und die Bewohner mit der Aussicht auf kostenlosen Kuchen geködert. Sie hat ihnen kleine Bröckchen zum Kosten gegeben, gerade so viel, dass ihnen das Wasser im Mund zusammenlief. Und dann hat sie im Gehen gerufen: „Den gibt’s erst wieder auf der Party. Kommen Sie auf jeden Fall vorbei!“
Amma bahnt sich einen Weg zu meinem Bett. Ich mache den Mund auf, doch bevor ich ein Wort sagen kann, hat sie sich schon zu ihrer Armee umgedreht. Mit dem Lächeln eines wahnsinnigen Diktators klatscht sie zweimal in die Hände, als wollte sie einen Flamenco tanzen. Unsere Gäste reißen sich vom Bombay-Mix los, der Small Talk bricht ab, und Stevie Wonder wird leiser gedreht. Das Bett sinkt etwas ein, als sich Sandy Burke ans Fußende setzt. Sie futtert sich gerade durch eine Schachtel mit Mini-Schokoriegeln. Früher war sie das reinste Skelett, die Beckenknochen stachen unter ihrer Jeans hervor wie Zeltstangen, und ganz oben thronte ihr Zuckerwatte-Afro. Selbst der Gevatter Tod, den sie sich auf den Hals hatte tätowieren lassen, sah gesünder aus als sie. Jetzt haben ihr Gesicht und ihr Hals fleischig-weiche Konturen. Ihre Arme sind keine Streichhölzer mehr, sondern wohlgerundet.
Als sie mir die Schachtel hinhält, schüttle ich den Kopf.
„Ich freue mich so, Sie alle zu sehen!“, sagt Amma (als wäre es ein Zufall, als hätte sie das nicht alles so geplant).
Sie legt mir die Hand auf die Schulter. Es ist meine schlimme Schulter, deswegen berührt sie mich nur ganz sanft.
„Heute ist mein Schatz Ravine achtzehn Jahre alt geworden.“
Ich krümme mich.
„Das ist wichtig, denn damit beginnt ihr erwachsenes Leben.“
Wieder krümme ich mich.
„Außerdem ist es wichtig, weil damit ihr Leben außerhalb dieser Wohnung beginnt. Stimmt’s, Shona, mein Liebling?“
Ich komme nicht dazu, mich zu krümmen, weil sie mit diesen dunklen Kulleraugen auf mich herunterschaut, mit denen sie einem Welpen Konkurrenz machen könnte. Wenn sie einen so anschaut, macht man alles Mögliche, diese Augen ringen einem Versprechen ab. Das geht sogar so weit, dass man glaubt, man könnte sie halten.
Es entsteht eine Pause, offenbar wird von mir erwartet, dass ich etwas sage. Meine Muskeln sind angespannt wie Drahtseile. Ich fahre mir mit der Zunge über die Lippen.
„Stimmt“, sage ich.
Amma tätschelt mir den Kopf, um zu signalisieren, dass das die richtige Antwort war. Sie faltet die Hände.
„So, und jetzt wollen wir endlich Kuchen essen!“
Die Menge jubelt, als sie den Kuchen in viereckige Stücke schneidet. In der Zimmerecke stehen Sandy Burkes Zwillinge und starren mich an. Ihre identisch geformten Köpfe sind im gleichen Winkel zur Seite geneigt, verwirrte Linien graben sich in ihre Stirnen, schwarze, gewellte Haare rahmen ihre Gesichter. Sie sind erst elf, aber mit diesem Gesichtsausdruck sehen sie aus wie Wissenschaftler, die überlegen, ob sie gerade ein neues Virus entdeckt haben. Ich umklammere eine Ecke meiner Bettdecke, lausche auf Stevie Wonders Worte, lese die Schrift auf den Transparenten, nehme wahr, wie sich mein Zimmer mit lächelnden Gesichtern füllt.
HAPPY BIRTHDAY!! HAPPY BIRTHDAY!!
HAPPY!! HAPPY!! HAPPY!!
„Ich werde jetzt schlafen!“
Die Worte schießen mir wie Gewehrkugeln aus der Kehle. Ich grabe die Finger in die Bettdecke und ziehe so fest daran, dass Sandy Burke vom Bett aufspringt. Amma schaut mich an, das Bindi auf ihrer Stirn ist nach oben gerutscht.
„Aber Shona – es ist halb elf am Vormittag.“
Ich lege mich flach hin. „Danke fürs Kommen!“
Es wird ganz still im Zimmer. Erst als ich leise Schnarchgeräusche von mir gebe, setzen sie sich in Bewegung. Sie nehmen ihre Kuchenstücke und wandern ins Wohnzimmer. Als der letzte Gast gegangen ist, seufzt mein ganzer Körper auf. Auch Shiva und My Little Ponys auf den Vorhängen sehen erleichtert aus.
Amma sucht nach meinen Schmerzmitteln, stellt mir behutsam ein kleines Fläschchen auf den Nachttisch.
„Alles Gute zum Geburtstag, Ravine“, sagt sie und drückt mir einen nassen Kuss aufs Ohrläppchen.
Aus halb geöffneten Augen beobachte ich, wie sie ein Stück Kuchen neben das Fläschchen stellt und das restliche Essen auf einem Tablett sammelt, bevor sie aus dem Zimmer schleicht.
Ich ziehe die Knie bis an die Brust. Während die Party unten weitergeht, bleibe ich so liegen und gare langsam im Sud meines Elends.
Manche Leute haben ein Sterbebett. Ich habe ein Lebebett.
Wie wenn man eine Erkältung hat. Ich meine nicht das Hä-tä-täm-Kratzen im Hals, bei dem man ein paar Schmerzmittel einschmeißt und nach achtundvierzig Stunden wieder fit ist. Nein. Das hier fühlt sich an wie eine alles verzehrende Erkältung. Verschwommener Blick, schwere Glieder, das Gefühl, dass einem das Hirn gleich zu den Nasenlöchern hinausläuft, und dazu springt einem ein Pandabär auf den Muskeln herum.
Man schleift sich in die Schule oder auf die Arbeit oder wo auch immer man an dem Tag hinmuss. Ein paar Stunden ist man ein bisschen produktiv, bevor die Schulglocke klingelt, die Uhr fünf schlägt oder man in den Bus oder ins Auto steigt und sich wieder zurück nach Hause schleppt. Und dann heißt es nur noch: Tür zuknallen. Mantel fallen lassen. Treppe hochkriechen. Bett.
Im Bett ist es sicher. Im Bett ist es warm. Im Bett fragt dich niemand, welches Datum wir haben oder wie man einen Algorithmus löst. Du sinkst ein in die Matratze. Du legst den Kopf auf das Kissen aus Memory-Foam. Jeder Teil an dir seufzt – sogar Augäpfel und Eingeweide. In einem fernen Land klingelt es an der Tür, aber du hörst es nicht, weil du schon die Segel gesetzt hast. Im Reich der Alles-verzehrenden-Erkältung ist das hier der Zustand, der am nächsten an absolute Wonne heranreicht.
Und jetzt stell dir noch das vor: Deine Erkältung ist keine Erkältung, sondern ein Chronisches Schmerzsyndrom. Eine Krankheit, bei der der Großteil deines Körpers unablässig von Schmerzen gepiesackt wird, es ist die Art von Schmerzen, die man fühlen würde, wenn einem Killerhaie die Muskeln durchbeißen würden. Stell dir vor, wie du dich fast elf Jahre lang jeden Tag auf dein Bett sinken lässt. Dann wachst du auf. Du gehst zur Toilette. Du fällst wieder auf dein Bett und segelst davon. Nur dass du eben nirgendwohin segeln kannst, weil irgendein Wichser dich an einem Poller vertäut hat. Du schaukelst auf einem Ozean aus Schmerz und hoffst, dass jemand kommt und das Seil in Stücke hackt und dich befreit. Kommt aber keiner.
Also ja, ich habe ein Lebebett. Es hört sich wahrscheinlich an wie Sterbebett, ist es aber nicht. Ich werde mein ganzes Leben im Bett verbringen, deswegen ist es mein Lebebett.
Zusammengerollt liege ich da, mit pochenden Muskeln, und versuche, die Fotos an der Wand nicht anzuschauen oder das Kuchenstück, das Amma mir dagelassen hat. Unten höre ich Stimmengewirr, und alle paar Minuten quäkt eine Partytröte los, begleitet von wieherndem Gelächter. Mit der Zeit verebbt aber auch das Lachen. Die Gäste verabschieden sich, bis irgendwann nur noch ein Geräusch zu hören ist, nämlich das Zischen der Zitrusbrise, die auf dem Flur versprüht wird. Als es aufhört, erscheint Amma mit einem Armvoll Geschenke an meiner Tür.
„Ist das nicht toll gelaufen?“, sagt sie und lässt eine ganze Wagenladung auf mein Bett und sich auf ihren Stuhl fallen. Sie grinst breit. „Ich würde sogar behaupten, es ist grandios gelaufen.“
Ich stopfe mir das Kissen in den Rücken, und die Geschenke purzeln von meinen Beinen. Dann wische ich mir die Haare aus dem Gesicht.
„Ich wollte keine Party“, sage ich.
Amma schlägt im Scherz mit der Hand nach mir. „Gern geschehen.“
Ich seufze und schaue auf die Tapete mit dem Endlosmuster neben mir. Die Vögel darauf haben den Hals zurückgebogen und die Flügel gespreizt, als wollten sie jeden Moment fliehen. Ich hasste die Vögel schon, als Amma das Wohnzimmer damit tapezierte, und ich hasste sie noch mehr, als sie die übrig gebliebenen Rollen für mein Zimmer verwendete. Die scharfen Schnäbel und die Knopfaugen verursachen mir Albträume, aber als ich es Amma sagte, gackerte sie nur, als hätte ich ihr einen netten Witz erzählt.
„Mach deine Geschenke auf, mein Schatz“, sagt Amma.
Ich starre die Vögel an.
„Ravine.“
Wenn Amma diesen ganz bestimmten Ton anschlägt, ist es besser, man tut, was sie will.
Ich halte den Blick gesenkt und reiße die Geschenke eines nach dem anderen auf: ein Blumenarmband, für das ich keine Verwendung habe, ein Paar mit Strass verzierte Pantoffeln, mit denen ich meinen Toilettenbesuchen neuen Glanz verleihen kann, ein stoffbezogenes Tagebuch mit einem Stift, der ebenfalls mit Glitzersteinchen überzogen ist.
Ich rolle den Stift zwischen den Fingern, spüre das Stechen meiner zerfaserten Nerven im Handgelenk. Manchmal ist der Schmerz stark und pochend, als würde jemand immer wieder auf mich einschlagen, dann wieder ist er schnell und scharf. Als die kleinen Steinchen im Licht aufleuchten, entflammt auch der Schmerz in meinem Handgelenk.
„Worüber soll ich denn schreiben?“, frage ich.
Amma nickt, als wäre das eine sehr kluge Frage.
„Über deinen Schmerz“, sagt sie. „Laut einigen Studien hilft es, seelische Schmerzen zu heilen, wenn man über die körperlichen schreibt.“
Ich verziehe die Oberlippe. „Das ist mit das Dümmste, was ich in meinem Leben je gehört habe“, erwidere ich.
„Außerdem“, fährt Amma fort, „ist es eine gute Vorbereitung für die Zeit, wenn du diese Wohnung verlässt. So kannst du deine Fortschritte festhalten.“
Sie klopft mit den Fingern auf das Tagebuch, dann steht sie auf und klaubt summend die Geschenkpapierreste von meinem Bett. Der Schmerz wird schlimmer, die Elektroschocks in meinem Handgelenk zucken so wild, dass meine Muskeln sich verkrampfen. Ich lasse den Stift fallen und versuche, mich durch den Schmerz zu atmen, wie es mir mein Physiotherapeut beigebracht hat.
Vergiss nie das Atmen, hat er gesagt. Menschen mit chronischen Schmerzen verkrampfen alle Muskeln und vergessen, sich zu entspannen.
Ich entspanne mich. Die Krämpfe lassen nach. Aber meine Finger zittern immer noch leicht, ein elektrisches Gefühl sirrt durch meine Nerven.
„Amma“, sage ich, „dieses Gerede, dass ich die Wohnung verlasse …“
„Ist das nicht großartig?“, sagt sie.
Sie sammelt Papier auf.
Ich schüttle den Kopf. „Es ist noch nicht passiert.“
Amma richtet sich auf und drückt sich das zusammengeknüllte Papier an die Brust, als wäre es ein fettes, kunterbuntes Baby. „Aber es wird passieren. Du hast es mir versprochen.“
Sie sieht mir in die Augen, dann nimmt sie das Papier und stopft es in den Abfalleimer. Ich höre, wie es sich knisternd ineinanderschiebt.
„Amma“, sage ich. „Die Schmerzen …“
Als sie sich umdreht und mich anschaut, sehe ich neuen Tatendrang in ihren Augen aufflackern.
„Wir werden es ganz langsam angehen. Die Treppen rauf und runter, immer ein paar Stufen auf einmal. Und auf dem Balkon sitzen, damit du dich an die Luft gewöhnst.“
„Aber warum sollte ich mich …“
„Dann gehen wir in den Park. Wir füttern die Enten.“
„Ich mag keine E…“
„Schon bald wirst du in der Lage sein, alleine rauszugehen. Wie der Arzt gesagt hat: Ein wenig körperliche Bewegung und ein gesundes Sozialleben werden deine Laune heben.“
Die Vögel auf der Tapete krächzen laut auf und schlagen mit den Flügeln, während die Wände um mich herum einstürzen. Eine glühende Sonne trifft meinen Körper mit voller Wucht, ein Wind bläst mir Blätter ins Gesicht, bevor er mich in einen Hurrikan saugt, der mich in den Himmel emporwirbelt.
Ich verdrehe die Augen. „Meine Laune ist bestens“, sage ich.
Amma zählt die Symptome auf, die darauf hindeuten, dass dem nicht so ist:
● Verlust von Interesse an Alltagsaktivitäten
● Vermeiden von Kontakt mit anderen Menschen
● Gereiztheit und Ärger
● Widerwillen, über Gefühle zu reden
Sie drückt ihr Kinn auf den Hals.
„Wir wissen doch alle, wie es bei dir mit dem Reden über Gefühle aussieht, oder nicht?“
Ich lege mich flach auf den Rücken. Mich dazu zu bringen, über meine Gefühle zu reden, ist Ammas allerhöchste Mission. Sie hat versucht, mich zu einem Gespräch mit einem Arzt zu überreden, und mit einem Therapeuten. Sie hat versucht, mich in eine Selbsthilfegruppe zu schicken, und hat sogar versucht, mich dazu zu bringen, mit ihr zu reden. Aber der Arzt war mir zu kalt, der Therapeut zu soft, die Selbsthilfegruppe löste in mir den Drang aus, aus dem Fenster zu springen. Und mit Amma zu reden, kommt einer Konversation mit einer außerirdischen Spezies gleich.
Es ist ein simples Problem. Niemand kann mein Leben verstehen, weil keiner es gelebt hat.
Außer dir vielleicht.
„Schreib gleich heute Abend was in dein Schmerztagebuch“, sagt Amma jetzt.
Schmerztagebuch. Allein das Wort verursacht mir Übelkeit. Ich atme langsam aus und warte, bis mein Körper von selbst wieder Luft holt. Das ist ein Trick, den mir der Physiotherapeut gezeigt hat: eine Möglichkeit, mein Gehirn vom Schmerz abzulenken.
„Wirst du es zumindest versuchen?“ Ammas Stimme ist sanft, hoffnungsvoll.
Mein Brustkorb weitet sich. Ich atme wieder aus.
„Natürlich“, sage ich.
Dann warte ich, bis ich ihre Füße auf der Treppe höre, setze mich auf, schlucke die Schmerztabletten und starre die Wand an. Noch immer hängt dort die Zeitleiste. Die Babyfotos, die Teenagerfotos und da, in der Mitte, das Bild, das uns an meinem siebten Geburtstag zeigt.
Das war mal mein Lieblingsfoto. Bevor du verschwunden bist, hatte ich es auf meinem Nachttisch stehen, in einem Rahmen, den ich aus der Pappe von Cornflakes-Packungen und aus Bonbonpapierchen gebastelt hatte. Die Papierchen lösten sich ständig wieder ab, sodass ich immer ein paar Süßigkeiten essen musste, wollte ich den Rahmen reparieren.
Auf dem Foto drücken wir die Wangen aneinander. Wir tragen absurde Partykleider, die wir anzogen, wann immer wir einen guten Vorwand fanden. Amma hatte sie im Winterschlussverkauf besorgt: zwei pfirsichfarbene Gewänder mit Bändern, Glitzer und so viel Rüschen, dass wir aussahen, als wären wir aus Schlagsahne. Du hast deinen sonnengebräunten Arm um meinen braunen Hals geschlungen, und dein Gummilächeln zieht dein Gesicht in die Breite wie einen Rugbyball. Dein dichter Lockenkopf wird an meiner Wange platt gedrückt, derweil blinzle ich mit einem Zahnlückengrinsen in die Kamera.
Als ich das Foto so anschaue, fällt mir wieder ein, dass nach dieser Aufnahme die Bänder so ineinander verknotet waren, dass wir den Rest des Nachmittags herumhüpften und so taten, als wären wir siamesische Zwillinge.
Die Erinnerung ist wie eine Münze, auf die man in der Hosentasche stößt – sie war die ganze Zeit da, aber sie wiederzufinden ist eine freudige Überraschung. Ich liege auf dem Rücken und stöbere in meinem Kopf nach weiteren Erinnerungen. Ich schaue an die Decke mit den Rissen in der Farbe und sehe Bilder unseres Lebens darüber hinwegflackern: wie du mit Zweigen im Haar von Bäumen herunterkletterst, wie wir die Geländer im Wohnblock hinunterrutschen. Ich sehe aufblitzende Bilder von Neunzigerjahre-Erinnerungsstücken: gebatikte T-Shirts, eine Jagged-Little-Pill-CD, den Commodore 64, der deinem Bruder gehörte, obwohl er sich eigentlich einen Sega Mega Drive gewünscht hat. Und dann die Szene, als deine Mutter beschloss wegzugehen. Wie wir auf dem Teppich vor eurem Fernseher sitzen und so tun, als würden wir Schach spielen (obwohl wir beide es nicht konnten), Jonathan im Hintergrund, der wegen irgendwas beleidigt spielt, und deine Mutter am Esstisch, die den Kopf in die Hände stützt.
Ich spüre das Gewicht des Tagebuchs auf meinem Schoß. Es fühlt sich so schwer an wie die Ziegel der Wände um mich herum. Meine Augen stechen, und es schnürt mir jäh die Kehle zusammen, als ich die Hand hebe, um das Buch quer durchs Zimmer zu schleudern. Doch irgendetwas, ein winziges Samenkörnchen eines Gedankens, lässt mich innehalten. Die Straßenlaternen verbreiten ihr honigfarbenes Licht, das helle Strahlen eines Autoscheinwerfers gleitet über die Wände, während der Gedanke in mir wächst und aufblüht. Ich nehme den glitzersteinbesetzten Stift vom Nachttisch und umklammere ihn ganz fest.
Vielleicht sollte ich das alles aufschreiben. All die Dinge, die uns passiert sind, so wie ich mich an sie erinnere. Und auch das Leben, das ich jetzt führe. Ich könnte das alles dokumentieren, und dann würde ich es vielleicht verstehen. Und du, Marianne, du würdest es auch verstehen.
Als ich diesen Gedanken denke, geschieht etwas Erstaunliches. Du würdest es nicht für möglich halten.
Ich lächle.
Allein schon bei dem Gedanken.




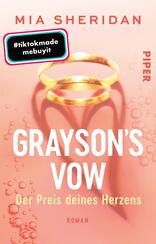





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.