

Die Frauen von Ithaka
Roman
„Marais Fortschreibung der Odyssee ist ein grandioses Buch. (...) Ein ebenso kurzweiliges, wie erhellendes Buch, mit dem er dem klassischen Stoff sein außerordentlich lesenswertes, psychologisch fein ausgelotetes Update gab.“ - Sächsiche Zeitung
Die Frauen von Ithaka — Inhalt
Odysseus, der Herrliche, der Listenreiche, der Held des Trojanischen Kriegs, kehrt nach zwanzigjähriger Irrfahrt heim nach Ithaka. Doch niemand hat ihn vermisst. Als der Heimkehrer dann auch noch die 180 Freier seiner Frau Penelope erschlägt, ist es mit der friedlichen Familienzusammenführung endgültig vorbei. Spitzzüngig und kurzweilig erzählt Sándor Márai die private Familiengeschichte des vermeintlichen antiken Superstars.
Leseprobe zu „Die Frauen von Ithaka“
Vorgesang
Rechts am Arm das Seil gelockert. Er streckte sich.
Aus der Nähe
kam der Gesang. Er horchte. Jetzt merkte er:
Sie sangen da, die Sirenen.
Heiser, lüstern und verführerisch. Seine Gefährten schliefen.
Wachs klebte in ihren Ohren. Sie träumten. Dass sie heimkehrten,
und dass die Jungen oder die Alten Rache nähmen!
Er stöhnte auf, ohnmächtig. Na, wo bist du jetzt, Pallas Athene?
Wasser klatschte ans Floß, das graue Meer sperrte den schrecklichen Schlund auf.
Das Lied verklang in der Ferne. Die Segel kreischten laut.
Plötzlich kam die Angst. Arme und Beine [...]
Vorgesang
Rechts am Arm das Seil gelockert. Er streckte sich.
Aus der Nähe
kam der Gesang. Er horchte. Jetzt merkte er:
Sie sangen da, die Sirenen.
Heiser, lüstern und verführerisch. Seine Gefährten schliefen.
Wachs klebte in ihren Ohren. Sie träumten. Dass sie heimkehrten,
und dass die Jungen oder die Alten Rache nähmen!
Er stöhnte auf, ohnmächtig. Na, wo bist du jetzt, Pallas Athene?
Wasser klatschte ans Floß, das graue Meer sperrte den schrecklichen Schlund auf.
Das Lied verklang in der Ferne. Die Segel kreischten laut.
Plötzlich kam die Angst. Arme und Beine gaben nach –
Er stöhnte auf. Und fürchtete, er käme heim nach
Ithaka.
Erster Gesang
Penelope
I
Mein seliger Mann war ein ruheloser Mensch. Am liebsten war er auf Reisen.
Doch selbst wenn er nicht unterwegs war, wenn er sich bei uns in Ithaka aufhielt, wenn er in meinem Bett lag und mich in den Armen hielt: Immer hatte ich das Gefühl, an Deck eines Schiffes zu sein oder auf einem langsam schwimmenden Floß. Das lässt sich schwer erklären. Wer mit ihm lebte, begab sich ebenfalls auf eine Reise, langsam und ausdauernd. Es war schwer, sich ihm zu nähern, weil er ständig dabei war, sich zu entfernen. An seiner Haut haftete der Geruch des Meeres.
Über das, was uns widerfahren ist, über die Geschichte unserer Familie, sind in der Welt leider schon zu viele Worte verloren worden. In letzter Zeit wurde ich mehrfach gebeten, die Wahrheit zu sagen und meine Erinnerungen niederzuschreiben. All diese Bitten habe ich abgeschlagen. Nicht nur, weil ich derartige Eröffnungen für unter meiner Würde halte. Ich habe die Neugierigen eher deswegen abgewiesen, weil zu unserer Zeit – ich denke hier an die Zeit, als ich in der Gesellschaft meines Mannes lebte – das Schreiben noch eine außerordentlich gewöhnliche, niedere Beschäftigung war. Damals, als mein Mann und ich noch Menschen waren – genauer gesagt, als wir für kurze Zeit wieder einmal Menschen waren –, schrieben die vornehmeren Leute nicht. Wenn sie der Welt etwas zu sagen hatten, griffen sie zur Leier und sangen. Die Dichter und alle, die sich mit Worten ausdrücken konnten, verachteten das Schreiben, diese Sklavenarbeit, zutiefst. Sie schritten vielmehr im Wind dahin, die Leier in der Hand, und sangen dazu. Mein Mann mochte dieses fünfsaitige Instrument, und wir hielten in unserem Haus immer einen Sänger, der die Erlebnisse der Achäer in metrischen Versen vortrug. Dieser Mann wurde gesondert gespeist, und sogar Wein mischte man ihm in den silbernen Becher, dass er Lust zum Singen bekomme. Mein Mann förderte die Literatur.
Ich erinnere mich noch an einen dieser Sänger, der längere Zeit in unserem Haus verweilte und sich dann später, als sich alles so schmerzlich und aufregend veränderte, auf den Weg machte und überall auf den Inseln seine Verse vortrug. Dieser Mann war blind. Noch heute sehe ich manchmal undeutlich sein Gesicht vor mir. Dünn war er und alt, und seine blinden Augen vermochten bisweilen den Eindruck zu erwecken, als sähe er tatsächlich etwas. Später habe ich mich viel über ihn geärgert. Die Geschichte, die er vortrug, war ungenau. Er sang alles Mögliche, so gut es ein Blinder eben kann, der die Wahrheit nur ahnt und sie nicht weiß. Die Wahrheit weiß nur ich, die ich im Bett meines Mannes gelegen und dann zwanzig Jahre lang auf ihn gewartet habe.
Aber das Schreiben will ich nicht mehr lernen. Dafür bin ich zu alt, selbst wenn ich unsterblich, also ewig jung bin. Lieber erzähle ich, was ich weiß. Ich erzähle es langsam, so wie er manchmal sprach, wenn er sich – im Winter – mit uns an den dreibeinigen eisernen Glutkorb setzte und zu erzählen begann. Manchmal höre ich noch seine Stimme. Sie klang wie das Rauschen des Meeres.
II
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Jetzt, da die Erinnerungen auf mich einstürmen, spüre ich ein Herzklopfen, als wäre all das, was ich zu sagen habe, zu viel, unfassbar, unendlich wie die See. Denn immer, wenn ich an meinen seligen Mann denke, erinnert mich alles an das Meer. An Land war er immer nur zu Gast. Aber auf dem Meer fühlte er sich zu Hause, und wenn er auf ein Schiff stieg, glänzten seine Augen. In Ithaka habe ich ihn nie mit so leuchtenden Augen gesehen, wie wenn er vom Schiff aus uns, den Daheimbleibenden, zum Abschied winkte.
Vielleicht hasste ihn Poseidon auch deswegen. Er war eifersüchtig auf ihn. Darüber weiß nur ich Bescheid. Alles, was später geredet wurde, was der Schwätzer Teiresias am Tor zum Hades den Wanderern erzählt, ist erfunden und erlogen. Poseidon hasste meinen Mann nicht deswegen, weil der Polyphem seinen verkrüppelten, einäugigen Sohn getötet hat, dieses stotternde Rindvieh. In unseren Kreisen ist ein Mord ohnehin keine große Sache. In unserer Welt werden Leben und Tod anders gemessen als in der Menschenwelt: Wir, die wir Menschen und Götter zugleich sind, wissen, dass der Tod nur ein Missverständnis ist. Nein, Poseidon hasste meinen Mann, weil er auf ihn eifersüchtig war: Beide waren Götter, denn bevor die Griechen, die ich nicht leiden kann, in Arkadien und Böotien, der eigentlichen Heimat meines Mannes, einwanderten, gab es eine Zeit, in der das arkadische Volk meinen Mann als Gott verehrte. Der Gott des Meeres war er, lange. Später wurde er von den Griechen, diesem dahergelaufenen Gesindel, vertrieben, zusammen mit den anderen alten arkadischen Göttern. Degradiert wurde er, sie machten einen einfachen Helden aus ihm. Einen Helden, aus meinem Mann! Ich weiß, wovon ich rede, weil meine Vorfahren ebenfalls aus Arkadien stammen und göttlichen Ursprungs sind. Mein Vater Ikarios wanderte von dort nach Sparta aus. Hätte er das nur niemals getan! Aber vielleicht war auch dies der Wille der Götter, seiner mächtigen Verwandten!
Doch immer der Reihe nach. Wenn ich von ihm spreche, fühle ich mich immer noch wie eine irdische Frau in den Wechseljahren, deren Blut bisweilen jäh in Wallung gerät. Alles war wunderbar an ihm – wunderbar und zugleich verdächtig. Ja, in Arkadien war er noch ein Gott, der Gott des Meeres. Doch unter den Göttern ist die Eifersucht groß. Pallas Athene, die mich manchmal hier auf der Insel Aiaia besucht – sie ist eine alte Freundin unseres Hauses, und bei etwas Ambrosia und einer Tasse Nektar unterhalten wir uns stundenlang über vergangene Zeiten, als es noch einen echten Olymp gab mit einem glänzenden Gesellschafts- und Hofleben –, Pallas Athene sagt, die Götter sind heutzutage gar nicht mehr so sehr aufeinander eifersüchtig, sondern eher auf die Menschen. Der Mensch, sagt meine eulenäugige Freundin, benimmt sich heutzutage wie ein Gott und ist prahlend zwischen Himmel, Erde und Wasser unterwegs wie einstmals der Wolkensammler Zeus: Der Mensch glaubt, er herrsche über die Elemente und die Welt … Diese Nachricht hat mich nachdenklich gemacht. Die Menschen – genauer gesagt die Griechen – haben, als sie die alten Götter, unter anderem meinen Mann, ins Exil trieben, einen einfachen, aber aus einer guten Familie stammenden arkadischen Gott zu einem griechischen Helden verfälscht. Diese Erniedrigung schmerzte ihn im Geheimen. Er redete auch nicht gern darüber, dass er einst ein Gott war. Und er verachtete Poseidon, den Titelusurpator, von ganzem Herzen. Dieser Dreckskerl ist nur dank der Griechen zum Gott erhoben worden … Ein Gott, den die Menschen geschaffen haben! Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der die Götter den Menschen schufen. Möglicherweise war das ein wenig übereilt.
Manchmal höre ich schadenfroh, dass man nicht einmal seinen Namen richtig versteht. Die Sklaven, die heute die Bücher schreiben, streiten sich auf Zehntausenden von Seiten in dicken Wälzern darüber, was eigentlich sein richtiger Name war und was er zu bedeuten hatte. Sie wollen den Leuten einreden, dass mein Mann, als er – gezwungenermaßen – die griechische Staatsbürgerschaft annahm und sich in Ithaka niederließ, seinen Namen gräzisierte. Das ist eine Lüge. Bis zum Ende seines Lebens war er Ulysses, unser wunderbarer und fürchterlicher Herr.
Die Sänger und Seher sprachen seinen Namen später griechisch aus. Die Sklaven, die nicht mehr singen konnten und deshalb zu schreiben begannen, beteuerten, sein Name bedeute so viel wie „der Hasser“. Andere sagten: „den viele hassten“. Das stimmt, denn er wurde von vielen gehasst. Die Griechen, dieses kindisch prahlende, krankhaft eitle Volk, das vor Nationalstolz platzt, wollten die Welt glauben machen, mein Mann habe seinen alten Namen freiwillig abgelegt, um seiner Wahlheimat, der Griechenwelt, auch damit seine Treue zu erweisen. Es werden noch einige Äonen vergehen, bis ich die ganze Wahrheit sagen darf. Aber ich habe Zeit, und eines Tages wird die Wahrheit ans Licht kommen. Das Andenken meines Mannes ist so strahlend, dass ihm auch die Beschuldigungen der Griechen nichts anhaben können. Ich leugne nicht, dass er ein guter Grieche war, ein treuer Bürger seiner neuen Heimat. Doch wer glaubt, er hätte um jeden Preis Grieche sein wollen, der irrt. Seine Heimat war Ithaka, ja. Aber er hatte auch noch eine andere Heimat: die Veränderung. Hier war er wirklich Staatsbürger.
Ich will die Wahrheit sagen. Auch wenn ich damit sein Andenken verletze, denn er hielt nicht viel von der Wahrheit. Er log nämlich meisterhaft. Das ist kein Wunder, wenn man bedenkt, dass sein Großvater Autolykos war, der göttliche Viehdieb, Rosstäuscher und Brandmalfälscher, der das Lügen noch vom arkadischen Hermes gelernt hatte.
Autolykos war es auch, der seinem Enkel den Namen Ulysses gab. Dieser Name, jetzt kann ich es ruhig sagen, bedeutet „der Lichtbringer“. Nun habe ich es ausgesprochen und bin erleichtert. Es ist an der Zeit, dass unter diesen Streit zwischen den Sklaven endlich ein Schlussstrich gezogen wird.
III
Der Lichtbringer war er, der einzige. Der göttliche Dieb träumte diesen Namen für seinen Enkel. Meine Schwiegermutter, die einfältige Antikleia, unternahm in der Schwangerschaft einen Ausflug ins Gebirge Neriton und wurde dort von einem Regenguss überrascht: Nervös und hastig, wie sie war, brachte sie vor Schreck das Kind zur Welt, konnte allerdings nicht ahnen, dass sie dabei jemanden gebar, der göttlicher Abstammung war und deshalb selbst als Mensch mehr galt als ein gewöhnlicher Mann.
Von unserer Familie will ich nicht viel reden. Ihr fühlte Ulysses sich nie sonderlich verbunden. Vielleicht war seine ruhelose Natur daran schuld, vielleicht noch etwas anderes. Als er gestorben war, überlegten wir, was wir auf den Marmorstein schreiben lassen könnten, den wir an seinem Grab aufstellten. Schließlich konnte ich die Sklaven nicht meißeln lassen, dass hier der beste Ehemann, Vater, Verwandte und Freund ruht! Diese Formulierung entspricht ja nicht der Wahrheit. Deshalb ließ ich nur „Ulysses“ in den Grabstein meißeln. Wer es liest, weiß, dass hier der Lichtbringer ruht. Seiner Familie – wie seiner Nation – stand er nicht sehr nahe. Irgendwie fand er weder in der einen, noch in der anderen seinen Platz. Wenn man diese heiligen Worte in seiner Gegenwart aussprach, wurde er immer nervös.
Ja, er wollte nach Ithaka heimkehren. Als er unterwegs war, sagte er, er wolle nicht sterben, bevor er nicht noch einmal den Rauch seines Hauses gesehen habe. Und schließlich kam er tatsächlich heim nach Ithaka, um zu sterben. So wollten es die Götter. In dem Augenblick, in dem mein geliebter jetziger Mann Telegonos das Blut meines seligen Mannes vergoss, war Ulysses tatsächlich hier zu Hause in Ithaka. Im Augenblick seines Todes, im letzten Augenblick erst, gehörte er seiner Familie und dem Volk von Ithaka. Dies war der einzige Augenblick, in dem er sich bedingungslos und mit Leib und Seele zu Ithaka bekannte.
Ansonsten war er nur unser Herr, auf den wir ewig warteten. Das Rätseln, ob er nach Hause kommt, und wenn ja, wann, war bei uns schon eine Art Volksbrauch geworden, wie die religiösen Handlungen. Mir klingen noch die hoffnungsvollen Fragen im Ohr und dann – je mehr Zeit vergangen war – die eigenartig veränderten, in nicht ganz ehrlichem Ton vorgebrachten Mutmaßungen. Unsere treue Amme Eurykleia stahl in den ersten zehn Jahren nur wenig, und jeden Morgen, wenn sie, geweckt von der rosenfingrigen Morgenröte, bei mir anklopfte, um mich zu massieren, seufzte sie schon auf der Schwelle meines Schlafgemachs auf:
„Noch in diesem Jahr wird er heimkommen.“
Das klang wie ein Morgengruß. Später antwortete ich gar nicht mehr. Eumaios, der alte Schweinehirt – ich höre, dass der blinde Sänger ihn später einen Gott genannt hat, aber das ist eine unschickliche Übertreibung! –, begann gleich im ersten Jahr zu stehlen. Ich glaube nicht, dass dieser Schweinehirt göttlich war. Sicher ist, dass er viel stahl, sowohl er als auch die anderen Schweinehirten, die Diener, die Dirne Melantho, die sich in den Nächten mit meinen Freiern zusammenlegte, und mein ganzes Hausvolk. Ehrlich gesagt stahlen nur die Freier nicht. Alles, was sie aßen und tranken, ersetzten sie reichlich durch ihre goldenen und silbernen Geschenke. Zwei andere Schweinehirten, Melanthios und Philoitios, zählten meine Freier zusammen. Sie sagten, in den ersten zwanzig Jahren, in denen wir auf der Insel Ithaka auf meinen seligen Mann warteten, seien insgesamt hundertachtzehn Freier in unserem Haus gewesen. Ich bin nicht eitel – das gibt auch Pallas Athene zu, von der ich gewisse Mittel bekomme, die für die Körper- und Schönheitspflege nötig sind. Dennoch will ich nicht leugnen, dass mir diese ansehnliche Zahl guttat.
Alles, was meine hundertachtzehn Freier in zwanzig Jahren bei uns gegessen und getrunken haben, kostete nicht so viel wie das, was das Hausvolk während der Abwesenheit meines Mannes stahl. Dass die Bediensteten dies taten, wundert mich nicht. Es ist nur allzu menschlich. Wenn der Hausherr zwanzig Jahre lang – und später noch viele Jahre mehr – mit dem Schiff von einem Abenteuer zum nächsten unterwegs ist, zerfällt in der Wirtschaft alles und wird wie Spreu im Wind verweht. Amphinomos, einer meiner Freier, reif und schon etwas beleibt, ein überlegter und ernsthafter Mann, der sich auf die Landwirtschaft verstand, redete mir gut zu, die Plünderung durch die Elstern unseres Gesindes nicht zu dulden. Aber eine einsame Frau ist immer machtlos. Mein Sohn war, als mein Mann das erste Mal aufbrach, noch klein, und später, als er erwachsen wurde, hielten ihn die eigenartigen Zustände in unserem Haus und vielleicht die von seinem hehren Vater ererbten Eigenschaften davon ab, sich um die Wirtschaft zu kümmern. Dazu braucht es einen Mann. Nicht hundertachtzehn, sondern nur einen. Und dieser eine war immer und ewig unterwegs.
Wenn ich jetzt an Ithaka zurückdenke, beurteile ich das Verhalten meines Mannes nachsichtiger. Eigentlich lebten wir dort auf der Insel unter ziemlich ärmlichen Bedingungen. Das Ionische Meer, das unser bescheidenes Königreich mit seinen weinfarbenen Wogen umarmte, ist windig. Aiolos’ flinke Piraten, die nördlichen und südlichen Wüstenwinde, fuhren winters wie sommers durch das Laub der dürren Ölbäume auf unserer Insel, und in unserem weiträumigen Haus flatterten unaufhörlich die Teppiche vor den Türen. Ithaka war klein und felsig. Wiesen und Felder gab es dort kaum. Als die pferdezüchtenden Argeier zu uns zu Besuch kamen, wunderten sie sich über die Kargheit der Insel. Wir züchteten nur Ziegen. Auch deswegen musste mein Sohn Telemachos das Geschenk Menelaos’, die edlen Rosse, zurückweisen. Nirgends in Ithaka gab es die Weiten, die den Pferden Auslauf geboten hätten. Deshalb wandte sich mein Mann mit dem Herzen und dem Verstand dem Meer zu. Er dachte, auf dem Meer fände er die Weite, die ihm das Festland verweigerte. Das Volk, über das er herrschte, war klein, und als er später neben Ithaka Zakynthos und Samos hinzupachtete, vermehrten sich nur seine Sorgen und nicht sein Besitz. Ich will hier sein Andenken verteidigen.
Deshalb baute er unser Haus oben auf dem Hügel Aetos, an den Rand seines bescheidenen Reiches, unmittelbar ans Meer grenzend. Die pferdezüchtenden Gäste kritisierten diese Ortswahl. Sie waren Festländler und meinten, ein König oder jeder andere hohe Herr lebe sicherer, wenn er für seine Residenz einen zentral gelegenen Ort wählt. Als ich das hörte, verstand ich wieder einmal, welch tiefe Kluft meinen Gatten, den Mann des Meeres, von den Festländlern trennte. Er sah die Welt anders. Nicht Sicherheit wollte er, sondern Windesrauschen und Überraschungen. Deshalb wurde unser Haus auf dem Gipfel gebaut, am Ufer des Meeres, mit offenen Türen und Fenstern. Er wartete immer auf die Welt. Und als er eines Tages das Gefühl hatte, dass die Welt es nicht eilig hatte, zu ihm zu kommen, machte er sich auf den Weg zu ihr. Später kam er noch manchmal zu uns nach Ithaka zurück, aber ein längeres Bleiben gab es nicht mehr. Er tötete einige Männer, rechnete unser Vermögen zusammen, lag in meinem Bett und umarmte mich. Wir hatten noch einen Sohn, den edlen Ptolipathos, doch all das tat er schon etwas zerstreut und gleichgültig. Als würde es ihn gar nicht kümmern. Als dächte er immer an etwas anderes. Später habe ich oft überlegt, ob es richtig war, dass ich ihn nicht mit Tricks und Intrigen zurückgehalten habe, mit Leidenschaft und Flehen … War es recht, dass ich ihn nach Troja gehen ließ? Wenn ein Mann einmal die Heimat verlässt und mit Leib und Seele auf die Reise geht, kann er später nie wieder ganz heimkommen. Das habe ich erlebt. Man lernt langsam.
IV
Aber bevor er weggerufen wurde, bevor die ehrlose Weibsperson, deren Namen ich nicht einmal aussprechen mag, ihrem schwachsinnigen Mann ausgerissen ist – was mich übrigens nicht wundert, denn wie kann man mit einem blonden Mann leben? –, bevor diese Frau die Erinnerung in ihm wieder aufgerührt hat, war er unser Herr in Ithaka. Ein treuer, sorgsamer Landesherr und geduldiger König. Auch in unserer Armut großzügig. Immer gerecht und mild. Wir, die Familie, seine Diener, Schweinehirten und Schäfer, hörten nie ein lautes Wort von ihm oder einen tadelnden Ausbruch. Mild herrschte er über das Volk der Kephallener, wie ein Vater, der nichts will als dienen und erziehen.
Wie war er wirklich? Alles, was später geschah, verschleierte das Bild, das ich mir von ihm bewahrte. Als würde ich zwei Ulysses kennen. Den einen, der mit mir in Ithaka gelebt hat. Den anderen, der nach Troja ging und immer und ewig unterwegs war. Wenn er sich hin und wieder bei uns blicken ließ, badete er nur rasch und machte sich gleich wieder auf den Weg. All das wegen dieser Weibsperson, die sein Blut nicht zur Ruhe kommen ließ.
Diese Frau! Wie ich höre, schminkt und pudert sie sich immer noch. Sie benimmt sich wie wir Unsterblichen: cremt ihren Schattenleib mit Kallos ein, der duftenden Pomade, die den Körper elfenbeinfarben werden lässt. Auch Aphrodite benutzte diese Salbe, wenn sie zum Tanz ging … Athene verschönerte mit ihr – während ich schlief – meinen Körper und mein Gesicht, als ich auf meinen heimkehrenden Mann wartete. Alles stahl diese Weibsperson, alles machte sie nach, auch das Geheimnis der Masseusen und Göttinnen. Eine klapprige Schattengestalt ist sie und glaubt, dass sie noch auf die wehrlosen und lahmen Männer in Hades’ Heimat wirkt. Als wir junge Mädchen waren, haben wir in Sparta oft zusammen gebadet. Ich weiß, dass sie Pickel auf dem Rücken hat, Verdauungsprobleme und einen fauligen Atem. Eine Stimme hat sie wie eine Dienerin. Immer kichert sie, und dann hält sie sich die plumpe Hand vor den Mund. Sie glaubt, das wäre eine überaus zierliche Bewegung! Immer war sie dumm. Immer hinterhältig. Immer hatte sie Erfolg bei den Männern.
Manchmal dachte ich auch, dass es vielleicht für uns alle gut gewesen wäre, wenn ihr habgieriger Vater Tyndareos das Flehen meines seligen Mannes erhört und sie ihm zur Frau gegeben hätte.
Ich weiß, diese Idee ist irrwitzig, ungehörig. Denn die Götter haben unser beider Schicksal miteinander verbunden. Aber ich habe niemals verstanden, warum die unsterblichen Götter das Schicksal einer Frau an einen Mann binden, der eine andere liebt. Der sein Zuhause verlässt. Der in den Kampf zieht wegen einer sittenlosen Person, die sich in den Armen eines anderen wälzt. Die Götter schweigen merkwürdigerweise. Wenn mich diese Frage peinigt, erwacht eine Unruhe in meinem Herzen. Vielleicht sind die Absichten der Götter nicht immer verständlich und konsequent? Entscheiden und handeln sie manchmal planlos, eben nur, weil sie es können? Ich wage nicht, diese Frage laut auszusprechen.
Einmal – kurz nach seiner Heimkehr und wenige Tage, bevor er sich wieder auf den Weg machte und mich verließ – fragte ich meinen seligen Mann:
„Was hast du an dieser dämlichen Gans geliebt?“
Die Frage, so einfältig sie auch war, überraschte ihn nicht. Überhaupt überraschte ihn nie etwas unter den Menschen. Mit graugrünen Augen sah er in die Ferne, kalt und ruhig wie immer, wenn er über die Fragen der Menschen nachdachte.
„Du bist nicht gerecht“, sagte er. „Diese Frau hatte etwas.“
Das Mittagessen war vorüber. Wir waren allein und lagen in dem großen Saal, in dem er ein paar Monate zuvor meine Freier getötet hatte und aus dem danach mit Schwefel der Blutgeruch ausgeräuchert worden war. Der bittere Geruch des Schwefels klebte noch an den Wänden und reizte mich manchmal zum Niesen. In den Eisenkörben rauchte die Glut von harzigen Tujazapfen und Zypressenzweigen. Es war gegen Ende des Winters, und die Hitze des Feuers fuhr uns manchmal mit ehernen Krallen ins Gesicht. Telemachos war jagen gegangen, und ich bemerkte seit Tagen einen Zug im Gesicht meines Mannes, der mir nicht gefiel. Ich hatte den Eindruck, er langweilte sich. Ich begann mich zu fürchten.
„Aber was?“, fragte ich. Ich setzte mich auf der Liege auf und zog die Falten meines Gewandes glatt. In diesen Monaten kleidete ich mich besonders sorgfältig, weil ich noch hoffte, den Heimgekehrten zu Hause halten zu können. „Was ist dieses Etwas?“, fragte ich. „Ist sie klüger? Unzüchtiger? Geschickter? Unflätiger?“
„Von guter Art“, sagte er ausweichend und sah mich nicht an. Er griff nach dem Kelch und mischte sich Wein.
Diese Antwort verletzte mich bis aufs Blut. Ich versuchte mich zu beherrschen. Ich kreischte nicht los, weil ich gelernt hatte, mich auch in schweren Lebenslagen an meine teilweise göttliche Herkunft zu erinnern. Aber jetzt hatte er gerade meine Abstammung beleidigt, indem er meine Cousine, diese Weibsperson, als „von guter Art“ bezeichnete. Meine Schwester Laodike, meine Halbschwester Iphthime, meine Brüder Polymelos und Samasykolos, mein edler Vater, der ruhmreiche Ikarios, der aus einer alten Familie Spartas stammte … Sie alle schwiegen sich darüber aus, dass es neben den Glanzpunkten im Leben meines Vaters auch einen dunklen Fleck gegeben hatte: den Augenblick, in dem er sich zu meiner Mutter herabließ, zu einer gewöhnlichen Nymphe – nicht einmal des Wassers, sondern des Waldes – und mich zeugte. Ich muss jedoch zugeben, dass mein Mann stets so viel Zartgefühl und Ritterlichkeit besaß, um über diese Schande hinwegzusehen. Vor der Welt und auch mir gegenüber stand er zu seiner Schwiegermutter, meiner armen Mutter Periboia, der Nymphe. Aber die dunkle Glut der Schande brannte immer im Herzen der stolzen Familie.
Ich erwiderte nichts. Und er sah mich nicht an. Er mischte Samoswein mit dem säuerlichen heimischen Tresterwein, der in unserem Garten wuchs, zwischen den Ölbäumen, an Ranken, die mit Riedfäden aufgehängt waren. Als er den Kelch hochhob, um den Göttern zu opfern, spürte ich Groll in mir aufwallen. Unseren Sohn hatte mein Mann gelehrt, dass man am Gegner nicht herummäkeln darf. Aber ich bin nicht nur eine Göttin, sondern auch eine Frau, und der Aufruhr in meinem Herzen war stärker als mein Verstand. Ich sah meinen Mann an und mein Herz begann zu rauschen wie das Meer, wenn es vom verschleierten Mond gerufen wird. Er trank den Kelch in einem Zug leer und sah den schweren Silberpokal – ein Geschenk eines meiner Freier, des bedächtigen Amphinomos – zufrieden an, so wie alles aus Silber und Gold, das die Freier mir geschenkt hatten. Mit einer langsamen Bewegung setzte er den Pokal auf dem runden Marmortisch ab und stand auf. Im gnadenlos scharfen Licht des Spätwintertags sah ich jetzt die Züge seines Gesichtes – anders als je zuvor. Anders als damals, als er sich aufgemacht hatte, um neun Jahre lang vor Trojas Mauern zu kämpfen, und dann noch ein Jahrzehnt lang umherschwirrte und in fremden Höhlen in den Armen verdächtiger Frauen lag. Die bittere Gischt des herbstlichen Meeres hatte seinen sehnigen Leib gebeizt, während ich mich mit den Freiern und den diebischen Schweinehirten sowie mit der Erziehung unseres hehren, aber immer etwas nachlässigen Sohnes herumgeschlagen hatte … Er hatte sich verändert. Der Wind, das Meer, die Ausdünstungen der Küsse fremder Frauen, dann der Kampf, die Leidenschaft des Tötens, der Meißel der Duldung hatte fremde Muster in dieses Gesicht geschnitten. Es war nicht mehr das Gesicht meines Mannes, sondern das eines Fremden. In diesem Augenblick begriff ich, dass mein Mann, der Lichtbringer, nicht nur wegen der Hochnäsigkeit der hereindrängenden Griechen aus der göttlichen Rangordnung in die menschliche Welt herabgestiegen war. Die Polypenarme des Abenteuers hatte ihn in die Tiefe hinabgerissen, wo die Menschen leben … das menschliche Abenteuer, die Neugier. Die großen Götter, die echten, sind wütend und eifersüchtig, doch niemals neugierig. Offenbar beginnt die Neugierde beim Menschen. Er ist freiwillig zu den Menschen hinabgestiegen, weil er von dem schaumig-schmutzigen Trunk der Neugier gekostet hatte und ein Mensch sein wollte. Der Mann, der jetzt zur Tür ging, hatte zwanzig Jahre lang vor den Mauern von Troja und in der Welt gekämpft, weil er nicht vergessen wollte und neugierig war. Mein Gesicht brannte wie Feuer. Ich schämte mich, auch an seiner statt. Als er an der Schwelle war, schrie ich ihn an:
„Weißt du, dass dein Freund Menelaos, diese Memme, Helena wieder in sein Haus aufgenommen hat?“
Er blieb stehen. Über die Schulter sah er zurück und antwortete ernst:
„Ich weiß.“
Er zuckte mit den Schultern.
„Wir haben gesiegt“, sagte er.
Und er lächelte. Aber so kalt, gnadenlos und böse, wie nur ein Mann lächeln kann. Dann verließ er den Saal. Lange saß ich einfach da. Ich hatte mein Gesicht in den Händen verborgen. Vor Schreck hatte ich am ganzen Körper Gänsehaut bekommen. In diesem Augenblick begriff ich, dass der Trojanische Krieg vergeblich gewesen war, dass es nichts nützte, dass ich zwanzig Jahre lang auf ihn gewartet hatte. Ich begriff, dass es keine Hoffnung gab, weil mein Mann alt geworden war: Ihm waren die Erinnerungen wichtiger als die Gegenwart. So begann es.
V
Der Gefühlssturm des Wiedersehens war für mich in diesem Augenblick vergangen. Ich begann, ihn zu beobachten. Dafür wählte ich die Stunden, in denen mein Mann in meinem weiträumigen Schlafgemach auf der mit Ziegenfell bedeckten Liege neben mir lag. So, im Dunkeln, konnte ich ihn besser studieren.
Sein Geruch war mir vertraut. Nur entströmte seiner Haut vielleicht noch rauer und derber als zuvor der Geruch des Meeres. Gischt und Tang, Salz, die Gewürze des Süd- und Nordwindes und schließlich ein magenumdrehend süßlicher Duft, den nur der Körper einer fremden Frau in den Poren eines Mannes zurücklassen kann. Doch selbst diese starken, unsympathischen, fremden Gerüche konnten meine Erinnerungen nicht verfälschen. Im Dunklen legte ich meinen Kopf auf seine Schulter und trank mit Nase und Mund den Geruch seines Körpers. Ich spürte, dass mein Mund kühl war, weil ich innerlich brannte. Ich verstand, dass etwas zu Ende war: Das Warten, dieser sonderbare Mythos, war zu Ende. Ich wusste, dass die Wirklichkeit begonnen hatte.
In der Dunkelheit hörte ich sein Herz schlagen. Unter seinen kräftigen Knochen, in seinem harten Brustkorb schlug das Herz wie der Hammer des Hephaistos, als er auf seinem Amboss die Lanze schmiedete, mit der Ulysses’ Sohn Telegonos, mein hehrer jetziger Mann, ihn später töten sollte. All das lag in diesem Augenblick. Die Einzelheiten konnte ich nicht vorher wissen, ich bin keine Sibylle. Aber dass es so kommen würde, wusste ich. Deshalb beobachtete ich ihn, vernahm mit durstigen Ohren das Schlagen seines Herzens. Ausdauernde und harte Schläge dröhnten in der Höhle seines Brustkorbs. Für wen und für was dieses Herz wohl schlagen mochte? Ich wusste es nicht.
Ich wusste nur, dass es nicht für mich schlägt.
In den zwanzig Jahren, die ich auf ihn wartete, wurden mir die Nachrichten korbweise ins Haus getragen von den Freiern, den Dienern, den Herolden und einem Menschen, den ich zu diesem Zweck hielt und bezahlte: von Medon, dem Flinken. Meine Diener und meine wortgewandte, diebische, liebe alte Amme Eurykleia versäumten keine einzige Gelegenheit, bei Wanderern, Schiffsleuten und herumlungernden, umherstreunenden Göttern Nachrichten für mich einzuholen. Darunter waren viele Flunkereien, aber aus der Kiepe voller Lügen quoll schließlich ein dicker Tropfen Wahrheit hervor. Ich wusste dies und jenes über Helena, hatte mit halbem Ohr von Nausikaa gehört, dieser ekelerregenden Person, die halb Jungfrau, halb Vogel war. Und von Kirke, meiner lieben Schwiegertochter beziehungsweise auch Schwiegermutter … Es verwirrt mich immer, wenn ich mein Verhältnis zu ihr bestimmen muss. Zufrieden hörte ich auch, dass er bei allen Abenteuern Würde und Haltung bewahrte: Er kehrte unterwegs nicht ins Freudenhaus ein, dort auf der Insel, wo die Sängerinnen die Reisenden anlocken. Das tat mir wohl. Ich freute mich immer, wenn ich hörte, dass er auf seine Gesundheit achtete.
Eines Nachmittags – es muss ungefähr im fünfzehnten Jahr seiner Abwesenheit gewesen sein – besuchte mich mit flinkem Schritt meine liebe Freundin Pallas Athene. Jetzt kann ich es ja sagen: In unserem Haus gaben sich die Götter die Klinke in die Hand. Meine Umgebung und die Dienerschaft waren so daran gewöhnt, dass sie überhaupt nicht überrascht waren, wenn ein Gott zu Besuch kam. Nur die Hunde verbellten unsere Gäste, weil die unvernünftigen Tiere das Göttliche hinter der menschlichen Maskerade nicht erkannten. Der Jagdhund meines Mannes, der treue Argos, bellte Athene jetzt auch an. In Wahrheit war dies eine glückliche Zeit: Die Welt der Menschen und die der Götter waren noch nicht völlig voneinander getrennt.
Obwohl ich die Tochter einer Waldnymphe bin, bin ich mir meiner göttlichen Herkunft sehr wohl bewusst. Und unter meinen Gästen waren oft verkleidete Götter, die sich ungehemmt und menschlich betragen konnten. Ein häufiger Gast unseres Hauses war Hermes, ein entfernter Verwandter meines Mannes, der auch oft bei uns übernachtete. Seine Flügelsandalen reinigte Eurykleia dann mit besonderer Sorgfalt. Und für Pallas Athene, die naschhaft war, standen in einer phönizischen Glasschale immer süße Feigen und nach Ambra duftende Ambrosia bereit. Meine Freundin kam jetzt gut gelaunt und erregt an:
„Ich bringe Nachrichten von ihm!“, rief sie schon auf der Schwelle und verscheuchte mit einer Hand Argos, der nach ihrem Rock schnappte.
„Ruhe dich erst einmal in unserem bescheidenen Hause aus, Tochter des Zeus!“, gab ich höflich zur Antwort. Aber es war keine Zeit für Förmlichkeiten. Sie setzte sich neben mich auf die Liege – völlig außer Atem, denn sie war auf dem Luftweg gekommen – und strich sich die Nase, die unterwegs etwas glänzend geworden war, rasch mit Kallos ein. Dann begann sie auch schon zu erzählen.
„Große Dinge sind geschehen, Penelope. Auf dem Olymp hat eine geheime Sitzung in der Sache deines Mannes stattgefunden. Poseidon, mein nachtragender und eifersüchtiger Bruder, hat von meinem erhabenen Vater Zeus einen Rüffel bekommen. Dein Mann kehrt noch nicht heim. Aber vom heutigen Tag an kannst du sicher sein, dass er wieder nach Hause kommt. Aber das ist noch nichts“, sagte sie und schob den Tiegel mit der teuren Salbe zurück in die Alabasterhülle, die sie immer am Gürtel trug.
„Nichts?“, fragte ich, und mein Herz schlug mir bis zum Hals. „Was kann noch wichtiger sein?“
Mir versagte beinahe die Stimme. Später dachte ich oft an diesen Augenblick. Die Nachricht – nach anderthalb Jahrzehnten die erste verbürgte Nachricht darüber, dass er heimkehren würde – erfüllte mich mit wilder Freude und zugleich mit Furcht. Und in der denkwürdigen Nacht, in der ich wieder neben meinem Mann im Bett lag und seinem Herzschlag lauschte, erinnerte ich mich wieder an diese Furcht.
Aber ich fragte sie nur vorsichtig aus, weil ich wusste, dass die Überbringerin der Nachricht, meine göttliche Freundin, in meinen Mann verliebt war. Über diese Neigung habe ich viel nachgedacht. Ich weiß nicht ganz genau, ob sie ein Verhältnis miteinander hatten. Für die Göttinnen ist es nicht einfach, mit einem irdischen Menschen zusammen zu sein, nicht einmal, wenn dieser Mensch göttlicher Abstammung ist. Die Schwierigkeiten sind vielfältig: teilweise sind es rituelle, teilweise aber auch andere, biologische. Als Frau weiß ich jedoch sehr wohl, dass die sanfte Sorge unserer göttlichen Freundin, mit der sie meinen Mann daheim und in der Fremde umgab, nicht ganz uneigennützig war. Ich war nicht eifersüchtig – Athene hatte damals schon etwas zugenommen, wie veranlagungsbedingt alle Frauen ihrer Familie –, aber ich war auf der Hut. Ihr vornehmer Rang unter den Himmlischen, ihre berufsmäßige Jungfräulichkeit (über diese wurde viel geredet, aber es wäre unter meiner Würde, all das weiterzugeben, was ich irgendwann über Athenes Jungfräulichkeit gehört habe) und ihre eigentliche Aufgabe, die Helden, Gelehrten und Künstler zu beschützen … all das hätte mich von der Uneigennützigkeit ihres Interesses für meinen Mann überzeugen können. Ich kannte jedoch meinen Mann. Und ich kannte die Göttinnen … Mit vorgetäuschter Gleichgültigkeit beobachtete ich sie vorsichtig. Im langen Reigen der Frauen machte eine Göttin mehr oder weniger – so dachte ich – keinen großen Unterschied.
„Wir haben erfahren, wo er sich aufhält!“, sagte meine jungfräuliche Freundin. Mit ihren Eulenaugen sah sie mir tief und etwas schielend in die Augen. In solchen Momenten ähnelte sie wirklich einer dicken, alten Jungfer. Sie weinte schnell … Mein Mann nannte sie, etwas undankbar – wie er im Allgemeinen über Frauen und Göttinnen sprach – einmal eine Pute und sagte, diese alte Jungfer leide an einer gestörten Drüsenfunktion.
Jetzt erzählte sie alles. Was ich hörte, ärgerte mich. Ich muss zugeben, von Kalypso wusste ich bislang nichts. Diese verworfene alte Frau hatte ihr Geheimnis und meinen Mann sieben Jahre lang wohl gehütet. Dass die Nymphen junge Männer rauben und sie zu Liebeszwecken im Wald, tief in felsigen Höhlen, festhalten, war mir nicht neu. Aber ich verstand nicht, wie es Kalypso gelingen konnte, Ulysses, diesen starken und stolzen Mann, festzuhalten. Als Athene in ihrer Erzählung da angekommen war, dass Hermes meinen Mann gesehen hatte, wie er auf einem Felsen saß und vor Kummer weinte, weil er seiner betagten, schöngelockten Gastgeberin jede Nacht mit seiner Manneskraft dienen musste, da brach es mir fast das Herz. Mein Mann, der Held von Troja, wurde sieben Jahre lag von einem altem Weib ausgehalten, bekleidet, gespeist und benutzt wie ein Lustknabe! Obwohl ich kurz davor war, loszuheulen, bemühte ich mich, Ruhe vorzutäuschen. Meine göttliche Freundin beachtete mich nicht, sondern fuhr begeistert und aufgeregt fort. Schadenfreude und gespielte Empörung mischten sich in ihren Ton, so wie bei allen Frauen, die etwas Pikantes über den Mann, in den sie heimlich verliebt sind, erfahren.
„Seit sieben Jahren“, sagte sie merkwürdig zufrieden, „seit sieben Jahren benutzt diese alte Nymphe deinen Mann, Penelope. Hermes sagt, er besteht nur noch aus Haut und Knochen. Stell dir das nur vor! Natürlich habe ich alles über diese gemeine Person in Erfahrung gebracht. Sie stammt aus der Familie der Wassernymphen. Weben und spinnen kann sie meisterhaft, wie die Nymphen und ihre Abkömmlinge im Allgemeinen.“ Den boshaften Seitenhieb musste sie wohl anbringen. Ich schlug die Augen nieder und wurde rot. „Verzeihung!“, bat sie mich mit geheuchelter Freundlichkeit. „Ihre Verwandten sind die Satyrn und Silene, dieses gemeine Volk des Waldes. Ihre Dienstboten und ihr Hausvolk nimmt sie aus ihrer Verwandtschaft, aus der hergelaufenen Bande der Najaden, Dryaden und Oreaden. Grässlich!“ Mit ihren Eulenaugen schaute sie mich von unten herauf an, um die Wirkung ihrer Worte zu prüfen.
„Ich bin sicher, dass mein Mann auch in der Gefangenschaft dieser alten Schachtel seine Würde bewahrt!“, sagte ich ausweichend und würdevoll. Aber mein Herz raste, weil mir jedes Wort der Göttin wehtat.
„Sie lässt sich die Flechtenschöne nennen“, schwatzte Pallas Athene weiter, als hätte sie meine Bemerkung gar nicht gehört. „In Wirklichkeit trägt sie eine Perücke, weil sie schon fast völlig kahl ist.“
Sie erzählte noch viel Unangenehmes. Die Offenherzigkeit, mit der die Götter und Göttinnen so groß tun, ist oft nichts anderes als fehlendes Feingefühl. Wortlos und unter großer Selbstbeherrschung hörte ich zu.
Als sie gegangen war, ließ ich meinen hehren Sohn Telemachos zu mir rufen. Er kam von den Freiern, sie hatten den ganzen Nachmittag ein Ballwurfspiel gespielt. Zu dieser Zeit, im fünfzehnten Jahr der Abwesenheit meines Mannes – sosehr es mich auch schmerzt, ich muss es sagen –, fühlte sich mein Sohn bereits ziemlich wohl in der Gesellschaft der Freier. Einige von ihnen waren in seinem Alter, mit ihnen konnte er sich unterhalten, im Kauderwelsch der jungen achäischen Generation tauschten sie ihre Gedanken über die Dinge daheim und in der Welt aus. Unter den Älteren gab es mehrere, die den jungen, unerfahrenen Herrn des Hauses mit praktischen Ratschlägen versahen. Alles dies hatte sich so ergeben, weil mein Mann nie da war. Telemachos war ein sonderbares Kind. Aufbrausend, wenig bedacht … Von der Schläue seines hehren Vaters hat er nichts geerbt. Den Genüssen wiederum war er sehr wohl zugeneigt, wenn auch anders als mein seliger Mann. Dieser suchte im Genuss nicht die Ufer des Rausches – das Ufer des Vergessens, wo Verstand und Nerven sich erholen können –, sondern die Unendlichkeit, in der der Mensch über die Grenzen seiner Persönlichkeit hinauswächst. Ulysses glich auch im Rausch dem Meer. Wie das Meer kein Ende hat – es hat nur Ufer, aber das ist nicht dasselbe –, so fand auch mein Mann niemals ein Ende an den schlammigen Ufern des Rausches und der Selbstvergessenheit. Jetzt, da er nicht mehr ist, verstehe ich das besser. Mein Sohn lag leider nicht gern im Meer, sondern in der Pfütze wie die Schweine des Eumaios. Ich sah ihn an und seufzte.
Stolz, aber etwas struppig stand er vor mir; er hatte sich beim Ballspiel erhitzt. Das Haar fiel ihm in die Stirn, das Gesicht war gerötet, weil er schon am frühen Nachmittag mit den jüngeren Freiern zu trinken begonnen hatte.
„Dein Vater kommt heim“, sagte ich kurz.
Diese Art habe ich von meiner trojanischen Tante Kassandra gelernt, die das Schicksal immer in so einem hölzernen Ton verkündete. Mein Sohn bemühte sich, gerade zu stehen, aber ich sah, dass ihn die frohe Nachricht etwas ins Schwanken brachte.
„Ist nicht wahr“, sagte er düster und heiser.
Wir sahen uns in die Augen. Ich stand auf.
„Woher weißt du das, strahlende Mutter?“, fragte er dann verlegen.
„Pallas Athene brachte die Nachricht“, antwortete ich feierlich.
„Äh“, sagte er missgelaunt und knirschte mit den Zähnen wie ein auf frischer Tat ertappter, halbwüchsiger Bengel. In seinem Gesicht sah ich Erschrecken und Widerstand. Aber wie sonderbar: Auch in meinem Herzen – ganz tief drinnen, wo nur die Sibyllen die menschlichen Leidenschaften wirbeln sehen – wogten ähnliche Gefühle!
„Dein Vater kommt heim“, wiederholte ich streng. „Versteh doch, Telemachos! Vielleicht morgen, vielleicht in einigen Jahren. Aber eines Tages kommt er heim. Das ist jetzt sicher. Die Götter haben entschieden.“
„Das wird schwierig“, sagte er unwillkürlich mit gesenktem Kopf.
Dann fügte er wie zur Entschuldigung heiser hinzu:
„Ich meine, es ist immer schwierig, wenn die mächtigen Götter entscheiden, ohne die Menschen zu fragen.“
Ich antwortete nicht. Mein Sohn tat mir leid. Ich selbst tat mir gleichfalls leid. Gern hätte ich auch meinen Mann bemitleidet, aber dazu hatte ich jetzt keine Kraft mehr. Man kann nicht ungestraft zwanzig Jahre lang auf einen Mann warten, der in einen Krieg geht, dessen Fahne ein weiblicher Unterrock ist, der Heldentaten vollbringt, die von vielen für Gräueltaten gehalten werden, und der sich unablässig auf den Willen der Götter beruft, wenn er heimkehren soll. All seine Gefährten, mit denen er einstmals in die Schlacht gezogen war und die in diesem verdächtigen Unternehmen nicht das Leben gelassen hatten, waren der Reihe nach heimgekehrt. Er war immer noch nicht zurück. Und ich saß mit meinem Sohn und den Freiern in Ithaka und musste ohnmächtig zusehen, wie mir ohne den Hausherrn unser Vermögen durch die Finger rann; ich webte, obwohl dies eine Beschäftigung ist, die ich mehr als alles andere hasse. Meine Mutter, die Nymphe, hatte sich beruflich mit der Anfertigung von Hausgewebtem beschäftigt und dafür gesorgt, dass ich diese eintönige Arbeit schon als kleines Mädchen zu hassen lernte. Ich webte – meine lächerliche Ausrede nahm natürlich kein einziger Freier ernst – und dachte daran, dass die Zeit vergeht. Mein Mann war einundfünfzig Jahre alt, als er endlich eines Tages auf dem Schiff der Phaiaken schlafend auf unsere Insel zurückkam. Ich war zweiundvierzig.
„Wenn Frauen und Kinder offen reden, bleibt selbst vom großen Odysseus nicht viel übrig. So ist es nicht nur in Sándor Márais neu zu entdeckendem Roman.“
„›Die Frauen von Ithaka‹ ist ein Roman, der glänzend zu unterhalten versteht, weil er seine Hauptfigur, gerade indem er sie ihren Zeitgenossen entfremdet, uns Heutigen umso näher bringt.“
„Ein Roman über die Unsterblichen und Sterblichen, der mit Wissen, ironisch, dabei höchst unterhaltsam, intelligent und modern geschrieben ist.“
„Die Einformung in den griechischen Mythos eröffnete neue unerprobte Stil-und Gegenstandsmöglichkeiten, denen sich der Autor lustvoll überließ. Marai aktualisiert nicht die Odyssee, sondern verfährt umgekehrt: Er belässt seine Geschichte in archaischer Vorzeit, liefert aber (...) eine Mythentravestie, die die handelnden Figuren konsequent mit einem "modernen" Bewusstsein ausstattet. (...) Wie überhaupt der Übergang vom Mythos zur Geschichte, von der Unsterblichkeit zur Sterblichkeit, von den Göttern zu den Menschen das große und ernste Thema des Buches ist.“
„Marais Fortschreibung der Odyssee ist ein grandioses Buch. (...) Ein ebenso kurzweiliges, wie erhellendes Buch, mit dem er dem klassischen Stoff sein außerordentlich lesenswertes, psychologisch fein ausgelotetes Update gab.“
„Marai hat aus der alten Geschichte eine moderne, witzige, intelligente Erzählung gemacht.“
„Ein altbekannter Stoff, vom ungarischen Autor mit Wissen und Witz neu erzählt. Mythologie für ein Publikum von heute.“
„Immer wieder sind die Odysseus-Abenteuerstorys nacherzählt, umgedeutet und weitergedacht worden. Keinem dürfte der Stoff so nah gewesen sein wie dem im ungarischen Kaschau geborenen Weltbürger Sándor Márai. Heimatverlust, Unterwegssein und Exil sind zentrale Koordinaten der Biografie dieses Autors von weltliterarischem Rang.“
„›Die Frauen von Ithaka‹ enthüllt eine andere Facette des ansonsten psychologisch tiefbohrenden Autors: das mehr oder weniger ironische Spiel mit der griechischen Mythologie in einer temporeichen, durchaus brillanten, aber auch kaltschnäuzigen Erzählweise.“
„Für Márai ist Odysseus eine durch und durch gebrochene Gestalt, opak und ungreifbar. Er ist der erste Individualist in einer noch mit sich selbst versöhnten Welt. (...) Er ist ein Mensch auf der Schwelle, eine Schlüsselfigur zwischen archaischer und moderner Welt, zwischen Mythos und Geschichte, weder von der einen noch von der anderen Seite aus ganz zu verstehen. Dabei hatte Márai, das große Unterhaltungsgenie, einen alles andere als schwierigen Roman geschrieben, ganz im Gegenteil, mit leichter Hand entfaltet er das Tableau der griechischen Welt. (...) Es ist der wohl vielgestaltigste seiner Romane.“
„Ein ebenso kurzweiliges wie erhellendes Buch, mit dem Sándor Márai dem klassischen Stoff sein außerordentlich lesenswertes, psychologisch fein ausgelotetes Update gab.“
„Hochgelehrt und dabei höchst unterhaltsam.“
„Sándor Márai bürstet die antike Mythologie mit viel Ironie gegen den Strich.“
„Klug und anspielungsreich und dabei höchst unterhaltsam und humorvoll, verarbeitet Sándor Márai die verschiedensten antiken Vorlagen und Versionen des Mythos. So viel Leichtigkeit gepaart mit so viel Bildungsreichtum, meint man mitunter, hat es seit ein paar tausend Jahren nicht mehr gegeben.“
„Man hat schon viel über Odysseus gelesen, doch dieses Buch ist wieder mal spannend: Spitzzüngig und mit sehr modernem Blick erzählt Márai vom vermeintlichen Superstar der Antike: Odysseus unchained sozusagen.“






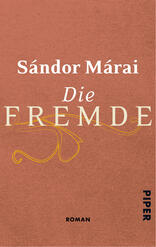
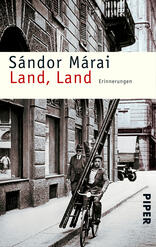

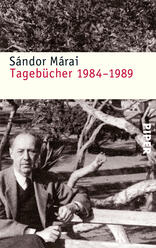







DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.