
Der Engel von Paris
Roman
„Eine lebensbejahende Geschichte, die wohl jeden Leser zum Schmunzeln bringen wird.“ - Frankreich Magazin
Der Engel von Paris — Inhalt
Marie hat sich bisher meist um andere gekümmert: um den Buchladen im Pariser Stadtteil Montmartre, den sie von ihrem Großvater geerbt hat, um den kauzigen Émile und die vorlaute Schülerin Noémie. Doch dann taucht plötzlich Éloïse auf, die behauptet, Maries Schutzengel zu sein. Und Éloïse hat eine Mission: Sie will Marie helfen, sich von der Vergangenheit zu lösen und eigene Träume zu verwirklichen - und am besten auch gleich den charmanten Josh anzurufen, den sie gerade erst kennengelernt hat. Der jungen Buchhändlerin bleibt nichts anderes übrig, als sich ihrem Schicksal zu fügen - doch dabei hat sie nicht mit dem himmlischen Ungeschick ihres Schutzengels gerechnet ...
Leseprobe zu „Der Engel von Paris“
1
Die altmodischen Fensterläden dämpften die ersten Strahlen der Morgensonne. Sie fielen auf den Wecker, der direkt neben dem Bett auf dem Boden stand: Viertel vor sieben am Morgen, und Paris machte sich bereit für einen neuen Tag.
Marie hatte sich tief in ihr Federbett eingekuschelt, sodass nur eine kastanienbraune Haarsträhne hervorlugte. Zusätzlich zu dem Schlafzimmer mit direktem Zugang zum Bad bestand ihre Wohnung aus zwei lichtdurchfluteten Wohnräumen und einer Küche mit gewachsten tomettes auf dem Boden. Die achteckigen roten Fliesen mit [...]
1
Die altmodischen Fensterläden dämpften die ersten Strahlen der Morgensonne. Sie fielen auf den Wecker, der direkt neben dem Bett auf dem Boden stand: Viertel vor sieben am Morgen, und Paris machte sich bereit für einen neuen Tag.
Marie hatte sich tief in ihr Federbett eingekuschelt, sodass nur eine kastanienbraune Haarsträhne hervorlugte. Zusätzlich zu dem Schlafzimmer mit direktem Zugang zum Bad bestand ihre Wohnung aus zwei lichtdurchfluteten Wohnräumen und einer Küche mit gewachsten tomettes auf dem Boden. Die achteckigen roten Fliesen mit schiefergrauen Schmucksteinen schienen schon seit Urzeiten dort verlegt zu sein. Sie hatte das Apartment von ihrem Großvater Samuel geerbt und war vor einigen Jahren eingezogen. Trotz der Erdgeschosslage im 17. Arrondissement, in der Rue des Moines Nummer 21, hatte man von hier aus einen freien Blick über die Dächer von Paris.
Marie liebte es, inmitten der Habseligkeiten ihres Großvaters zu leben. Und dennoch befand sich in dem Teil des Wohnbereichs, den Marie als Arbeitsplatz nutzte, seit Samuels Tod eine stets verschlossene Tür. Trotz der unerschütterlichen Liebe zu ihrem Großvater fühlte sie sich außerstande, das Zimmer hinter dieser Tür zu betreten. In ihrer Vorstellung warteten dort zu viele Erinnerungen an ihre Familie auf sie. An ihre Herkunftsgeschichte, aber vor allem an Geheimnisse, von denen sie nichts wissen wollte.
Marie glaubte fest daran, dass sie beim Übertreten der Türschwelle in die Vergangenheit katapultiert werden würde. Und dann wäre es ihre Aufgabe, diese Vergangenheit zu bewahren, zu ehren oder gar zu verändern. Auf jeden Fall wäre sie gezwungen, irgendetwas mit dieser Vergangenheit anzufangen. Also blieb die Tür zu dem Erinnerungszimmer verschlossen und wurde von ihr nur ab und an kurz gestreichelt. Mit dieser Geste wollte Marie ihrem Großvater zeigen, dass sie ihn nicht vergaß, auch wenn sie noch nicht dazu bereit war, sein Vermächtnis in die Gegenwart zu bringen.
Die Nacht war kurz gewesen. Als leidenschaftliche Leserin und Erbin eines Buchladens hatte Marie eine Signierstunde mit einem Romanschriftsteller veranstaltet, der gerade sehr in Mode war. Ihr Buchladen mit seinem altmodischen Charme hatte sich gar nicht mehr leeren wollen, und die Bücher waren weggegangen wie warme Semmeln. Dieser Erfolg hatte beim anwesenden Verleger die fixe Idee erzeugt, dass sein Autor der Victor Hugo des 21. Jahrhunderts wäre. Marie hatte sich klammheimlich darüber amüsiert, denn heutzutage konnte es sich kein Autor mehr erlauben, wie Thomas Chatterton nur aus Liebe zu den Worten zu schreiben – und sich dann umzubringen.
Der Buchladen lag an der Place Goudeau Nummer 10 in Montmartre und schmorte dort in seinem eigenen Saft, eine Mixtur, die Samuel vor langer Zeit angerührt hatte: bis unter die Decke gestapelte Ausgaben seltener Bücher auf proppenvollen Regalen. Die einzigen beiden Zutaten, die Marie dem Ganzen hinzugefügt hatte, waren zeitgenössische Literatur und Bücherstapel auf Präsentiertischen oder direkt auf dem Boden, nach Wichtigkeit sortiert, aber nicht zu ordentlich.
Marie besaß ein fotografisches Gedächtnis, und damit beeindruckte sie jeden, der die Schwelle in ihren Laden überschritt. Sie hatte nicht nur sämtliche Informationen über ihr Lager im Kopf, sondern kannte auch den gesamten Inhalt aller Bücher, die sie jemals gelesen hatte.
Um alle Sinne ihrer Kunden anzusprechen, hatte Marie gleichzeitig mit der gestrigen Signierstunde eine Weinprobe abgehalten. Das Aroma der Trauben hatte natürlich auch Jacques, Raymond und Francis auf den Plan gerufen, drei Clochards von der Rue d’Orchampt. Sie hatten sich selbst eingeladen, doch nicht ohne Marie ihre letzten Fundstücke mitzubringen. Die tres amigos – so wurden sie von den Bewohnern und Gewerbetreibenden des Viertels genannt – hatten ein besseres Geschäftsmodell gefunden, als zu betteln oder Flaschen aufzusammeln. Sie durchstreiften die Straßen der Hauptstadt und nahmen alles mit, was mehr als fünfzig Seiten hatte und innen bedruckt war. Marie kaufte also manchmal kistenweise alte Bücher auf, deren einziger Zweck darin bestand, den drei alten Haudegen die nächste Mahlzeit zu ermöglichen.
Gegen 23 Uhr, nachdem sich auch sein letzter angeheiterter Leser davongemacht hatte, verfiel der angesagte Romanautor in die Art von Melancholie, die einen packt, wenn man allein in seine Höhle zurückmuss, wo man doch gerade noch so viele Menschen zum Träumen gebracht hat. Und da spontaner Beistand wirksamer ist als jedes wohlüberlegte Wort, schlug Marie vor, ihm noch bei einem letzten Absacker in ihrem Laden Gesellschaft zu leisten.
Gegen halb zwei Uhr morgens schob sie ihren Autor endlich in ein Taxi, schloss die Buchhandlung ab, schwang sich auf ihr Fahrrad und fuhr gemächlich durch die leeren Straßen nach Hause. „Die frische Nachtluft hilft dabei, wieder nüchtern zu werden“, murmelte sie immer und immer wieder wie ein magisches Mantra, mit dem sie gegen die Wirkung des Alkohols ankämpfte. Doch der Gedanke, vom Rad zu fallen und die Nacht in Gesellschaft der tres amigos zu verbringen, genügte, um einigermaßen aufrecht geradeaus zu fahren.
Angekommen in der Rue des Moines Nummer 21, tippte Marie den Code für ihre Eingangstür ein, ging durch den Hausflur bis zu ihrer Wohnung und lehnte das Fahrrad gegen die Wand. Die Bässe der Musik ihres Nachbarn Aymerick wummerten wieder einmal durchs ganze Haus. Er war ein verstoßener Spross aus gutem Hause, letzter Nachkomme seiner Familie und feierte in seiner Wohnung auf der fünften Etage gerne die Nacht durch.
Die alte Comtoise-Uhr im Flur ihrer Wohnung zeigte zwei Uhr an. In einem vielfach erprobten Ritual schlüpfte Marie auf dem Weg durchs Wohnzimmer aus den Schuhen, knöpfte den Rock auf, der zu Boden glitt, und stieg aus ihm heraus, während sie gleichzeitig den Pullover auszog und aufs Sofa warf. In Unterwäsche ging sie durch den Flur zurück in die Küche. Dort öffnete sie die Kühlschranktür, schnappte sich die Milchflasche und trank mit gierigen Zügen. Das Licht aus dem Kühlschrank blieb einen Augenblick lang auf den Gläsern mit Gewürzen im Regal gegenüber hängen – Gewürze, die sie für die in ihrem Gedächtnis abgespeicherten Gerichte brauchte. Als sie den Kühlschrank wieder schloss, verschwand der Lichtschein, und Marie begrüßte Phoenix, einen pflegebedürftigen Philodendron, der seinen Platz auf ihrer Fensterbank hatte.
Danach kuschelte sie sich unter ihre Decke. Sie wollte am Morgen früh aufstehen, um die beiden kommenden Tage voll auszunutzen. Margaux, ihre Freundin aus Kindertagen, hatte morgen Geburtstag und veranstaltete eine Party. Und laut Margaux würde dieser Abend Maries Singledasein mit absoluter Sicherheit beenden. Mit einem Lächeln auf den Lippen schlief Marie ein.
Marie stand gerne früh auf, denn Paris schenkte jedem, der es wollte, im Morgengrauen einen Moment, in dem man sich in völligem Einklang mit sich selbst fühlen konnte. Zugleich wurde man aber auch Zeuge des Erwachens einer Stadt, das an das einer Geliebten erinnerte. Darauf folgte das eher prosaische Erwachen der anderen Hausbewohner. Aymerick für seinen Teil ging zu dieser Zeit zu Bett, nachdem er die nachts geleerten Flaschen lärmend in die gelbe Tonne geworfen hatte. Crespin, der alte Widerling aus dem dritten Stock, öffnete sein Badezimmerfenster, damit alle Nachbarn von seinem ersten morgendlichen Wasserlassen etwas hatten. Die Eltern Noémies aus der vierten Etage begannen um diese Zeit mit ihren täglichen kriegerischen Auseinandersetzungen. Währenddessen flüchtete sich ihre Tochter Noémie mithilfe eines Ohrenschutzes, wie er von Bauarbeitern benutzt wird, in wortlose Stille. „Anfangs lieben Kinder ihre Eltern. Nach einiger Zeit urteilen sie über sie. Und selten, wenn überhaupt, vergeben sie ihnen“, schrieb Oscar Wilde. Noémie hatte ihrerseits vergessen, sie zu verurteilen. Sie begnügte sich damit, sie stumm zu ertragen.
Im Halbschlaf tastete Marie nach dem Knopf des Weckers. Sie streckte sich und ließ sich von dem einlullenden Hin und Her eines Staubsaugers in den Schlummer wiegen. Das Geräusch stammte von Rosa, ihrer Nachbarin aus dem Stock über ihr, die stets in den frühen Morgenstunden einen Putzfimmel bekam. Normalerweise ärgerte Marie sich darüber, doch an diesem Vormittag empfand sie den Haushaltslärm als erfrischend. Er passte zu ihrer Hochstimmung: Zwei freie Tage lagen vor ihr, ohne jegliche Verpflichtungen.
Sie strampelte sich die Decke von den Füßen, gähnte und streckte den Arm aus, um an der Schnur der Jalousie vor dem Fenster zu ziehen, die sich direkt über ihrem Kopf befand. Klirrend schnellten die Lamellen nach oben. Draußen war der Himmel klar, doch den beschlagenen Scheiben nach zu urteilen, schien es draußen kalt zu sein.
Sie räkelte sich noch einmal genüsslich, bevor sie aus dem Bett sprang. Ein Bücherstapel, der am Bett lehnte, schwankte und fiel prompt um, sodass sich die Bücher bis zur Schlafzimmertür hin verteilten. Marie zuckte mit den Schultern und stieg über sie hinweg: „Die sammle ich später wieder auf.“ Sie zog sich eine Pyjamahose und ein weißes Baumwolltop an.
In der Küche holte sie Butter, Rhabarberkonfitüre, Toastbrot und Käse aus dem Kühlschrank und vergaß auch nicht, den Teller mit Wurstwaren und ein paar Joghurts mit Vanille- und Schokoladengeschmack für Noémie bereitzustellen. Nachdem sie sich eine Tasse Kaffee eingeschenkt hatte, ging sie wieder ins Wohnzimmer, wo sich weitere Bücherstapel wie eine schulterhohe Wandvertäfelung an die Wände schmiegten. Marie stellte das Tablett mit dem Frühstück auf das Sofa und setzte sich auf den Couchtisch, von wo aus sie Paris und seine Dächer betrachten konnte. Sie stand noch einmal auf, um das Panoramafenster weit zu öffnen. Die Stadt lag an diesem Sonntagmorgen noch ganz ruhig da; nur die Schreie der dänischen oder weißrussischen Lachmöwen, die zur Überwinterung kurzfristig Pariserinnen geworden waren, erklangen in der Stille. Es fehlte nur noch der salzige Geruch, und man hätte sich, wenn man die Augen schloss, am Meer gewähnt. Marie musste bei diesem Gedanken lächeln, bevor sie sich über ihr Frühstück hermachte.
Am Vorabend hatte sie fast nichts gegessen, sondern ihren angesagten Autor versorgt, die jovialen Bemerkungen des Verlegers ertragen und mit den Lesern geplaudert. Neuankömmlinge in ihrem Laden wunderten sich darüber, dass es heutzutage trotz der ganzen E-Books tatsächlich noch eine Buchhandlung gab, die „solide auf beiden Beinen“ stand. Es tat ihnen gut, wieder mit Papier in Berührung zu kommen, die Druckerschwärze zu riechen und ihre Wurzeln wiederzufinden. Marie hatte ihnen lächelnd zugehört, und als sie gefragt worden war, warum sie ausgerechnet den Beruf der Buchhändlerin ausübte, hatte sie schlicht geantwortet: „Bücher sind meine Leidenschaft, und ich liebe es, dass mein Beruf mich daran erinnert, wo ich herkomme.“
Nachdem sie ihr Frühstück verschlungen hatte, brachte sie das Tablett in die Küche zurück und ging ins Bad. Marie genoss es, abwechselnd warm und kalt zu duschen und so ihre Lebensgeister zu wecken. Danach trocknete sie sich ab und wickelte sich ein Handtuch um die Hüften. Bevor sie das Badezimmer verließ, begrüßte sie noch die Orchideen, die dort zur Erholung aufgestellt waren. Vor dem offenen Kleiderschrank zögerte sie einen kurzen Augenblick und entschied sich schließlich für Jeans und einen weißen Rollkragenpullover. Mit ihren nachlässig zusammengebundenen Haaren sah sie aus wie Katharine Hepburn in dem Film Adam’s Rib von George Cukor.
Sie griff nach der Ledertasche, die sie von Samuel geerbt hatte, legte ein kleines Schwarzes hinein, das – wie sie es gern ausdrückte – für alle Geländetypen geeignet war, außerdem ein Paar Stiefeletten und ihre Kulturtasche. Dann schnappte sie sich noch ihren Pyjama und verstaute ihn ebenfalls.
Als sie sich umsah, freute sie sich darüber, dass sie ein kleines bisschen pingelig war. Die einzige sichtbare Unordnung waren die Bücherstapel und die herumliegenden Blätter mit Vermerken, was die Kunden ihrer Buchhandlung gerade lasen.
Sie ordnete die Bücher, die in ihrem Schlafzimmer umgefallen waren, wieder, dann ging sie an ihren Arbeitsplatz und sagte zu den dort aufgeschlagenen Büchern: „Ich habe jetzt noch zwei Stunden Zeit für euch, dann muss ich los!“
Da sie jedoch nicht in der Lage war, sich zu konzentrieren, machte Marie sich nur ein paar Notizen und schrieb dann eine kurze Nachricht für Noémie. Sie legte sie auf den Teller, den sie für sie wieder in den Kühlschrank gestellt hatte:
Meine Hübsche,
genieß die Ruhe. Ich habe die Erstausgabe der Mandarins von Paris von Simone de Beauvoir (1954 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet) neben Phoenix gelegt. Sie hat es ihrem Liebhaber Nelson Algren gewidmet, der Schriftsteller und Kommunist war. Es wird Dir gefallen!
Bis Montag! xx
Marie zog ihren Trenchcoat über, nahm ein Päckchen, das in dickes Papier eingewickelt und mit Hanfschnur zugebunden war, steckte es in die Ledertasche und verließ dann die Wohnung. Im Gang schnappte sie sich ihr Rad und schob es vor die Haustür. Auf der Straße stieg sie auf und tat so, als würde sie es tätscheln wie ein Pferd, indem sie ihm ein paar Klapse auf den Rahmen gab: „Vierundzwanzig Stunden auf dem Land, na los! Lass die Reifen qualmen!“
Während sie die Straßen zum Bahnhof Saint-Lazare hinauffuhr, dachte Marie bei sich, wie sehr sie das alles hier mochte. Es war ihr Alltag, und sie mochte ihn, genau so, wie er war. Sie genoss jeden Moment und lebte ganz im Hier und Jetzt. Ihr Leben bestand aus kleinen Glücksmomenten, die sie hier und da beim Lesen aus den Buchseiten klaubte – und manchmal sogar aus den Gesprächen der Menschen. So, wie es war, war es die absolute Freiheit für Marie.
Am Bahnhof angekommen, stieg sie in den TER Intercités in Richtung Caen. In zwei Stunden wäre sie bei Margaux. Dieser Tag wäre dann perfekt. Das Leben war schön, und wie ihr Großvater so oft gesagt hatte: „Die Liebe zum Leben ist ansteckend.“
2
Marie ließ ihr Fahrrad im Eingangsbereich des Wagons stehen und betrat ein Abteil, in dem bereits fünf weitere Personen saßen. Sie grüßte freundlich, als sie hereinkam. Einige starrten angestrengt auf ihre Schuhspitzen, die anderen beantworteten ihren Gruß mit einem knappen Kopfnicken.
Es war jetzt zwanzig nach zehn, und die Reise dauerte nur zwei Stunden. Nach wenigen Augenblicken machte eine Frau es sich auf ihrem Platz gemütlich und schlief sofort ein. Wahrscheinlich hatte auch sie eine kurze Nacht gehabt. Ein Vater und sein Sohn holten eine Plastiktüte mit belegten Broten hervor. Essen war offensichtlich eine ihrer bewährten Methoden, die Reisezeit totzuschlagen, aber Marie fand insgeheim, sie sollten trotzdem besser die Augen offen halten, so wie sie es tat. Denn die Landschaft, die auf die Menschenmenge am Bahnhof und auf die Hochhäuser der Vorstädte folgte, war wunderschön – die perfekte Kulisse für künftige Tagträumereien. Dann waren da noch eine junge Frau von etwa dreißig Jahren, die die Voici las, und ein älterer Herr im dreiteiligen Anzug, der die Artikel der Tageszeitung Les Echos geradezu verschlang.
Marie beobachtete gern lesende Menschen. Sie verstand es, ihre Stimmungen zu erraten. Ausgehend von dem, was sie lasen, vertrieb sich Marie die Zeit damit, ein Porträt der Beobachteten zu entwerfen. Manchmal begann sie anschließend ein Gespräch mit ihnen, riss sie aus ihrer Lektüre, um herauszufinden, ob sie ihre Launen gut eingeschätzt hatte. Sie gewann dieses Spiel fast immer.
Heute hatte sie darauf allerdings keine Lust, sondern genoss lieber das Gefühl von Leichtigkeit, das die beiden vor ihr liegenden Tage in ihr wachriefen. Sie überließ also die junge Frau ihrem Tête-à-tête mit irgendwelchen Stars und den älteren Herrn seinen Träumen über die Dividenden, die sein Rentenfonds abwerfen würde.
Zwei Stunden von Paris entfernt, eine halbe Stunde von Deauville und fünfundzwanzig Minuten von Caen, erstreckte sich das Pays d’Auge, in dem sich Margaux vor einigen Jahren niedergelassen hatte. Nachdem sie zehn Jahre für die Privatbank Quilvest gearbeitet hatte, schmiss sie alles hin, um im Dorf Beuvron-en-Auge zwischen Meer und Landleben ein Gästehaus zu eröffnen.
Während Marie sich auf ihr Wiedersehen freute, wurde der Zug plötzlich langsamer, bewegte sich schleppend weiter, bevor er vollkommen zum Stillstand kam. Auf die Ansage des Zugbegleiters folgte unzufriedenes Gemurmel der Passagiere: Der Zug würde wegen eines technischen Defekts nicht weiterfahren können, doch es waren bereits Busse unterwegs, um sie alle nach Caen zu bringen.
Marie befolgte die Anweisungen und stieg aus dem Zug aus. Dank der Hartnäckigkeit – oder des Gottvertrauens – des Lokführers befanden sie sich auf dem Bahnhof von Notre-Dame-de-Livaye, der schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr bedient wurde.
Vom Bahnsteig stieg sie auf ein Mäuerchen, wo sie Empfang hatte, und rief ihre Freundin an.
„Verdammt, verflixt und zugenäht! Ich bin nicht mehr zu Hause und ich werde mindestens eine Stunde brauchen, bis ich bei dir bin!“, ereiferte sich Margaux, die sich über diese Unannehmlichkeit offenkundig ärgerte.
„Die Fähigkeit, ausgiebig zu fluchen, hat mich schon immer fasziniert. Es nützt nur rein gar nichts.“
„Aber es verschafft Erleichterung.“
„Hast du denn auch eine Lösung für mein Problem?“
„Klar. Ich habe gerade mit Josh gesprochen, einem Freund, der mit dem Auto kommt und den Abend mit uns verbringt. Er ist irgendwo in der Gegend von Lisieux, also ungefähr fünfzehn Minuten von dir entfernt. Ich schick ihn dir vorbei!“
„Okay. Gibt es irgendwas, woran ich ihn erkennen kann?“
„Du wirst ihn schon erkennen! Küsschen, mein Schatz!“
Margaux legte auf und dachte bei sich, dass das Leben sogar noch besser war, als sie bisher geglaubt hatte.
Marie ging um das Bahnhofsgebäude herum. Es war ein quadratischer Bau aus roten Ziegeln und mit Türen und Fensterläden in einem mittlerweile verblichenen Weiß. Die Natur hatte sich die Umgebung bereits zurückerobert, doch Marie konnte problemlos mit dem Rad fahren: Die Herde aus Reisenden, die vor ihr hier entlanggetrottet war, hatte die hohen Gräser bereits niedergetrampelt.
Die Busse kamen kurze Zeit später an. Marie blieb allein zurück und benutzte ihr Fahrrad als Sitz. Doch sie musste nicht lange warten. Einige Augenblicke später hörte sie das Brummen eines Motors.
An der Wegbiegung erschien ein alter Aston Martin DB5, ein flaschengrünes Cabriolet. Tatsächlich behielt Margaux recht, Marie brauchte keine Beschreibung, um Josh zu erkennen.
Das Auto wendete und blieb direkt vor Marie stehen. Die Fahrertür öffnete sich, und Josh schälte sich aus dem Sitz: eins fünfundachtzig, kastanienbraunes Haar und helle Augen.
„Marie?“
Er kam mit ausgestreckter Hand auf sie zu. Marie ergriff sie. Bei der Berührung spürte sie etwas, das sie schon fast vergessen hatte, die Art von Gefühl, die größer ist als man selbst, die einen überrumpelt und alle Pläne über den Haufen wirft. Der Mann stellte sich vor.
„Hallo. Ich heiße Josh.“
„Ist das eine Abkürzung?“
Die Bemerkung überraschte ihn, doch er ließ sich nichts anmerken.
„Nein. Ich heiße seit meiner Geburt Josh.“
„Ich bin Marie. Freut mich.“
„Ganz meinerseits.“
Ihnen wurde bewusst – und es war ihnen ein bisschen peinlich –, dass sie die ganze Zeit über die Hand des anderen festgehalten hatten. Maries Lächeln schwand dahin, als Joshs Blick auf ihr Fahrrad fiel. Er ging um das Auto herum, beugte sich in den Innenraum und löste die beiden Riegel, die das Dach befestigten. Dann schlug er mit einer routinierten Handbewegung das Verdeck zurück.
Gemeinsam verstauten sie das Fahrrad auf der Rückbank.
„Ich hoffe, es beschädigt nicht das Leder der Sitze“, murmelte Marie verlegen.
„Das Auto hält einiges aus!“, beruhigte sie Josh.
„Es ist dasselbe Modell wie in Goldfinger, stimmt’s?“
„Ja“, bestätigte Josh und schaute zum Himmel. „Glücklicherweise regnet es nicht, sonst hätten wir eine dieser Erfindungen von James Bond gebraucht, ein Auto mit Schwimmbadfunktion!“
Nachdem er sich ans Steuer gesetzt hatte, öffnete Josh das Handschuhfach, zog zwei Mützen hervor und hielt Marie eine davon hin. „Für eine Cabriofahrt im Oktober sind wir vielleicht ein bisschen zu leicht angezogen.“
Amüsiert setzte Marie sich die Mütze auf, und Josh ließ den Motor an. Sie musterte ihn aus dem Augenwinkel. Mit der Mütze sah er gleich ein bisschen weniger nach Sean Connery aus.
Einige Minuten später erreichten sie mit dem Aston Martin ein Dorf.
„Notre-Dame-de-Livaye im Calvados. Hundertdreißig Einwohner. Die höchste Bevölkerungsdichte wurde 1831 mit einhundertvierundsiebzig Einwohnern erreicht, die niedrigste 1921 mit achtundachtzig“, erklärte Marie.
„Sind Sie von hier?“, fragte Josh, der sich offensichtlich über die detaillierten Informationen wunderte.
„Nein. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Beansprucht übrigens ziemlich viel Platz im Kopf.“
„Ist aber in diesem Fall auch ziemlich praktisch!“
An der Dorfausfahrt erhob sich eine kleine Kapelle.
„Haben Sie Lust auf eine Besichtigung?“, schlug Josh vor.
„Kommen wir dann nicht zu spät?“
„Margaux verspätet sich doch auch immer.“
„Da haben Sie recht. Es wird gar nicht auffallen, wenn wir gemeinsam mit ihr zu spät kommen“, bestätigte Marie.
Josh stoppte den Wagen.
Als sie ausstiegen, zeigte Marie auf ihr Fahrrad: „Ist das sicher?“ Sie war stets um die Sicherheit ihres Fahrrads besorgt.
Josh drehte den Kopf langsam von rechts nach links. „Kein Dieb in Sicht“, antwortete er belustigt. „Beim Durchschnittsalter der Einwohner in diesem Kaff bin ich außerdem ziemlich zuversichtlich, dass ich einen Dieb ohne größere Anstrengung erwischen würde.“ Maries sorgenvolle Miene erheiterte ihn offensichtlich weitaus mehr als seine eigene Schlagfertigkeit.
Josh drückte die schwere Holztür der Kapelle auf. Die Bewegung wirbelte Staubpartikel auf, die in den hereinfallenden Sonnenstrahlen wie Glühwürmchen aufleuchteten. Müde von ihrem Flug schienen sie in der Luft zu verharren. Im Inneren war die kalte Luft von einem modrigen Geruch erfüllt.
Josh ging weiter voran. Marie beobachtete ihn reglos und atmete kaum. Er wirkte abwesend, ganz von der Umgebung in den Bann gezogen. Eine Abfolge von Säulen trug das Dach in Y-förmigen Konstruktionen mit Halteseilen, Querbalken und Sparren aus Eichenkernholz. Die Türstürze waren mit Holzlatten verkleidet. Alles zusammen wirkte wie ein umgedrehter Schiffsrumpf. Leere Nischen für Heiligenfiguren wechselten sich mit Stellen an den Wänden ab, an denen der Putz stark abbröckelte, sodass oft nur noch das Mauerwerk vorhanden war. Die Falten im Schleier einer Madonnenfigur waren verwittert. Darunter warf die Muttergottes aus ihrem rechten Auge, um das ein verwittertes Veilchen thronte, einen mitleidigen Blick auf die umgedrehten Kirchenbänke von unbestimmtem Alter. Die Atmosphäre hier war auf angenehme Weise schaurig.
„Großartig“, murmelte Josh unwillkürlich.
Marie sah auf und blickte in dieselbe Richtung wie er. „Doch wohl eher kahl und verlassen“, erwiderte sie zweifelnd und zog eine Grimasse. „Also, für mich sieht das wie das Bild einer Flucht aus.“
Josh machte auf dem Absatz kehrt und schraubte die Arme in die Höhe. Er schien glücklich zu sein. „Es ist doch die perfekte Kulisse für den Beginn einer wunderbaren Geschichte!“
Marie drehte den Kopf leicht zur Seite, um ihre Verlegenheit zu kaschieren. Die Äußerung Joshs schien ihr doch ziemlich gewagt vor dem Hintergrund, dass sie sich kaum kannten. War er einer dieser Aufschneider, die sich ihrer Wirkung auf andere gewiss waren? Oder fühlte er wie sie diese nahezu übernatürliche Kraft, der sie an diesem Ort nicht ausweichen konnte? Marie befürchtete einen Moment lang, die Fassung zu verlieren, und zuckte zusammen. Diese kaum wahrnehmbare Bewegung entging Josh nicht und katapultierte ihn zurück in die Realität.
„Ähm . . . ich bin Drehbuchautor . . . ich meine natürlich den Anfang eines wunderbaren Films . . .“
„Ah, äh, ach so . . . ja, natürlich . . . “
Dieses Missverständnis beendete die Besichtigung abrupt und trieb die beiden zurück zum Auto.
Um wieder eine weniger angespannte Atmosphäre zu erzeugen, fiel Marie nichts Besseres ein, als wahllos Themen anzuschneiden, die ihr Gedächtnis ihr lieferte. „Die Route Nationale Nummer 13 ist 338 Kilometer lang und verbindet Paris mit Querqueville. Zum Glück leiden wir nicht an Triskaidekaphobie.“
„Was ist das denn?“
„Die Angst vor der Zahl 13. Außerdem bringt die 13 nicht nur Unglück. Sie bezeichnet auch die Anzahl der Mondzyklen in einem Jahr, die Ordnungszahl von Aluminium, das Departement Bouches-du-Rhône und die Dauer der aztekischen Woche . . . “
Josh hörte ihr höflich zu und brach das folgende Schweigen nur, um sich dafür zu entschuldigen, dass sein Auto aufgrund des Alters kein Radio besaß. Er hatte jedoch keine Lust, es zu modernisieren, denn das würde ihn des Motorengeräuschs während seiner Ausflüge berauben. „Sie ist eine Großmutter, daher können wir leider weder Josephine von Chris Rea noch The Power of Love von Huey Lewis and The News hören.“
„Woher wissen Sie das?“, fragte Marie verblüfft, dass Josh diese persönliche Marotte von ihr kannte.
„Margaux hat mir von Ihrem ›musikalischen Ritual‹ erzählt.“
„Und . . . was hat sie Ihnen denn sonst noch so erzählt?“
Josh drehte den Kopf leicht in Maries Richtung und lächelte. „Nichts.“
„Seit wann kennen Sie Margaux überhaupt?“
„Seit etwas über drei Jahren, aber sie hat mich Ihnen gegenüber wahrscheinlich nie erwähnt. Ich habe die letzten beiden Jahre im Ausland verbracht.“
„Wegen eines Filmprojekts?“
Josh konzentrierte sich auf die Straße. Als er sich seines Schweigens bewusst wurde, sah er Marie wieder an. „Ja.“
Marie entdeckte in den betörend hellen Augen Joshs, wie sehr ihn dieses Thema aufwühlte. Also hielt sie sich trotz fehlender Gewissheit an das Prinzip der Vorsicht, indem sie schnell das Thema wechselte und bis nach Beuvron-en-Auge lieber wieder eine banale Anekdote an die nächste reihte.
Das Dorf stand auf der offiziellen Liste der schönsten Dörfer Frankreichs. Josh und Marie fuhren an der Markthalle, dem Herrenhaus aus dem 15. Jahrhundert und dem historischen Gasthof zur Goldenen Kugel vorbei, der am Fuße der Kirche Saint-Martin lag. Jedes Jahr fand an diesem letzten Oktoberwochenende das Fest des Cidre statt, und Margaux hatte die gute Idee gehabt, ausgerechnet Ende Oktober zur Welt zu kommen.
Das Auto wurde langsamer und bog dann in einen unbefestigten Weg ein. Rechts und links befanden sich zahlreiche Spurrillen und in der Mitte ein langer, erhöhter Grasstreifen. Das Knirschen der kleinen Steinchen unter dem Fahrzeug schien den Fahrer nicht weiter zu stören.
Am Ende des Weges tauchte ein L-förmiges Fachwerkhaus auf, das aus dem 17. Jahrhundert stammte. Vor jedem Fenster der beiden Stockwerke blühten granatrote Geranien. Nur vor den beiden Dachgauben, die sich inmitten des riesigen Schieferdachs verloren, fehlte jede Blumendekoration. Der Hof war gepflastert und eine Allee, die von beschnittenen Bäumen und blauen Hortensien gesäumt war, führte zu einem Teich, um den herum wilde Natur herrschte. Margaux hatte das alte Gemäuer also tatsächlich in ein Gästehaus verwandelt.
Josh parkte gerade das Auto, als die Besitzerin schon aus dem Haus trat: „Hallo, meine Lieben!“
Nach den üblichen Begrüßungsküsschen und als Josh ihnen den Rücken zudrehte, um Maries Fahrrad aus dem Aston Martin zu laden, nutzte Margaux die Gelegenheit und fragte ihre Freundin lautlos, dafür umso wilder gestikulierend, ob ihr der behelfsmäßige Chauffeur denn gefiel. Als Antwort erntete sie nur ein breites Lächeln und ein Schulterzucken.
In der Küche mischten sich verschiedene Düfte: Auf dem Holztisch standen ein Teller mit Fleisch und Wurst, Käse aus der Region und einige für das Calvados typische Desserts. Und am Rand, wo noch Platz auf dem Tisch war, hatte Margaux alles für einen Aperitif aufgebaut.
„Ein kleiner Schluck zum Mittag als Begrüßung, was haltet ihr davon?“, lud die Gastgeberin sie ein.
„Perfekt“, antwortete Josh und stellte seine Reisetasche am Fuß der Treppe ab, die ins obere Stockwerk führte.
Marie schenkte drei Gläser Wein ein und erhob dann das ihre. „Auf dich, Margaux! Auf dass es ein wundervoller Geburtstag wird!“
„Das wird er bestimmt“, ergänzte Josh.
„Mit Freunden wie euch glaube ich das sofort. Außer ihr behaltet noch eine Minute länger diese furchtbaren Mützen auf!“
Somit war klar, wie es für den Rest des Wochenendes weitergehen würde: mit Humor, augenzwinkernder Verbundenheit, mit gutem Wein und gutem Essen.
Marie zog in das blasslila Zimmer ein, Josh in das blaue. Das gelbe war für Margaux’ Eltern vorgesehen, die ebenfalls bald ankommen würden. Die Suite war schlauerweise für die temperamentvolle Spanierin Sylvia und ihren Mann Jérôme reserviert worden, Freunde von Margaux aus Barcelona. Diese besondere Aufmerksamkeit würde vielleicht helfen, die Spannungen zu mildern, die zwischen dem Paar im Moment herrschten. Zumindest hoffte Margaux darauf.
Das blaue und das blasslila Zimmer lagen einander gegenüber.
Während Marie ihre Tasche ausräumte, erklang Margaux’ Stimme vom Fuß der Treppe her: „Meine Eltern sind da!“
Marie sauste die Stufen hinab. Sie freute sich, Gustave und Yvette wiederzusehen. Sie hatten ihr gegenüber oft die Elternrolle eingenommen, vor allem während der letzten zehn Jahre, seit dem Tod von Maries Großvater. Ihre eigenen Eltern waren beide bereits mit einer sehr ausgeprägten Lähmung elterlicher Gefühle zur Welt gekommen. Marie war ihnen deshalb nie böse gewesen. Sie hatten ihre Tochter zwar im Stich gelassen und sich nur für den Ehepartner interessiert, doch aufgrund dieser egoistischen Aufteilung ihrer Liebe feierten sie immerhin bald ihren fünfundvierzigsten Hochzeitstag.
Als Josh kurz nach ihr herunterkam, umarmte Yvette ihn mütterlich. Gustave tätschelte ihm seinerseits sanft und aufmunternd die Schulter. „Hallo, mein Großer! Hältst du die Ohren steif?“
„Lass ihn in Frieden, Gustave. Heute wollen wir nicht in der Vergangenheit wühlen!“, wies Yvette ihn zurecht und warf ihm einen scharfen Blick zu.
„Ist schon gut, Yvette, es geht mir gut, mach dir keine Sorgen“, beschwichtigte Josh und zerstreute so die Peinlichkeit, die die Frage hätte erzeugen können.
Marie begriff instinktiv das Unausgesprochene dieses Wortwechsels, ohne die Details zu verstehen, doch vor allem nahm sie Joshs Lüge wahr: Nein, es ging ihm nicht gut. Aber warum? Sie hatte keine Ahnung, doch wie Yvette schon gesagt hatte: Heute stand dieses Thema nicht auf der Tagesordnung.
Ein Ablenkungsmanöver Margaux’ erlaubte es allen, sich wieder zu berappeln. „Okay, Mama, du hilfst mir bitte in der Küche. Papa, du bringst die Flaschen aus dem Keller herauf. Und Josh und Marie, die Betten müssten noch bezogen werden.“
Beim dritten Bett, das sie routiniert mit aufeinander abgestimmten Bewegungen bezogen, brach Josh schließlich das Schweigen. Marie war erleichtert, denn sie war seit dem ersten Bett unglaublich darum bemüht, sich Josh gegenüber trotz der ihr unbekannten Umstände richtig zu verhalten. Vor allem aber strengte es sie furchtbar an, die Wirkung zu überspielen, die der Mann neben ihr auf sie ausübte.
„Es tut mir leid.“
„Was tut Ihnen leid, Josh?“
„Es tut mir leid, dass ich ein wenig geistesabwesend bin . . . Ich bin sicher, dass sie über mich wacht.“
Marie verstand instinktiv, wovon er sprach. Josh redete über den Verlust einer geliebten weiblichen Person – einer Frau, einer Mutter, einer Tochter? Ihr fiel nichts Besseres dazu ein als ein Zitat Victor Hugos, um dem Mann ihr gegenüber die Verlegenheit zu nehmen. „Die Toten sind vielleicht unsichtbar, aber sie sind nicht verschwunden . . . “
Josh lächelte überrascht. Dieser Augenblick intimer Vertrautheit auf dem Treppenabsatz eines Hauses in der Basse Normandie schien ihm auf seltsame Weise gutzutun. Vielleicht, schoss es ihm für den Bruchteil einer Sekunde durch den Kopf, war er bereit, wieder Vertrauen zu fassen, sein Herz zu reinigen, um aufs Neue die Gefühle eines anderen Menschen einzulassen. Bei diesem Gedanken konnte selbst sein Dreitagebart nicht verbergen, wie er rot wurde.
Marie verließ das Zimmer und ging zur Treppe, als wäre nichts geschehen. Sie war glücklich, dass auch Josh durch ihre Anwesenheit verwirrt wurde, denn ihr erging es mit ihm nicht anders. Lächelnd drehte sie sich noch einmal zu ihm um. „Ich glaube, die anderen warten unten schon auf uns.“
Im Wohnzimmer saßen Yvette und Gustave Jérôme und Sylvia gegenüber. Auch wenn Yvette sich bemühte, ebenso höfliche wie unverfängliche Konversation zu betreiben, war die Stimmung wie elektrisch aufgeladen. Die Spannungen zwischen diesem Paar, das sich gezwungenermaßen in ein und demselben Raum aufhalten musste, waren fast mit Händen zu greifen. Gut möglich, dachte Marie, dass Jérôme und Sylvia tatsächlich am Ende ihrer gemeinsamen Geschichte angelangt waren. Jérôme atmete nur noch für und durch Sylvia. Es war seine Art, auf Freiheit zu verzichten. Dieser Mangel an Selbstständigkeit erstickte seine Frau. Für sie war das Leben etwas, das heiß gegessen wurde, das man unbedingt genießen musste und das man immer als Drama inszenierte. Jérôme war offensichtlich nicht in der Lage, diese tiefen und echten Bedürfnisse seiner Frau zu verstehen.
In der Küche schnappte Josh sich das Tablett mit den Gläsern, Margaux nahm die Flasche Chardonnay und Marie den Teller mit den Vorspeisen.
„Es ist ein bisschen gemein, aber ich kann es kaum erwarten, bis Gustave Sylvia gegenüber in ein Fettnäpfchen tritt. Das könnte lustig werden.“
„Stimmt schon, mein Vater lässt üblicherweise keins aus, aber . . . “
„Wie wahr“, mischte Josh sich ein bisschen zu vorschnell ein.
Margaux blieb wie angewurzelt an der Küchentür stehen, drehte sich um und musterte ihren Freund.
„Alles gut, Margaux, alles in bester Ordnung“, beruhigte sie Josh, der die zweite Hälfte des Satzes langsam und gedehnt sprach.
Wegen dieser Angewohnheit, Sätze in die Länge zu ziehen, wenn ihm etwas wichtig war, wusste sie, dass er ernst meinte, was er sagte.
Margaux hatte ein Salzlamm zubereitet. Josh genoss sichtlich den feinen Geschmack dieses Gerichts.
„Das Fleisch stammt von Lämmern, die auf den Wiesen in der Bucht vor dem Mont-Saint-Michel grasen, das verleiht ihnen den Jodgeschmack“, erklärte Yvette genießerisch.
„Ich habe es nach einem mittelalterlichen Rezept aus dem Viandier zubereitet, von mir übertragen in die heutige Zeit. Es war zu fett und sehr stark gewürzt.“
„Für Worterläuterungen zum Viandier könnt ihr übrigens unsere Gedächtniskünstlerin fragen“, unterbrach Gustave seine Tochter und zeigte mit der Spitze seines Messers auf Marie.
Nach dem gemeinsamen Bettenmachen hatten Josh und Marie es vermieden, allein im selben Raum zu sein. Auch wenn sie ganz besonders zu strahlen schienen, sobald sie sich in der Gegenwart des jeweils anderen befanden, führte die Unterstellung eines zaghaften Flirtversuchs, den Margaux und Yvette zwischen den beiden wahrgenommen haben wollten, nur dazu, dass Josh sich in sich selbst zurückzog und Marie in eine beinahe lächerliche Unbeholfenheit verfiel.
Marie ergriff also leicht stammelnd das Wort: „Der . . . der . . . Vian . . . der Viandier wird als das älteste Kochbuch mit französischen Rezepten angesehen. Er wurde im Auftrag Karls des Fünften verfasst, also noch vor 1380, und zwar von einem Normannen namens Guillaume de Tirel, der auch Taillevent genannt wurde.“
„Daher stammt auch der Name des berühmten Pariser Restaurants“, fügte Margaux hinzu.
„Und du besitzt ein Exemplar davon?“, fragte Jérôme seine Gastgeberin interessiert.
„Nein, ich habe mir das von Marie kopiert.“
„In meiner Buchhandlung habe ich ein Exemplar der letzten Ausgabe von 1604.“
„Die Geschichte dieses Kochbuchs, eingebettet in seinen historischen Kontext. Würde sich sicherlich gut für eine Verfilmung eignen“, überlegte Josh.
„So wie der Film über François Vatel?“, fragte Sylvia.
„Genau“, antwortete Josh, der glücklich darüber war, dass sich Sylvia endlich an der Unterhaltung beteiligte.
Sylvia hatte sich während des Essens entspannt, auch wenn sie es nicht lassen konnte, ein paar Spitzen in Richtung Jérôme abzufeuern. Da er sie liebte, befahl ihm sein Instinkt vom allerersten Tag an, ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Auf lange Sicht hatten die wiederholten Aufmerksamkeiten ihres Mannes Sylvia in einem goldenen Käfig eingesperrt.
Dieser Freiheitsentzug führte spätestens, als das Dessert aufgetragen wurde, zum explosionsartigen Anstieg ihrer giftigen Bemerkungen, doch niemand ging darauf ein, damit sich die Stimmung nicht unnötig verschlechterte.
Yvette hatte die achtunddreißig Kerzen des Kuchens angezündet, und Gustave entkorkte den Champagner, woraufhin sich Margaux entschied, dem vergangenen Jahr Lebewohl zu sagen, und auf die kleinen Flammen blies. Josh schenkte Margaux eine Box mit Filmen von Georges Méliès. Weil er die eifersüchtige Reaktion seiner Frau fürchtete, traute Jérôme sich kaum, Margaux sein Geschenk zu überreichen: einen Swarovski-Anhänger. Doch Sylvia zuckte nicht einmal mit der Wimper. Marie zog ihr Geschenk hinter einem Kissen hervor: Die Geschichte des Gästehauses, eine Ausgabe aus dem 19. Jahrhundert. Gustave und Yvette hatten sich das Recht ausbedungen, ihr Geschenk im intimen Kreis der Familie zu übergeben.
Mittlerweile fiel es nicht nur Margaux und Yvette auf, dass Marie und Josh sich verstohlen musterten. Wenn sich ihre Blicke kreuzten, wurden sie von einer Schüchternheit ergriffen, die die Entfernung zwischen ihnen überbrückte und sie dazu zwang, sofort die Köpfe zu senken. Samuel hatte oft zu Marie gesagt, dass man das Glück nicht immer gleich erkannte, wenn es vor einem stand. Was stand hier vor ihr? Das Glück? Josh für sein Teil unterdrückte, so gut es ging, das Lächeln, das auf seinem Gesicht erscheinen wollte, sobald Marie etwas sagte. Ihre ein Meter siebzig, ihre sanften Kurven und ihre kastanienbraunen Haare öffneten Türen und Fenster in ihm, die lange verschlossen gewesen waren. Doch auch wenn er tief in seinem Innersten spürte, dass so eine Öffnung tatsächlich möglich war, konnte er nicht daran denken, ohne sich sofort schuldig zu fühlen.
Margaux schlug vor, einen Spaziergang zu machen, bevor sie sich gemeinsam zum Fest des Cidre aufmachen würden, das um halb sieben begann. Jérôme wollte lieber zu Hause bleiben und gab vor, genau wie Gustave einen Mittagsschlaf halten zu wollen.
Die Landschaft war noch grün, das Wetter war mild und der Himmel wolkenlos. Unterwegs sammelten sie ein paar störrische Brombeeren ein, die von der Kälte noch nichts wissen wollten.
Sylvia ging neben Josh her. Hinter ihnen erzählten sich Margaux und Marie gegenseitig ihre gemeinsamen Erinnerungen an Samuel.
„Hast du dich niemals gefragt, warum Samuel dir die Buchhandlung vermacht hat?“
„Vielleicht wollte er mir etwas hinterlassen, was mir Halt gibt, und mich gleichzeitig ein wenig zur Ordnung rufen: ›Du wirst dein Leben anderen widmen, ihrer Suche nach den Worten, um den Kunden irgendwann in den Rang eines Lesenden zu erheben‹“, imitierte Marie den Tonfall Samuels. „Eine Art Mission: Damit ich ihnen helfe, ihre Träume, ihre Ideale, ihre Freiheit zu finden.“
„Verdammt noch mal! Wenn es das war, was dein Großvater im Sinn hatte, war er wirklich ehrgeizig. Und du, findest du dich in all dem wieder?“
Marie lächelte. Sie liebte ihren Beruf, ihre Kunden, ihr Erbe. Sie liebte den Gedanken, eine Art Fortsetzung Samuels zu sein.
Vor ihnen hakte Sylvia sich bei Josh unter. Diese kleine Geste brachte Marie unerwartet aus der Fassung. Ihre Miene verdüsterte sich, und sie hatte plötzlich einen Kloß im Hals. Sie versuchte, sich einzureden, dass es Schicksal sei, wenn Josh Sylvia ihr vorziehen würde, verheiratet hin oder her.
„Gib nicht auf, Marie“, flüsterte Margaux ihr genau in diesem Augenblick ins Ohr.
„Wovon sprichst du?“
„Seit wann glaubst du, dass ich blind bin?“
„Offensichtlich habe ich die richtige Autobahnauffahrt mit ihm verpasst, und was die Dame da vor uns betrifft, da wissen wir doch, was uns blüht“, antwortete Marie mit starrem Blick auf die beiden Spaziergänger vor ihnen.
„Was blüht dir denn, meine Liebe?“, mischte Yvette sich ein, die zu ihnen aufgeschlossen hatte.
„Sie hat in Bezug auf Josh den Anschluss verpasst“, erklärte Margaux.
„Lieben heißt bauen, nicht verbrauchen“, warf Yvette ein und wies mit dem Kinn auf Sylvia. „Also los, richte die Baustelle ein! Und lass ihn dir nicht von dieser verheirateten Frau oder von sonst wem vor der Nase wegschnappen, in Ordnung?“
„Die Botschaft ist angekommen, Mama.“
„Ich rede nicht mit dir, Margaux“, erwiderte sie und hakte sich bei den beiden jungen Frauen unter.
„Wo ist eigentlich Claudie?“, fragte Marie, um von sich abzulenken.
„Meine liebe Tochter hier hat sich entschieden, mit ihrer Partnerin eine Pause einzulegen, wie man heute so schön sagt. Kannst du dir das vorstellen? Zehn Jahre in einer Beziehung mit Claudie, und jetzt braucht sie eine Pause! Wozu soll das gut sein?“
„Geht das schon wieder los . . . “, flüsterte Margaux und schützte eine genervte Müdigkeit vor. „Außerdem war es nicht meine Idee, Claudie wollte diese Pause.“
Josh drehte sich zu ihnen um, und sein Blick traf wie von einem Magneten angezogen auf Maries. Sie spürte, wie ihr die Knie weich wurden, und Josh musste einmal tief durchatmen, um sich eines plötzlichen Schwindelgefühls zu entledigen. Er wollte unbedingt jeden Hinweis auf die Anziehungskraft verwischen, die Marie auf ihn ausübte. Doch Margaux erkannte noch etwas in seinen Gesichtszügen: Er stieß einen stummen Hilferuf aus, um von Sylvia erlöst zu werden.
„Wartet auf uns!“, rief sie ihnen zu.
Um Josh aus Sylvias Klauen zu befreien, beschleunigten die drei Frauen ihren Schritt und schlossen zu ihnen auf.
„Es ist schon sieben Uhr. Ich denke, Jérôme und Gustave erwarten uns bereits auf dem Fest. Es wird Zeit, dass wir hingehen, oder?“, schlug Josh vor. Die Aussicht, Sylvia loszuwerden, erheiterte ihn sichtlich.
Der Dorfplatz war von Fachwerkhäusern mit Blumenkästen vor den Fenstern eingerahmt, aus denen die unvermeidlichen roten Geranien herabflossen. An einigen Ständen luden die Bauern und Winzer aus der Gegend die Anwohner dazu ein, Äpfel auszupressen. Dabei trugen die Männer Tracht: einen langen marineblauen Überwurf, unter dem ein weißes Hemd hervorschaute, ein rotes Halstuch, eine dunkle Hose mit Karomuster und Holzschuhe an den Füßen. Die Frauen bedeckten ihre Haare mit einer Haube und hatten zu ihrem Kleid mit Blumenmuster einen Schal um die Schultern gelegt. Andere Verkäufer mit Produkten aus der Region boten Teurgoule zur Verkostung an, ein normannisches Dessert aus dem 15. Jahrhundert, dessen Basis aus mit Zimt gewürztem Milchreis bestand. In der Mitte des Platzes waren ein Tanzboden und ein Podest für die Dorfkapelle errichtet worden. Bunte Lichterketten hingen zwischen den Bäumen. Die Cafés hatten wieder Stühle auf ihre Terrassen gestellt.
Als die Kapelle zu spielen begann, erhob sich Gustave und forderte Yvette förmlich auf, mit ihm zusammen eine traditionelle Gigouillette zu tanzen. Die Stimmung war ausgelassen, fast so, als würden sich Kinder amüsieren. Von der Atmosphäre angesteckt forderte Margaux Jérôme zum Tanz auf. Nur Marie schien der erleichterte Blick Sylvias aufzufallen. Doch seltsamerweise hatte Erleichterung bei dieser Frau einen siamesischen Zwilling: die Eifersucht. Sie ließ ihren Ehemann nicht aus den Augen.
Josh war erleichtert über die Gunst des Augenblicks, der Aufmerksamkeit seiner hartnäckigen Verehrerin für einen Moment zu entgehen. Er drehte den Teller mit Austern herum, sodass Marie, die ihm gegenübersaß, sich leichter bedienen konnte, und begann, sie auszufragen.
„Was machen Sie eigentlich beruflich, Marie?“
„Ich bin Buchhändlerin und habe mich auf antiquarische Bücher spezialisiert.“
„Macht Ihnen das Spaß?“
„Ja. Die Buchhandlung gehörte meinem Großvater. Ich habe sie bei seinem Tod geerbt.“ Marie ergriff die Cidre-Flasche, um ihnen beiden einzuschenken.
Das Wort „Tod“ erregte wie ein Gong die Aufmerksamkeit von Sylvia, die, ohne den Blick von ihrem Mann zu lösen, gleichwohl nicht von ihrer Zielperson abließ: „Wie ist es denn eigentlich so, Witwer zu sein, Josh?“
Von der Frage überrascht, schüttete Marie den Cidre neben die Gläser.
Josh presste die Kiefer aufeinander: „Es lässt eine Leere zurück . . . Hélènes Tod hat eine Leere hinterlassen.“
Sein Gesichtsausdruck verhärtete sich. Diese Frau, die er erst seit wenigen Stunden kannte, hatte gerade sein trauerndes Herz verletzt – und sich ganz sicher zugleich jede Chance bei ihm verdorben.
„Ich persönlich glaube, dass ich Jérôme beweinen würde, allerdings nur öffentlich“, fuhr die Spanierin fort.
Marie wischte ungeschickt den verschütteten Cidre auf. Sylvias Herabsetzung des Verlustes eines geliebten Menschen auf ein paar zur Schau gestellter Tränen, die nur Mitgefühl erregen sollten, erzeugte in ihr einen dumpfen Zorn. Auch sie hatte jemanden verloren: ihren Mentor, ihren Freund, ihren Vertrauten. Niemand dürfte den Tod Samuels auf ein paar Tränen reduzieren. Doch wie so oft schluckte Marie ihren Ärger herunter und wechselte das Thema. „Und an welchem Projekt arbeiten Sie gerade, Josh?“
Mit starrem Blick bedankte er sich bei ihr durch ein leichtes Nicken. „Ich recherchiere gerade zu den Geisterbahnhöfen der Pariser Metro. Ich würde gern eine Geschichte schreiben, die vor diesem Hintergrund spielt. Oder mir von diesem Hintergrund eine Geschichte erzählen lassen.“
Er rückte mit seinem Stuhl näher an Marie heran. Er hatte das dringende Bedürfnis, zwischen sich und Sylvia einen symbolischen Graben zu erzeugen. Da diese Geste sie zu einer einfachen Statistin degradierte, stand sie vom Tisch auf und begab sich zum Rand der Tanzfläche.
„Wie lange dauert es denn, bis aus so einer Idee ein Film wird?“
„Im günstigsten Fall kann ich Sie in zwei Jahren zur Vorpremiere einladen.“
„So lange?“
„Manchmal sogar noch länger. Frankreich bekommt immer mehr Ähnlichkeit mit Bulgarien. Dort siedelte in der Antike das reiche Volk der Thraker, deren Gebiet sich über den größten Teil Europas erstreckte. Heute ist nichts mehr davon übrig außer gefüllten Weinblättern, einer bestimmten Sorte Joghurt und einem Chor, der sich ›Das Geheimnis der Bulgarischen Stimmen‹ nennt.“
„Jetzt übertreiben Sie aber.“
„Keineswegs. Noch ein paar Jahre und von unserem Land ist nichts mehr übrig als die Garde Républicaine – ohne Pferde wohlgemerkt – und das Baguette. Die besten Köpfe haben sich dann ins Ausland davongemacht.“
„Um dieses Schicksal abzuwenden, sollten Sie bei mir in der Buchhandlung vorbeikommen. Ich glaube, ich habe einige alte Bücher zu Ihrem Metro-Thema. Und auch eine Karte. Vielleicht hilft Ihnen dieses Material ja weiter?“
„Sehr gern“, bedankte sich Josh. Maries aufrichtige Anteilnahme rührte ihn, jedoch weitaus weniger als die verloren geglaubten Gefühle, die sie in seinem Innersten wachrief.
„Gern geschehen! Oder: Bienvenue!, wie man in Quebec zu sagen pflegt“, rief sie, um ihre eigene Bewegtheit zu überspielen.
Später am Abend verließen Gustave und Yvette die Tanzfläche mit schmerzenden Füßen und schlugen vor, nach Hause zu gehen. Margaux ließ Jérôme und Sylvia bei einer Grundsatzdiskussion allein sitzen und kam zu Josh und Marie herüber. „Wollt ihr noch bleiben?“
„Oh, ich denke, ich habe für heute genug von Drehleiermusik“, antwortete Marie.
„Und ich habe genug von Austern“, ergänzte Josh. „Gustave hat irgendwas von Calvados-Verkostung gesagt, also . . . “
„Und die beiden dahinten? Was machen wir mit ihnen?“, fragte Marie und nickte in Richtung von Sylvia und Jérôme.
Margaux sah traurig zu ihnen hinüber. „Ich glaube, das kann man vergessen, es ist vorbei. Ich hatte geglaubt, dass ein gemeinsames Wochenende in anderer Umgebung sie vielleicht wieder einander näherbringen würde, aber da habe ich mich wohl getäuscht.“
„Also los, die Damen, ich begleite euch“, bot Josh an und umschlang beider Schultern mit seinen langen Armen. „Und wir machen uns ganz heimlich aus dem Staub; immerhin habe ich die beiden schönsten Frauen des ganzen Dorfes als Begleitung und möchte nicht, dass die anderen eifersüchtig werden.“
Die kühle Nachtluft roch nach Äpfeln, und sie schlenderten unter dem schwarzen Himmel durch die Straßen von Beuvron. Der Klang der Drehleier begleitete ihr Lachen den ganzen Nachhauseweg über, und Marie genoss das Gefühl von Joshs Hand auf ihrer Schulter, eine Hand, mit der er sie ganz instinktiv an sich drückte.
Im Wohnzimmer hatte Gustave bereits eine Flasche Calvados von Christian Drouin herausgeholt, der Nummer zwei der hundert besten Spirituosen, wenn man alle Kategorien zusammennahm. Er servierte das Getränk in fünf schlanken Gläsern, um die Aromen besser zu konzentrieren. Dann begann er mit seinem Lehrgang zur richtigen Verkostung.
„Zuerst: das Auge“, sagte er und hob das Glas auf Augenhöhe, um die Mahagonifärbung, die Brillanz und die Klarheit der Flüssigkeit zu würdigen.
Josh nahm sich sein Glas, nachdem er im Kamin Feuer gemacht hatte. Auch die anderen erhoben ihre Gläser und widmeten sich ganz diesem Moment der Alkoholbegutachtung unter Anleitung.
Gustave kam gleich zum zweiten Punkt. „Dann folgt der erste Geruchseindruck. Dafür nimmt man aus seinem Glas einen tiefen Atemzug – aber Vorsicht! Nicht schwenken! . . . Birne und Apfel, Walnuss und geröstete Haselnuss . . . “
„ . . . und gerösteter Kaffee, oder?“
„Sehr gut, Marie!“
Alle waren ganz in diesem Entdeckerspiel gefangen. Nur Yvette konzentrierte sich weiter voller Bewunderung auf ihren Gustave.
„Schokolade?“, versuchte es Margaux.
„Ja.“
„Lakritz“, stellte Josh fest.
„Perfekt! Und nun lässt man das Glas kreisen, um die Tropfen zu betrachten, die sich am Glas bilden, und um zu beobachten, wie sich das Licht in ihnen bricht. Aber es geht auch darum, den Calvados atmen zu lassen, damit man sämtliche Duftnuancen aus ihm herauskitzelt.“
Alle folgten den Anweisungen, amüsiert von der Geste und gebannt von dem Farbenspiel, das das Getränk zusammen mit der Glut des Kaminfeuers entfaltete.
„Nun endlich dürfen wir zum ersten Mal kosten, mit kleinen Schlucken, die wir seitlich an der Zunge entlanglaufen lassen. Dort schmeckt man am besten die Ausgewogenheit von Säure und Weichheit und erkennt die Eleganz des Getränks.“
Beim ersten Schlückchen musste Marie husten, völlig überrascht von der Stärke des Alkohols.
„Zweiundvierzig Volumenprozent, das ist nichts für schwache Gemüter!“, scherzte Margaux und klopfte ihr auf den Rücken.
„Was du nicht sagst“, antwortete Marie, nachdem ihr für einen Augenblick die Stimme versagt hatte.
„Geranie und Unterholz. Es ist wundervoll“, sagte Josh und betrachtete die Flüssigkeit.
„Es ist ein 1975er Jahrgang“, erklärte Gustave und prostete seiner Tochter zu. „Dein Geburtsjahr, meine Liebe.“
Yvette lächelte zärtlich. Es fehlte nur noch Claudie, und dieser Abend wäre perfekt gewesen.
In genau diesem Moment kehrten Jérôme und Sylvia heim. Sie wollten den Ausklang des Abends nicht verderben und verbargen in einem seltenen Anflug von Rücksichtnahme ihre Ehekrise. Ihre Beziehung war vom Weg abgekommen, doch was den Grund dafür betraf, machten sie sich beide etwas vor. Das Problem lag nicht in der Beziehung selbst, sondern in der Leere, die ihnen ihre Keimfreiheit aufgezwungen hatte.
Schnell verabschiedeten sie sich in ihr Zimmer, und bald darauf folgten ihnen auch die anderen.
3
Hélène geht auf dem Bürgersteig entlang. Es wird Abend, die Straße ist ruhig, die Schwalben kreischen. Ohne nachzudenken, überquert sie die Straße auf dem Zebrastreifen. Ein Bus hält zu ihrer Linken an einer Haltestelle. Hélène sieht nicht, dass die Fußgängerampel die Farbe wechselt.
Ein Auto kommt von links die Straße hochgefahren. In dem Augenblick, als Hélène hinter dem wartenden Bus hervortritt, wird sie am Bein von dem rasch fahrenden Auto mitgenommen.
Hélène wird wie ein Kreisel durch die Luft geschleudert. Den Bruchteil einer Sekunde lang scheint ihr Körper zu schweben und die Gesetze der Schwerkraft zu missachten, bevor sie dann doch mit Wucht auf dem Asphalt aufschlägt.
Das Auto hält mit quietschenden Bremsen an, die Reifen prallen gegen den Bordstein des gegenüberliegenden Gehsteigs. Ein Mann steigt aus, er zittert von Kopf bis Fuß. Sein Blick ist starr auf Hélène gerichtet, und er ist vor Schreck wie gelähmt.
Hélène. Ihr regloser Körper liegt quer über den schwarzen und weißen Streifen des Fußgängerüberwegs. Um ihren Kopf herum sind ihre blonden Haare wie ein Heiligenschein aufgefächert. Ihre Gesichtszüge sind seltsam friedlich, sie atmet nur langsam. Es scheint, als wäre sie eingeschlafen.
Eine Totenstille liegt über der ganzen Szenerie. Ein weiteres Auto hält wenige Meter von dem leblosen Körper entfernt. Der Fahrer steigt schnell aus seinem Fahrzeug aus und stellt ein Warndreieck vor der Unfallstelle auf, um den Verkehr anzuhalten. Die Gesichter der Fahrgäste im Bus sind vor Angst wie eingefroren. Eine Frau greift sich ihr Handy und wählt die 15.
Die Notrufzentrale besteht aus einem Großraumbüro, in dem eine Menge von Mitarbeitern die Anrufe entgegennehmen. Jeder und jede von ihnen sitzt vor zwei Bildschirmen und einem Telefonapparat und ist mit einem Headset ausgestattet. Ihr Job ist es zu beruhigen, dann die Notfälle herauszufiltern, bevor sie beraten.
Mélanies Apparat blinkt. „Notrufzentrale, was kann ich für Sie tun?“
„Eine Frau ist gerade überfahren worden!“
„Beruhigen Sie sich, Madame, und sagen Sie mir, wo Sie sind.“
„Rue du Louvre.“
„Ist die Person wieder aufgestanden?“
„Nein, sie liegt noch immer am Boden.“
„Ich schicke einen Krankenwagen. Bitte bewegen Sie sie unter keinen Umständen.“
„In Ordnung.“
In dem Moment, in dem sie auflegt, bemerkt sie, dass einer der Fahrgäste aus dem Bus Hélène gerade in die stabile Seitenlage bringt.
Mélanie betrachtet rasch den Bildschirm, auf dem ein Stadtplanausschnitt der entsprechenden Gegend zu sehen ist. Leuchtende Punkte bezeichnen die freien Rettungswagen und ihren Standort. Sie wählt die Notrufnummer des Krankenhauses von Saint-Louis.
Der Krankenwagen Nummer 1622 ist neben der Notaufnahme geparkt. Julien, der Rettungssanitäter, ist gerade mit dem Auffüllen der Fächer für Spritzen, Verbandszeug und Medikamente fertig.
Im Inneren des Gebäudes vibriert der Pager von Dr. Mercier an ihrem Gürtel. Sie nimmt ihn ab und schaut auf das Display. Wie ferngesteuert beginnen ihre Beine zu laufen.
Franck, der Fahrer des Wagens 1622, sieht, wie Dr. Mercier am Ende des Ganges auftaucht. Automatisch wirft er seinen Kaffeebecher in den Mülleimer und setzt sich ebenfalls in Bewegung, um noch vor der Ärztin zu seinem Fahrzeug zu gelangen.
Franck erreicht im Laufschritt das Vordach, unter dem die Rettungswagen stehen. Julien schließt die hinteren Türen in dem Moment, in dem sich Franck ruhig ans Steuer setzt. Mercier ist die Letzte, die einsteigt, sie wirft die Tür zu.
„Unfall an der Ecke Faubourg Montmartre und Rue du Louvre. Das Unfallopfer ist auf den ersten Blick bewusstlos.“
Auf Mélanies Bildschirm wechselt der Leuchtpunkt, der dem Rettungswagen Nummer 1622 entspricht, die Farbe von Gelb zu Rot.
Mit jaulender Sirene rast der Wagen die Rue Alibert hinauf. Der Fahrer fährt über die rote Ampel und überquert den Canal Saint-Martin, um in die Rue Beaurepaire einzubiegen. Es ist jetzt 21.23 Uhr, auf den Straßen ist nicht viel Verkehr.
„Fahr an der Place de la République in die Einbahnstraße“, kommandiert Dr. Mercier gelassen.
Franck folgt ihren Anweisungen.
Sobald er auf dem Boulevard Saint-Martin ankommt, biegt er links ab und fährt die Rue de Cléry hinunter. In der Ferne sehen sie eine Menschentraube und ein Polizeiauto.
„Wir sind da.“
Franck hat den Krankenwagen kaum gestoppt, da springt Mercier bereits aus dem Fahrzeug. Sie eilt zu dem Körper, der verloren mitten auf der Fahrbahn liegt.
Mercier fühlt den Puls des Opfers. Hélène ist am Leben. Mercier ruft mit lauter Stimme: „Schwacher Puls, niedriger Blutdruck.“
Zur gleichen Zeit legt Julien Hélène einen Druckverband an, um eine Vene zu finden, in die er eine Infusion mit Kochsalzlösung injiziert. Franck kommt mit der Bahre, während Mercier Sensoren an Hélènes Fingerkuppen anbringt. Ihre Handgriffe sind präzise, millimetergenau aufeinander abgestimmt. Dann breitet Franck auf dem Boden ein orangefarbenes Plastikstück aus, auf das Mercier und Julien Hélène gleiten lassen. Franck betätigt eine Pumpe. Innerhalb weniger Sekunden stabilisiert eine Schale aus Luft Hélènes Körper. Auf diese Weise können sie Hélène ohne Risiko auf die Bahre heben und schnell zum Rettungswagen schieben.
Einer der Polizisten nimmt die Nummer des Krankenwagens in seinen Bericht auf, während im Inneren des Polizeiautos der Unfallfahrer die Augen starr auf das Blaulicht gerichtet hält, das sich rasch von ihm entfernt.
Im hinteren Teil des Krankenwagens schneidet Julien Hélènes Kleider auf. „Keine äußere Verletzung“, bemerkt er und befestigt Hélène die Elektroden auf der Brust, die an ein EKG angeschlossen sind.
Mercier untersucht die Augen des Unfallopfers und hört dann den Brustkorb ab. „Die Netzhaut ist normal, es scheint keinen neurologischen Schaden zu geben. Wie ist der Blutdruck?“
„Blutdruck steigt, der Puls ist noch immer sehr schwach“, antwortet ihr Julien umgehend.
Mercier tastet Hélène als Nächstes den Bauch ab. „Hartes Abdomen.“ Sie greift sich ihr Stethoskop und legt es am oberen Teil von Hélènes Brust an. „Die Lunge ist nicht in Mitleidenschaft gezogen“, erklärt sie und nimmt sich ihr Telefon, bevor sie eine Taste drückt und eine Nummer im Speicher wählt. „Mercier hier, im Wagen Nummer 1622, ich habe hier möglicherweise eine innere Blutung, vielleicht einen Milzriss aufgrund eines Schlags links gegen den Brustkorb, Rippenbruch wahrscheinlich. Bereiten Sie den Ultraschall vor.“
Der Krankenwagen fährt die Einfahrt zur Notaufnahme des Saint-Louis-Krankenhauses hinauf. Er bleibt unter dem Vordach stehen. Franck springt aus dem Fahrzeug und öffnet schleunig die hinteren Türen. Am anderen Ende der Bahre schiebt Julien, sodass sich das Fahrgestell ausklappt, während Mercier aussteigt und ihre Akte auf Hélènes Beine legt.
Gemeinsam betreten sie das Gebäude und eilen die Gänge hinauf, um den OP zu erreichen. Dort übergibt Mercier ihre Informationen an den Chirurgen, der darauf wartet, dass Julien und Franck Hélène auf den Operationstisch legen.
Alle drei verlassen den OP. Mercier hält ein paar Sekunden lang den Blick auf die automatischen Türen gerichtet, die sich gerade hinter ihr geschlossen haben, und stellt sich dann zu ihrem Team. Gemeinsam gehen sie schweigend zurück durch den Korridor.
Auf dem Tisch im OP befindet sich Hélène in einem Schockzustand. Ihre Augen sind geöffnet, sie ist sehr blass, kleine Schweißtropfen stehen ihr auf dem Gesicht, und ihr Atem geht rasch. Mit einer schwachen Geste ergreift sie die Hand der nächsten Krankenschwester.
Durch ihre sterilen Handschuhe hindurch spürt Agathe, wie Hélènes Leben aus ihr weicht.
Mercier kommt am Empfang an, wo die diensthabende Krankenschwester Hélènes Tasche aufbewahrt. Sie holt das Handy daraus hervor, öffnet das Telefonbuch und gibt „Notfall“ ein. Die Telefonnummer des Notfallkontakts erscheint, sie drückt auf die Ruftaste. Nach dem ersten Klingeln gibt sie das Telefon an Mercier weiter.
Agathe versucht sanft, ihre Hand wieder zu befreien, doch der Griff Hélènes wird nur noch fester.
Das Drehbuch in der rechten Hand und den Stift in der anderen, befindet sich Josh im Schneideraum. Aufmerksam betrachtet er die Szenen, die vor ihm auf dem Bildschirm ablaufen. Von Zeit zu Zeit macht er sich einige Notizen. Das Handy in seiner Tasche vibriert. Er holt es hervor und sieht Hélènes Namen auf dem Display. Er entschuldigt sich beim Cutter.
„Da muss ich rangehen“, sagt er noch, während er den Raum verlässt. „Hallo?“
„Guten Abend, hier spricht Dr. Mercier vom Saint-Louis-Krankenhaus.“
„Was ist los? Wo ist meine Frau?“, schreit Josh, der von einer plötzlichen Panik ergriffen wird.
„Sie ist gerade ins Saint-Louis-Krankenhaus eingeliefert worden. Sie hatte einen Verkehrsunfall.“
„Ich bin sofort da!“, ruft Josh und eilt zum Ausgang des Gebäudes, während ihn die Angst übermannt.
„Bleiben Sie so, lassen Sie ihre Hand nicht los“, fordert der Chirurg Agathe ruhig auf. „Die Milz ist gerissen und die intraperitoneale Blutung ist zu stark . . . “
Josh rast wie der Teufel. Sein Adrenalinspiegel, der durch die Nachricht nach oben geschnellt ist, hat ihn in einen schmerzhaft überwachsamen Zustand versetzt. Er biegt in die Rue d’Alix ein. Ein LKW versperrt die Durchfahrt. Ohne den Motor auszumachen, springt Josh aus seinem Auto, das er einfach stehen lässt, und sprintet wie ein Irrer los – Rue d’Alix, Avenue Parmentier, Avenue Claude-Vellefaux. Die fünfhundert Meter, die ihn vom Saint-Louis-Krankenhaus trennen, kommen ihm wie Kilometer vor.
Die Pieptöne des EKG werden langsam seltener. Hélènes Augen verlieren nach und nach ihren Glanz. Eine Träne läuft ihr aus dem rechten Augenwinkel. Agathe spürt, wie Hélènes Hand aus ihrer eigenen rutscht. Darauf folgt ein lang gezogener, dauerhafter Ton. Der Chirurg hebt den Blick und schaut auf die Uhr des Operationssaals.
Außer Atem stürmt Josh durch die Tür der Notaufnahme.
„Todeszeitpunkt: 21.53 Uhr.“
Agathe schaltet die Apparaturen eine nach der anderen ab. Sie streicht mit der Hand über Hélènes Gesicht – es ist wie eine Liebkosung –, schließt ihr die Augen und deckt ihr dann sanft das Gesicht zu.
Josh läuft durch die Korridore. Als er um die letzte Ecke biegt, sieht er die Türen des Operationssaals.
Plötzlich verlangsamt sich alles. Mit schierer Willenskraft erreicht Josh die Türen und legt seine Hände darauf. Das „Nein!“, das aus seinem tiefsten Inneren in einem Schrei nach außen dringt, scheint eine Ewigkeit anzudauern.






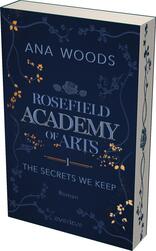






Marie ist 38 Jahre alt und Inhaberin einer Buchhandlung in Paris, die sie von ihrem Großvater Samuel geerbt hat. Ihre Eltern hatten sich kaum um Marie bemüht, weshalb sie ein umso engeres Verhältnis zu ihrem Großvater hatte. Indem sie seine Buchhandlung übernommen hat, in welcher Samuels bester Freund, der verstummte Émile, sich wie zu Hause fühlt, setzt Marie den Lebenstraum ihres Großvaters fort. Marie ist ein Mensch, der sich rührend um andere kümmert und dabei ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahrnimmt. Beim Geburtstag ihrer besten Freundin Margaux in der Normandie lernt sie den verwitweten Josh kennen und hofft auf ein Wiedersehen. Zurück in Paris wacht Marie eines morgens neben ihrem Schutzengel Éloïse auf. Éloïse bringt Marie dazu, ihr Leben zu hinterfragen, insbesondere ob die Buchhandlung auch ihr Lebenstraum ist. Zudem ermutigt sie Marie, sich wieder zu verlieben und warum sollte nicht Josh der Richtige sein? Josh hat den Tod seiner Ehefrau Hélène nicht verwunden. Er träumt nachts von ihr und macht sich Vorwürfe, damals zu spät zum Unfallort gekommen zu sein. Er bestraft sich selbst damit, keine Gefühle für andere Frauen zuzulassen. Nach dem Wochenende in der Normandie ist er beruflich ein paar Tage in L.A., wo er allerdings, auch auf Drängen seines Freundes Martin, ins Grübeln gerät. Er wagt es und ruft Marie an, um sich zu einem Treffen in Paris zu verabreden... "Der Engel von Paris" ist ein ruhiger Roman, der das Seelenleben der beiden Protagonisten, aus deren Perspektive der Roman wechselnd geschrieben ist, beleuchtet. Durch den Schutzengel Éloïse nimmt Marie ihre unterdrückten Wünsche wahr. Sie versucht Marie davon zu überzeugen, sich auf sich selbst zu besinnen, die Schatten der Vergangenheit abzulegen, für die Zukunft offen zu sein und ihre eignen Träume zu leben. Éloïse hat keine Erfahrung als Schutzengel und so lernt sie selbst erst durch Marie, sich auf einen Menschen einzulassen und diesen zu verstehen. Während mir der Beginn des Romans mit der Geburtstagsfeier in der Normandie gut gefallen hat, empfand ich den anschließenden Teil, als Marie und Josh getrennt voneinander betrachtet werden und sich beide in ihre Gedanken- und Gefühlswelt verlieren, als zäh zu lesen. Die Grundstimmung des Romans ist traurig bis melancholisch, auch wenn diese durch das etwa laienhafte Verhalten des Schutzengels etwas aufgelockert wird. Es ist ein feinfühliger, etwas fantastischer Roman mit sehr sensiblen Charakteren, deren Schicksale berühren, die aber für sich allein diesen recht ereignislosen Roman nicht tragen können. Das Buch ist eine Empfehlung für all diejenigen, die ein Faible für philosophische Romane haben oder die selbst einen Verlust zu betrauern haben oder nicht Loslassen können. "Der Engel von Paris" macht Mut, sich der Realität zu stellen, sich aus der Schockstarre zu befreien, Liebe und Gefühle zuzulassen, um zu seinem persönlichen Glück zu finden. So auch das Fazit von Éloïse : "Gutes zu tun, ist ziemlich simpel und macht einfach nur glücklich. Diese Erkenntnis sollte allgemein bekannt gemacht werden."
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.