

Am Anfang war die Nacht Musik
Roman
„Ein Debütroman von beeindruckendem sprachlichen Willen.“ - Focus
Am Anfang war die Nacht Musik — Inhalt
Die Romanvorlage zum Film „Licht“
Wien, 1777. Franz Anton Mesmer, der wohl berühmteste Arzt seiner Zeit, soll das Wunderkind Maria Theresia Paradis heilen, eine blinde Pianistin und Sängerin. In ihrer hochmusikalischen Sprache nimmt Alissa Walser uns mit auf eine einzigartige literarische Reise. Ein Roman von bestrickender Schönheit über Krankheit und Gesundheit, über Musik und Wissenschaft, über die fünf Sinne, über Männer und Frauen oder ganz einfach über das Menschsein.
Leseprobe zu „Am Anfang war die Nacht Musik“
Jeder Laut, den wir von uns geben, ist ein Stückchen Autobiografie.
Anne Carson
Erstes Kapitel
20. Januar 1777
An diesem Wintermorgen geht der bekannteste Arzt der Stadt, verfolgt von seinem Hund, die Treppe vom Schlaftrakt zu seinen Praxisräumen hinab. Die honigbraunen Stufen erlauben bequeme Schritte und den Hundepfoten einen mühelos rhythmischen Trab. In diesem Haus gibt es keine steilen, schmalen Stiegen. Wie früher, im Haus seiner Eltern. Wo er stets durch eine Luke in den Dielen wie auf einer Leiter in den unteren Stock hinunterkletterte – wenn er [...]
Jeder Laut, den wir von uns geben, ist ein Stückchen Autobiografie.
Anne Carson
Erstes Kapitel
20. Januar 1777
An diesem Wintermorgen geht der bekannteste Arzt der Stadt, verfolgt von seinem Hund, die Treppe vom Schlaftrakt zu seinen Praxisräumen hinab. Die honigbraunen Stufen erlauben bequeme Schritte und den Hundepfoten einen mühelos rhythmischen Trab. In diesem Haus gibt es keine steilen, schmalen Stiegen. Wie früher, im Haus seiner Eltern. Wo er stets durch eine Luke in den Dielen wie auf einer Leiter in den unteren Stock hinunterkletterte – wenn er nicht fiel und sich dabei blaue Flecken holte.
Natürlich wäre er lieber im Bett geblieben. Draußen ist es stockdunkel und kalt. Doch steht ein wichtiger Krankenbesuch an, vielleicht der wichtigste seiner Laufbahn: Er soll die blinde Tochter des kaiserlich-königlichen Hofbeamten Paradis untersuchen. Frau Hofsekretär hat um einen Hausbesuch gebeten. Des Aufstiegs wegen ist er so früh auf den Beinen. Und steigt diese Treppe hinab, die zu keinem Frühaufsteher passt. Die üppige Breite, die nur angedeutete Spirale – ein nicht ganz zu Ende gedachtes Schneckenhaus – erinnern an eine Harmonie, die höchstens der Ausgeschlafene empfindet. Ist er nicht. Und dass Kaline, das Hausmädchen, Lampen und Ofen angezündet hat, ist nur ein schwacher Trost, solange sie selbst sich nicht blicken lässt. Wenn er wenigstens musizieren dürfte. Da wohnt er nun seit seiner Heirat in diesem prächtigsten aller Häuser, mit so vielen Zimmern, dass selbst sein Instrument ein eigenes hat, und darf jetzt trotzdem nicht spielen. Dabei fängt ein guter Tag immer mit Musik an. Fünf Minuten auf seiner Glasharmonika genügen. Mozart, Haydn oder Gluck oder einfach die Finger laufen lassen, bis sie selbst eine Melodie finden und leicht über die Tastatur fegen wie eine Katze, die im Schnee spielt. So leicht läuft dann auch der Tag.
Aber Anna, seine Frau, schläft, die Patienten schlafen, alle schlafen noch, das ganze Haus. Wahrscheinlich ist auch Kaline wieder eingeschlafen. Das sieht ihr ähnlich. Kaum lässt sie sich nieder, auf der Küchenbank neben dem Herd oder auf dem Hocker im Waschraum, sinkt sie in einen tiefen Schlaf. Vor zwei Tagen erst hat er sie in diesem Zustand sogar im Salon ertappt. Zurückgelehnt in eines der Kissen glich sie einem zierlichen Tier mit geschlossenen Augen. Oder einer schlanken Pflanze. Einer vom Schlaf überraschten Blüte. Gern hätte er länger auf ihre leicht gewölbten Lider geblickt. Geschlossene Augen haben etwas so Unschuldiges, Wehrloses. Doch er musste sie wecken. Seine Frau wurde in solchen Fällen schnell laut, viel zu laut für ein arglos schlafendes Mädchen. Er sagte ihren Namen, aber Kaline wachte nicht auf. Hinfassen wollte er nicht, also blieb er stehen und fing an, ihr ins Gesicht zu blasen, bis sie die Augen aufschlug. Eher erstaunt als erschrocken, Entschuldigung murmelnd. Unbemerkt stand Anna in der Tür, und so wurde es doch noch sehr schnell sehr laut, so laut, dass an Schlafen überhaupt nicht mehr zu denken war. Das Schimpfen vertrieb jeglichen Schlaf in die hintersten Winkel des Hauses. Hinab in die dunklen Kellergewölbe. Und hoch hinauf, höher noch als die Zimmer der Bediensteten, in diese winzige Kammer direkt unterm Dach. Ein Stübchen wie von Spinnweben eingesponnen, wo die Fenster, der Tauben wegen, vernagelt blieben. Dort war der Schlaf noch Schlaf, dieser natürlichste Zustand des Menschen. Und der ihm am meisten entsprechende. Schließlich beginnt des Menschen Dasein im Schlaf. Und wozu hat die Natur ihn vorgesehen, wenn nicht dazu, ihr Dasein fortzuführen. Und welcher Zustand wäre hierfür geeigneter als der des Schlafs? Mesmers eigene These: Man wacht, um zu essen und zu trinken, damit man ohne zu verhungern schlafen kann. Der Mensch wacht, um zu schlafen.
Nur er nicht. Er schläft, um zu arbeiten. Er muss mit den Vögeln raus, nein, weit vor ihnen. Sein Tag beginnt, da träumt noch kein Vogel von noch keiner Sonne. Und was heißt hier Sonne, was Vogel. Wien im Januar. Weder Sonne noch Vögel. Krähen ja, Rabenvögel. Große schwarz-graue russische Krähen, in der Wiener Nebelsuppe kaum zu unterscheiden vom Steingrau der Häuser. Und wie sie ewig um Futter streiten.
Was den Schlaf angeht, ist seine Frau überraschenderweise ganz und gar seiner Meinung. Anna behauptet sogar, Aufstehen vor zehn schädige die Gesundheit. Und ein Mensch mit geschädigter Gesundheit sei nicht nach Gottes Geschmack. Und das in einem Ton, dass nicht einmal der Leibarzt der Kaiserin, Störck, wagen würde, ihrem Blick zu begegnen. Herr Prof. Dr. Anton von Störck. Der seine Studenten stets warnt vor dem Schlaf, vor dem Müßiggang. Und hatte sich der Student Mesmer nicht besonders angesprochen gefühlt von diesem Thema? Er, ein Student und über dreißig Jahre alt. Die Doktorarbeit erst mit dreiunddreißig. Der ewige Student, eine Gattung, über die seine Eltern oft gespottet hatten. Zu der sie auch ihn gerechnet hatten. Angenehm war das nicht. Er hatte tatsächlich eine Ewigkeit studiert. Erst Theologie und Mathematik, dann Jura und Philosophie, dann Medizin. Die bewährte Kombination. Mustergültig. Faulheit konnte ihm keiner vorwerfen. Auch wenn er immer gut geschlafen hat. Aber Professor Störck macht keinen Unterschied zwischen Schlafen und Faulenzen. So wie er keinen Unterschied macht zwischen Mesmers neuer Methode und dem, was irgendwelche Okkultisten, Astrologen und Scharlatane sich ausdenken. Seine Doktorarbeit hatte Störck noch akzeptiert. Auch wenn er geschluckt hatte, als er den Titel las. De planetarum influxu in corpus humanum. Über den Einfluss der Planeten auf den menschlichen Körper. Bis Mesmer ihm erklärt hatte, dass es ihm nicht um Horoskope gehe, sondern um eine wissenschaftliche Untersuchung darüber, wie die Gestirne sich auf die Erde auswirkten. Am Ende hatte er den Baron halbwegs überzeugt. Zumindest setzte der seine Signatur unter die Arbeit. Seither durfte Mesmer sich Doktor der Medizin nennen.
Aber am frühen Morgen an Herrn von Störck denken! Miserabler kann ein Tag nicht beginnen, als mit dem Gedanken an seinen ehemaligen Professor. Dem er einst so sehr vertraute, dass er ihn, auf Wunsch Annas, sogar zum Trauzeugen machte. Jetzt wird er ihn nie wieder los. Und auch dieser Gedanke bleibt selten allein: Wie im wahren Leben vermehren sich das Unangenehme und das Unangenehme zu Unangenehmem. Was so früh am Morgen besonders unangenehm auf den Magen schlägt. Prof. Ingenhouse, der berühmte Pocken-Impfer aus London, fällt ihm ein, Mitglied der Königlichen Akademie. Zu Mesmers Entdeckung äußerte er öffentlich: Nur das Genie eines Engländers sei imstande, eine solche Entdeckung zu machen. Es könne sich also um nichts Wesentliches handeln. Und jetzt impft Mr. Ingeniös die Wiener gegen die Pocken! Ohne sich um die Folgen zu scheren. Und Dr. Barth, der berühmte Starstecher, und wie sie alle heißen. Die ganze Mediziner-Mischpoke, die ihn nicht gelten lässt und seine neue Heilmethode schon gar nicht. Die ihn vernichten wollen. Jetzt, an diesem frühen Morgen an sie denken, denkt er, ist Selbstvergiftung. Gedanken, denkt er, sind wie Arznei. Falsch dosiert, und man geht zugrunde daran.
Er trabt los,durch den großen Behandlungssaal. Der Hund, vor Freude über den Tempowechsel, springt an ihm hoch. Mit einer Hand wehrt er ihn ab, während die andere in der Tasche des Hausrocks nach dem Schlüssel zum Laboratorium tastet. Und ein Ledersäckchen findet – es ist leer. Das Mädchen wüsste, wo der Schlüssel ist, aber wo ist das Mädchen. Ruft er sie, ruft er das ganze Haus wach. Leise fluchend gelangt er in den hinteren Flur: die Tür zum Laboratorium. Steht offen!
Der Schlüssel zum geheimsten, zum wichtigsten Raum im Haus steckt im Schloss! Von innen. Weiß Gott, wer das verbrochen hat. Glück für Kaline, dass der Schlaf sie verschluckt hat. Der Hund, wie immer vornweg, steht schon beim Fernrohr. Und wie er sich freut. Dieses mächtige Wedeln. Wie er lächelt. Sein lächelnder Hund. Wie lächerlich, denkt er und sieht Hundehaare durch die Luft schweben, Richtung Mikroskop! So gern er dieses freundliche Hundegesicht hat, er scheucht ihn hinaus. Dann wandert sein Blick die bekannten Geräte ab, das Fernrohr, die Elektrisiermaschine bis hin zu der Wand, an der, wie die Jagdtrophäen in der Försterstube seines Vaters früher, die Magnete hängen. Längliche, ovale, runde, nieren- und herzförmige. Ein Stück neben dem anderen füllen sie das Feld, lückenlos. Will heißen: Alle sind da, keiner fehlt.
Er holt tief Luft. Nimmt einen frischen Arztkittel aus dem Schrank, dem Anlass entsprechend den hechtgrauen aus Seide. Den mit den goldenen Tressen. Dazu weiße Strümpfe. Er tauscht den Morgenrock gegen frische Sachen und tupft sich Blütenwasser auf die Stirn. Pflückt zwei ovale und den herzförmigen Magneten von der Wand, trägt sie zum Holztisch vor dem Fenster, reibt sie mit einem Seidentuch.
Die ganze Nacht hat es gestürmt und geschneit. Im Schein der Hoflampe sieht er, dass noch immer Schnee fällt. Vereinzelte winzige Flöckchen im Lichtkreis, als wollten sie nie zu Boden, ewig nur in der Luft tanzen. Wie Jungfer Ossine, von ihren Ängsten umhergewirbelt wie ein Flöckchen vom Wind.
Bestimmt hat sie wieder so eine teuflische Nacht gehabt. Nachts war ich einsam. Und die Einsamkeit gewährte dem Teufel Einlass. Das sind ihre Worte. So drückt Jungfer Ossine aus, dass sie nicht besser sprechen kann als denken und nicht besser denken als ihre eigne Großmutter.
Aber er, warum hat er ihre flockigen Formulierungen im Kopf. Es müsste umgekehrt sein. Sie müsste die seinen in sich herumtragen. Nichts ist, wie es sein soll an diesem frühen Morgen. Wörter von irgendwoher ziehen ihm wie selbstständig durch den Kopf. Er traut ihnen nicht. Wörter wie ohne Bodenhaftung. Aus alter, uralter Luft gegriffen. Ungenau. Unwahr. Wörter, die er übersetzen muss, um sich wiederzuerkennen.
Wenn Jungfer Ossine vom Teufel erzählt, heißt das: Sie hat nicht schlafen können. Hat sich in ihrem Bett gewälzt. Kopfschmerzen. Dazu ein hysterisches Fieber. Sie hat erbrochen und erbrochen, bis zum Morgengrauen.
Das heißt, sie wird alle fünf Minuten nach ihm rufen lassen. Kurz gesagt, Jungfer Ossines teuflische Nacht bedeutet: Mesmer steht ein höllischer Tag bevor. Vor allem da die Welt nicht nur aus Jungfer Ossine besteht. Die neue Patientin heißt Maria Theresia. Ihr Vater, der Hofsekretär, ist Musikliebhaber. Sie selbst eine virtuose Klavierspielerin. Die Familie stadtbekannt. Auch die Kaiserin kennt sie. Und liebt sie. Maria Theresia. Er wird sie heilen. So fügt sich eins zum anderen.
Er schiebt die Magnete in die mit hellblauer Seide gefütterten Säckchen, zieht die Kordeln oben zu. Zwei wandern in seine Arzttasche, eines in die Innentasche seines Kittels. Er zupft den Stoff in Brusthöhe zurecht. Keiner soll etwas merken. Keiner soll fragen, warum er, der Arzt, der Kranke mit Magneten behandelt, einen Magnet am Leib trägt. Ist er vielleicht selbst krank? Ein Kranker, der Kranke heilen will? Das ist verdächtig! Er will den Leuten nichts erklären müssen. Sie haben keine Bildung, können ihn nicht verstehen. Anders seine Kollegen. Die könnten ihn verstehen. Aber sie wollen nicht. Herr von Störrisch nicht und Dr. Ingeniös noch weniger. Der wollte nicht mal verstehen, als Mesmer die Jungfer Ossine vor seinen Augen kurierte.
Aus einem Stall war ein Schwein ausgebrochen, in panischem Galopp durch die engen Wiener Gassen galoppiert und beinahe mit Jungfer Ossine kollidiert. Als man sie zu Mesmer brachte, war sie ohnmächtig. Gute Gelegenheit, sein Können zu demonstrieren. Er hatte Ingenhouse rufen lassen, damit er sich von der Wirklichkeit des magnetischen Prinzips überzeugen könne. Er glaubte nicht, dass der tatsächlich kommen und dann auch noch widerspruchslos ausführen würde, was Mesmer ihm auftrug. Doch von sechs weißen Porzellantassen auf dem Tisch wählte Ingenhouse eine beliebige aus, überreichte sie Mesmer, damit dieser die magnetische Kraft auf sie übertrage. Danach trug Ingenhouse alle Tassen zu der Ohmächtigen ins Zimmer nebenan. Als sie mit der magnetischen Tasse in Berührung kam, zuckte ihre Hand vor Schmerz zurück. Ingenhouse wiederholte den Versuch mit allen sechs Tassen. Aber die Jungfer reagierte nur auf die eine magnetische, erwachte schließlich und fühlte sich schwach, aber gut. Prof. Ingeniös konnte es kaum fassen. Schüttelte den Kopf, sagte, unglaublich, und wiederholte es immer wieder, als glaube er sich selbst nicht. Bis er gestand: Er sei überzeugt. Umso erstaunter war Mesmer, dass Ingenhouse wenige Tage später öffentlich verbreitete, er sei Zeuge einer betrügerischen Demonstration geworden. Eines abgekarteten Spiels zwischen Mesmer und einer Patientin.
Als Jungfer Ossine, die längst wieder vertrauensselig durch die engen Wiener Gassen spazierte, zu Ohren kam, dass man sie des betrügerischen, abgekarteten Spiels bezichtigte, verfiel sie in ihre alten Krämpfe. Da hatte Mesmer sie in sein Spital aufgenommen.
Herr Dr. Ingeniös interessiert sich nicht für die Gesunden. Sie stoßen ihn sogar ab. Den ziehen die Kranken an, mit den schlimmen und schlimmeren Symptomen, die er ihnen aus dem Leib herauserklärt. Aber was bringen Erklärungen. Genügt es nicht, zu heilen? Herr Dr. ist wie alle Menschen. Leicht zu entflammen für eitle Einbildung und schwer zu erwärmen für die Wahrheit. Die Wahrheit ist: Ein Magnet gibt die Kraft. Das braucht Mesmer nicht zu beweisen. Er spürt es.
Durchs Fenster sieht er die Köchin über den Hof gehen. Wahrscheinlich ist es später, als er dachte. Seine Uhr, wo ist seine Uhr. Er wird zu spät kommen. Kaline. Wo ist Kaline. Die Köchin. Nein, diese Köchin nach der Uhr ist wie einen Raben nach einem Stück Käse zu fragen.
Der Kutscher wartet schon. Auf ihn. Draußen in der Kälte. Er wirft sich den weiten schwarzen Wollmantel über, schlingt ein dickes wollenes Tuch um den Hals. Tupft einen weiteren Finger Rosenwasser, diesmal hinters Ohr, und schließt sorgfältig die Tür hinter sich ab. Der Hund begrüßt ihn, als hätte er ihn seit Tagen nicht gesehen. Er folgt ihm hinaus. Im Hof geht er eigene Wege. Tappt Richtung Stall, Pfoten ins frische Weiß. Wie schwarze Noten auf weißem Papier, denkt Mesmer. Eine Melodie fällt ihm ein. Im Hof dämpft der Schnee jedes Geräusch, außer Schneegeräuschen. Mesmers Schritte knirschen so laut, dass er erschrocken stehen bleibt und zum Schlafzimmer seiner Frau hinaufschaut. Alles still oben. Glück gehabt. Glück und Stille, alte Verwandte. Aber natürlich nimmt ihm das keiner, den es vorwärts drängt, ab. Die gehen doch davon aus, dass hinter allem das Unbegriffene steckt. Und das muss auf den Begriff gebracht werden. Weiter auf Zehenspitzen zur Kutsche. Hinein in das prächtige Winterbild mit zwei Rappen vor einem Schlitten. Zwei vollbeschirrte Pferde kauen und drehen die Köpfe und wenden sich wieder dem Hafer zu in den Säcken vor ihren Mäulern. Dem Bild fehlt ein Kutscher. Alle sind sich selbst genug. Er nicht. Er könnte die Pferde umarmen, den Kopf an ihre warmen Hälse legen, über ihre Kruppen streichen. Pferde rauben keine Kraft. Umgekehrt. Sie geben Kraft. Aber die neue Patientin. Und ihr Vater, der Hofsekretär. Ein kaiserlich-königlicher Hofsekretär kann weder mit einem unpünktlichen noch mit einem nach Pferd riechenden Arzt verkehren.
Beamte sind alle gleich. Je pünktlicher und parfümierter man ihnen entgegentritt, desto gnädiger wird man empfangen. Und was will man mehr, als gnädig empfangen werden. Gnädiger als gnädig. Am allergnädigsten.
Die Hände in den Manteltaschen tritt er sachte auf der Stelle. Dabei macht seine Rechte, unerwartet, eine große Entdeckung: eine Uhr an einer Kette. Und als er sie herauszieht: besteht keinerlei Grund mehr zur Eile. Und kaum kommt es nicht mehr drauf an, klappt alles wie am Schnürchen. Der Kutscher hastet durch die Tür eines der Nebengebäude, lässt sie eilig ins Schloss fallen. Mesmer hält die Eile für gespielt. Sein sattes Gesicht verrät doch, der Kutscher hat gerade in Ruhe gefrühstückt. Und jetzt nimmt er, ihn grüßend, den Pferden das ihre weg.
In die innere Stadt, sagt Mesmer. Am Roten Turm könne er ihn absetzen. Von dort aus gehe er zu Fuß zu diesem Haus mit dem langen Namen. Wie hieß es? Schab den …
Zum Schab den Rüssel, sagt der Kutscher und schnalzt, bis die Rappen in Gang kommen.
Normalerweise fängt die Donau die ersten Lichtstrahlen am Morgen und bewahrt am Abend die letzten. Heute aber macht der Schnee die Donau schwarz. Die Donau ist eine Uhr. Sie lässt Zeit, Wetter und Jahreszeit ablesen. Er könnte sein Leben nach der Donau ausrichten. Überhaupt nach Flüssen, nach Wassern, nach an- und abschwellenden Fluten. Die den Bewegungen der Planeten folgen. Den Konstellationen von Sonne und Mond. Sie bestimmen die Welt. Alles, woraus wir gemacht sind, das Feste, das Flüssige. Er hat die alten Schriften studiert, Galilei gelesen, Gassendi, Kepler, Descartes. Und er hat die Natur studiert, ihre wilden Gesten. Die Ozeane, Ebbe und Flut. Die Winde – Stürme und Unwetter. Die Erde – Beben und Vulkanausbrüche. Jungfer Ossines Krampfanfälle und Zuckungen und unzählige andere Bewegungen. Die seiner Frau zum Beispiel mit ihren Reizbarkeiten und Wutausbrüchen. Und seine eigenen – Gott sei Dank eher seltenen – Nierenschmerzen. Und bald auch die Körpersprache der neuen Patientin: Ihre Blindheit wird er studieren. Und dabei wird er die Augen verschließen vor dem Einstudierten. Vor der auswendig gespielten Rolle. Und wird die Sinne öffnen gegenüber ihrer Verstocktheit.
Von denen, die er ernst nimmt, die wissenschaftlich denken und um exakte Messungen bemüht sind, wie er selbst, ahnten viele den Einfluss des Universums auf die untermondische Welt. Aber erst Newton gelangte zu universellen Prinzipien. Klarer Kopf, klare Sprache, klare Gesetze. Seit Jahren beschäftigt ihn Newtons System. Es entspricht mit ziemlicher Sicherheit der Vernunft. Newton ist groß. So groß, dass er sogar zugeben kann, wenn er ratlos ist. I know there is an aether. I do not know what this aether is. Einer dieser Sätze, die Newton unschlagbar machen. Dieser Satz tickt in Mesmer. Unablässig. Mal schneller, mal langsamer … Nur, mit Verlaub, eine winzige Anmerkung … Er will ihm ja nichts vorwerfen, aber Newton, der Physiker … kann es sein, dass er die Einflüsse der Planeten auf alles Lebendige ein klein wenig unterschätzte? Sich vielleicht ein klein wenig zu sehr auf die Messgeräte verließ? Mesmer ist Mediziner. Und Mediziner müssen weiter denken. Müssen die leisesten Veränderungen im Gleichgewichtsgefüge ernst nehmen. Auch wenn sie mit neuester Technik nicht messbar sind. Was ist ein Barometer gegen den Mond. Der wie die Wasser auch die Lüfte hinter sich zusammenzieht und sammelt. Auch wenn die Luftfluten auf keinem Messgerät je abzulesen waren. Soll es sie deshalb nicht geben? Lächerlich. Nein, man muss weiterdenken! Warum sind sie nicht messbar? Weil der Mond, der Schlaumeier, natürlich das Gewicht der Luftfluten, die er zusammenzieht, gleichzeitig hebt!
Körper spüren, wo Barometer versagen. Sie sind durchdrungen von diesen Fluten. Von dem Einen. Dem Fluidum. Dem feinsten, allerfeinsten Stoff, den das Universum zu bieten hat. Feiner noch als der feinste Äther. Das ist Gesetz. Sein Gesetz. Und keiner soll ihm widersprechen. Vor allem nicht die Herren Doktoren von der Akademie. Vor allem nicht sein ehemaliger Professor, sein Doktorvater und Trauzeuge Anton von Störck! Alle müssten es anerkennen. Bauern, Priester, Rechtsanwälte, Ärzte, Musiker, Musikliebhaber, Köchinnen, Kutscher, Hausmädchen, die Kaiserin, ihr Hofstaat, ihre Minister, ihre Sekretäre, ihre Zofen und Kammerburschen, ihre Söhne und Töchter und sämtliche Jungfern im Lande.
Wien, die größte Stadt, in der er je gelebt hat. Ein großer Haufen Steine. Ein stinkender Haufen. Es stinkt, wohin man geht, vor allem in den brütend heißen Sommern. Unerträglich. Und Menschen. So viele, dass man unmöglich jeden Musikliebhaber kennen kann. Es wimmelt von Musikliebhabern in dieser Stadt! Es wimmelt von Musikern. Alle wollen nach Wien, zum Theater, zur Oper, zum Hof. Und zur Kaiserin. Sie scheint ein Magnet zu sein. Ein Magnet mit einer Kraft, die eine ganze Stadt magnetisieren kann, eine so große Stadt wie Wien. Dabei ist Wien manchmal auch so winzig klein (und vertratscht) – dass man mühelos alles über jeden erfährt. Mitunter mehr, als man möchte. Die neue Patientin sei arm dran, hat er gehört. Sie sei hässlich. Sie sei schön. In ihrem Leid. Sie kleide sich unvorteilhaft. Sie spiele besser Klavier, als sie singe. Sie habe einen vollkommenen Star. Sie täusche ihre Blindheit nur vor. Einigkeit herrscht nur in einem: Die Kaiserin schätze das Mädchen über alle Maßen, verehre sie sogar. Er wird sie heilen. Darin ist er einig mit sich. Der Rest ist Mythos, denkt er, als der Schlitten mit einem Ruck stehen bleibt.
Ringsum frischer Schnee. Kaum Fußstapfen darin. Er bitte ihn, doch weiterzufahren, ruft er dem Kutscher zu und schaut durchs Fenster hinaus, während die Pferde langsam vorantrotten. Bis vor ein Haus mit gewaltiger Symmetrie und so vielen Fenstern, dass er sich wie beäugt vorkommt.
Langsam geht er auf die dunklen Fenster zu. Und schaut hinauf zum zweiten Stock, der hell erleuchtet ist. Eine gleißende Zeile Licht, in die er schaut, bis er das Dunkle aus den Augen verliert.
„Walser erzählt eine zeitlose Geschichte von Krankheit und Gesundheit, von der Schönheit des Hörens, vom Klang der Musik und von der heilenden Kraft warmer, freundlicher und helfender Hände.“
„Sinnlich geht es zu in Alissa Walsers fulminanten Debütroman.“
„Mit ihrem in Präsens und Futurum geschriebenen Roman, der Dialoge weitgehend indirekt wiedergibt, ist ihr ein musikalisches Stück Literatur gelungen, das noch lange nachschwingt.“
„Ein Roman wie eine Komposition.“
„Ausdrucksstarke Sprache, die die Gefühle der Helden auf den Leser überträgt.“
„Walsers Virtuosität liegt in der Sprache selbst (…) aber auch in der Kunst der Auslassung. Die Dialoge, meist in indirekter Rede und stets im schönen Fluss, wie es eines Buchs über einen Magnetiseur würdig ist, handeln ohne Wucht von großen Dingen: Freiheit und Unterdrückung, Fortschritt und Humbug, Ehrgeiz und Gleichmut, Individuum und Gesellschaft, der Lage der Frau und der Möglichkeit der Liebe.“
„Gelungen ist ein so temperamentvoll wie fein gezeichnetes doppeltes Künstlerdrama.“
„Geschickt reduziert Alissa Walser ihren Stoff auf ein paar Schlüsselszenen und erzählt auch diese in einer suggestiv gerafften Weise, gelegentlich in einem fast atemlosen Stakkato.“
„Die Autorin Alissa Walser erzählt poetisch und gleichzeitig bestechend klarsichtig vom Schicksal zweier außergewöhnlicher Menschen in einer Gesellschaft, in der Schein alles zu sein scheint.“
„Ein Debütroman von beeindruckendem sprachlichen Willen.“
„Das Warten hat sich gelohnt: ›Am Anfang war die Nacht Musik‹ ist ein feiner, zarter, berührender Text und ein bedeutender Roman.“
„Eine bezwingende Parabel über die Macht der Musik. Wirkungsvoll ist Alissa Walsers Erzählung allemal, und das verdankt sie brillanten Dialogen und einer ungeheuer präzisen, melodischen Sprache, in deren Rhythmus man sich gerne wiegt und die man geneigt ist, betörend zu nennen.“
„Der Roman ›Am Anfang war die Nacht Musik‹ hat jene besondere Sprachmagie, die in jeder Zeile satte Sinneseindrücke erzeugt – ein großer Lesegenuss!“
„Es ist ein seltsamer Erzählraum, in dem jedes Möbel am rechten Platz ist, die Rhythmuswechsel, die Zeitenwechsel stimmen. In dem eine Sprache klingt, die dem Unsagbaren, dem Unerklärbaren den blinden Flecken Kontur gibt. Die sich nicht dem historischen Idiom billig anverwandelt, die frisch ist und quicklebendig. Lang klingen die Bilder, die Sätze in diesem Raum. Wie Seifenblasen. Glasharmonikale Literatur.“
Raffiniert: Alissa Walsers Roman über den Wiener Heiler Franz Anton Mesmer und eine Art Liebe.














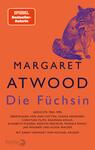


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.