
Ach du dickes B — Inhalt
In keiner anderen Stadt führen große Projekte so zielsicher in die große Pleite wie in Berlin, versickern Träume mit den Millionen. Das Flughafendesaster hat eine lange Tradition: Berlins Geschichte ist geprägt von Flops und Luftnummern. Cornelia Tomerius hat sie alle versammelt: die schönsten Blamagen der letzten 775 Jahre – eine fröhliche Berliner Pleitenchronik! Schuld an der Misere sind nicht immer die anderen: Zwar war Berlin oft vom Schicksal gebeutelt und Spielball anderer Mächte. Doch vieles, was schiefläuft, ist hausgemacht und wurzelt im Größenwahn, der die Stadt von jeher regiert. Wer nichts zu verlieren hat, wird mutig. Wer kein Geld hat, gibt erst recht gern aus. Dass man immer wieder krachen geht, scheint den Berliner indes kaum noch zu jucken. In Berlin wird das Scheitern zur Tugend, hier zieht man seine Kraft aus Niederlagen und Rückschlägen. „Ach du dickes B“ beschreibt Berlins Pleiten, Blasen und Blamagen, erzählt von prominenten Nieten und erfolglosen Sportclubs, von gescheiterten Olympiaträumen und dem Flughafendesaster, von Bausünden und Konstruktionsfehlern, von S-Bahn-Entgleisungen und omnipräsenten Gehwegschäden. Es zeigt, was das permanente Scheitern mit der Stadt und ihren Menschen macht – und ergründet auf diese Weise das rätselhafte Wesen der Hauptstädter.
Leseprobe zu „Ach du dickes B“
Aufschwung West
Knut und das Riesenrad
Der Himmel über Berlin tat alles dafür, dass niemand ihm zu
nahe kommen wollte. Kühl und bedeckt gab er sich, schauerte
und schüttete und verbreitete eine ziemlich miese Stimmung.
Der Regierende Bürgermeister ließ sich davon nicht
beirren. Wie immer, wenn es aufwärtsging in Berlin, war
Klaus Wowereit bester Laune.
Und aufwärts ging es, diesmal sogar messbar. 185 Meter
hoch sollte das Riesenrad werden, für dessen ersten Spatenstich
man sich an jenem regnerischen 3. Dezember 2007
an dessen künftigem Standort einfand. Als »neues [...]
Aufschwung West
Knut und das Riesenrad
Der Himmel über Berlin tat alles dafür, dass niemand ihm zu
nahe kommen wollte. Kühl und bedeckt gab er sich, schauerte
und schüttete und verbreitete eine ziemlich miese Stimmung.
Der Regierende Bürgermeister ließ sich davon nicht
beirren. Wie immer, wenn es aufwärtsging in Berlin, war
Klaus Wowereit bester Laune.
Und aufwärts ging es, diesmal sogar messbar. 185 Meter
hoch sollte das Riesenrad werden, für dessen ersten Spatenstich
man sich an jenem regnerischen 3. Dezember 2007
an dessen künftigem Standort einfand. Als „neues Wahrzeichen
“ beschwor Wowereit im Baustellenzelt das gigantische
Fahrgeschäft, „denn es wird als zweithöchstes Gebäude
nach dem Fernsehturm von keinem Punkt der Stadt aus zu
übersehen sein“. Auch das Ausland würde es nicht ignorieren
können, wäre es doch sogar das höchste Riesenrad in ganz
Europa.
Das stand vorerst aber noch in London. 135 Meter misst
das London Eye, es hat 32 Gondeln für je 25 Passagiere und
bewegt sich mit 16 Metern pro Minute viermal so schnell wie
ein Faultier im Baum. In dreißig bis vierzig Minuten fährt
man einmal rundum und kann bei guter Sicht 40 Kilometer
weit bis zum Windsor Castle blicken. Seit seiner Eröffnung
im März 2000 hat das Riesenrad nicht nur die Silhouette der
Stadt um eine hübsche Rundung bereichert, sondern London
um eine Attraktion: Weit über drei Millionen Leute fahren
pro Jahr mit dem London Eye, so viele Besucher zählt noch
nicht mal das Taj Mahal.
Als im Jahr 2003 ein paar Investoren anboten, auch in
Berlin ein solches Rad zu bauen, musste man nicht lange
überlegen. Die Silhouette war gewiss ausbaufähig, das Symbol
stimmig: Zusammen mit dem Fernsehturm, einer Art
Diskokugel am Dönerspieß, würde das Riesenrad klare Zeichen
setzen in einer Stadt, die nun mal kein Big Business hat,
das die Skyline mit Wolkenkratzern bestückt. Aber dafür einen
Bürgermeister, der sich gern vergnügt.
Außerdem bot das Rad eine gute Gelegenheit, gegenüber
London – mit seinen fast acht Millionen Einwohnern
im Gegensatz zu Berlin wahrlich eine Weltstadt – endlich
mal Größe zu zeigen. Dass das Megarad von der Spree höher
werden würde als sein Konkurrent an der Themse, verstand
sich von selbst: Um gleich fünfzig Meter sollte es das London
Eye überragen. Es waren 36 Kapseln für je 40 Personen geplant,
und für eine Runde bräuchten sie höchstens eine halbe
Stunde.
Offen blieb die Standortfrage. Eine Fläche neben dem
Technikmuseum am Tempelhofer Ufer unweit des Potsdamer
Platzes wurde ausgewählt. Plötzlich tauchte ein Mäzen
aus England auf und wollte dem Museum einen Anbau
spendieren – allerdings nur unter der Bedingung, dass dieser
nicht unter das Rad käme. Der Investor ging vor: Die Stadt
erwarb das Grundstück, damit der Brite es bebauen konnte,
und versprach zudem, dass ihm kein Riesenrad in die Quere
käme. Leider hat man danach vom Mäzen nichts mehr
gehört.
Dafür vom Riesenrad. Ein Jahr später hatte die Great Berlin
Wheel GmbH für 25 Millionen Euro ein Grundstück am
Zoologischen Garten erworben. Von der Hälfte der Kaufsumme
sollte der Tierpark einen neuen Wirtschaftshof erhalten,
denn der alte stand dem Rad im Weg und musste weichen.
Ärger mit dem Nachbarn hatte man hier nicht, bekam Zoodirektor
Bernhard Blaszkiewitz doch zum neuen Gebäude auch
gleich eine Riesenattraktion vor die Tür, die zusätzliche Besucher
anlocken würde. Auch die Stadtplaner waren glücklich
mit der Wahl des Standorts – das Riesenrad versprach eine
Art Aufschwung West.
Die Gegend am Kurfürstendamm hatte ihre glänzenden
Zeiten nämlich schon lange hinter sich. In den Zwanzigern
kamen sie noch alle her, damals warf man sich in Schale für einen
Bummel an den Schaufenstern vorbei, sah man Literaten
und Leute vom Film im Romanischen Café an der Gedächtniskirche
sitzen. Später fanden die Bewohner der ummauerten
Halbstadt hier zwischen Ku’damm, Zoo und KaDeWe
ihre Mitte. Unter dem rotierenden Mercedes-Stern auf dem
Europacenter pulsierte das Leben, reihten sich Boutiquen an
der Haupt- und Bordelle in den Nebenstraßen aneinander,
strahlten die Geschmeide der Damen mit den Goldkettchen
der Zuhälter um die Wette. Zuletzt hatte der Ku’damm wohl
im Herbst 1989 für Glanz gesorgt, nämlich in den Augen derer,
die nach dem Mauerfall aus dem Osten nur zum Gucken
rüberkamen und zwischen KaDeWe und Beate Uhse den goldenen
Westen suchten.
Doch im wiedervereinten Berlin lag die Mitte im Osten.
Die City West, nun der „alte Westen“ genannt, rutschte an
den Rand und damit in eine Identitätskrise, in die sonst eher
Diven geraten, die plötzlich feststellen, dass man sie nicht
mehr begehrt. Jahrelang blieb eine Baugrube am Bahnhof
Zoo sichtbar – wie eine Zahnlücke, für die sich kein Implantat
mehr lohnt, weil der Patient ohnehin bald ins Gras beißt. Von
der Gedächtniskirche, seit dem Krieg sowieso kaputt, bröckelten
nun sogar die restlichen Trümmer ab. Als das neue
Verkehrskonzept den einst legendären Bahnhof Zoo dann
auch noch zum Regionalbahnhof degradierte, fühlte sich die
City West vollends abgehängt vom Rest der Welt. Das Riesenrad
indes gab Hoffnung. Wenn der neue Touristenmagnet
wie geplant 2009 fertig wäre, so stellte ein Gutachten fest,
würde er fünfhunderttausend Besucher zusätzlich pro Jahr
in den Westen locken.
Doch bereits 2007 sollten Millionen Menschen Richtung
Zoo strömen: nicht eines riesigen Rades, sondern eines kleinen
Bären wegen. Als Knut am 5. Dezember 2006 das Licht
der Welt erblickte, ahnte niemand, was für Superlative in
ihm schlummerten. Man konnte noch nicht mal ahnen, dass
es tatsächlich ein Eisbär würde, so nackt und winzig, wie er
war. Rein körperlich verhielt er sich zu einem ausgewachsenen
Exemplar (in Gramm) wie halb Berlin zu ganz Deutschland
(in Quadratkilometern). Unklar war auch, ob er und sein
Zwilling überhaupt überleben würden, nachdem die Mutter
sie verstoßen hatte. Knuts Bruder schaffte es leider nicht,
Knut schon. In einem Brutkasten für Papageien wurde der
Bär in den ersten Wochen bei molligen 36 Grad gewärmt und
mit Milch aus der Pipette gepäppelt.
Danach sorgte Ziehvater Thomas Dörflein für die nö-
tige Nestwärme. Der Pfleger mit dem Pferdeschwanz und
dem Ring im Ohr stellte sein Feldbett neben Knuts Kiste auf,
reichte dem Bären das Fläschchen und spielte ihm manchmal
sogar einen Elvis-Song auf der Gitarre vor. Dörflein gab dem
Eisbären auch seinen Namen. Knut, weil das kurz war und
nordisch. Und binnen weniger Wochen entwickelte sich Knut
zu einem Wonneproppen in Wollweiß, zum niedlichsten Eisbären
der Welt, einem Medienstar, Fotomodell, Klimabotschafter
– und Berlin entdeckte den Bären in sich.
Es war die ungewöhnlichste Karriere, die je ein Eisbär hingelegt
hat: Kaum gelangten die ersten Bilder von Knut in die
Öffentlichkeit, war diese aus dem Häuschen. Jedes neue Foto
des kleinen Bären landete auf den Titelblättern der Zeitungen,
die Realitysoap aus der Babybärenkrippe war ein Quotenhit,
und aus der ganzen Welt reisten Kamerateams an,
um Knut und Dörflein zu filmen. Frank Zander sang „Hier
kommt Knut“, Tom Kummer führte ein langes Interview mit
ihm, Umweltminister Sigmar Gabriel adoptierte den Bären
und Starfotografin Annie Leibovitz flog eigens aus Amerika
ein und lichtete Knut ab – für das Cover des Promimagazins
„Vanity Fair“. Spätestens als Berlinale-Chef Dieter Kosslick
auf dem Potsdamer Platz mehrfach „Welcome Knut“ sprühen
ließ, gab es keinen Zweifel mehr: Berlin hatte nach Marlene
Dietrich und Hildegard Knef endlich wieder einen waschechten
Weltstar.
Zu seinem ersten öffentlichen Auftritt am 23. März 2007
strömten 500 Journalisten aus aller Welt in den Zoo. Gleich
drei Fernsehsender berichteten live. Danach wurde sein Gehege
zu einer Art Pilgerstätte für eine neue Religionsgemeinschaft,
die Knutianer. Sie hatten ihre Kinder und ihre
Kameras dabei, und – als Knut nicht mehr an der Flasche
hing – auch Croissants für den Bären. An den Kassen summierten
sich die Mehreinnahmen bald auf Millionen. In nur
wenigen Monaten hatte Eisbär Knut mehr Leute in den Westen
Berlins gelockt, als man für das Riesenrad je zu träumen
wagte.
Das drehte sich derweil vorerst auch nur als Modell auf der
Expo Real in München. Im Oktober 2007 konnte man hier
sehen, wie die Idee konkrete Formen annahm. Als „Abflughalle
“ hatte der Architekt Ingo Pott ein dreigeschossiges Gebäude
in Wellenform entworfen, das außen zum Teil begrünt
werden sollte und innen Platz bot für Cafés, Ticketschalter
und Geschäfte. Wie eine gewachsene Hügellandschaft sollte
es sich aus dem Stadtraum erheben und die Unnatürlichkeit,
mit der sich das gigantische Stahlskelett daraus emporschwang,
optisch abfedern.
Doch an seinem zukünftigen Standort tat sich derweil
nichts. Bereits im Mai 2007 hatten die Investoren eingeräumt,
dass alles länger dauern würde. Erst im Herbst sollten
sie die Baugenehmigung bekommen. Dann erfolgte auch endlich
der erste Spatenstich, bei dem Wowereit & Co. bekanntlich
im Regen standen. Der Akt war zwar nur symbolisch, und
gebaut wurde danach so wenig wie vorher – doch er setzte ein
Zeichen in einer Zeit, da der Zoo nach der ersten Knut-Euphorie
plötzlich ein gewichtiges Problem bekam.
Der Tierpark Neumünster erhob nämlich Anspruch auf
Knut, war er doch der Sohn von Lars, dem von dort zur Begattung
ausgeliehenen Eisbären. Laut Vertrag gehörte das
erste überlebende Neugeborene dem Tierpark in Schleswig-
Holstein, wie übrigens auch jedes dritte, fünfte, siebte und
neunte, kurz: jeder ungerade Eisbär. Die Norddeutschen wollten
aber gar nicht Knut, für den hatten sie noch nicht mal
Platz, sie wollten Knete. Ein Teil der Mehreinnahmen, für
die der Bär gesorgt hatte, stünde ihnen zu, meinten die Neumünsteraner.
Zoodirektor Bernhard Blaszkiewitz sah das anders:
„Die bekommen ein paar Pinguine, und dann ist die Sache
in Ordnung.“
Damit hatte sich Blaszkiewitz zwar keine Freunde gemacht,
aber das war ohnehin noch nie seine Stärke. In Berlin
genoss der Zoodirektor etwa den Sympathiewert eines Truthahngeiers.
Immer wieder sorgte er für Schlagzeilen. Entweder,
weil er Mitarbeiter zusammenbrüllte, kleinen Katzen das
Genick brach – auf „artgerechte Weise“, wie er fand –, oder
gar Tiger an chinesische Potenzmittelhersteller verkauft haben
soll. Dass der Mann kein Herz haben konnte, war den
Berlinern spätestens dann klar, als ihn die geballte Niedlichkeit
von Knut – die Kulleraugen, das Kuschelfell, die knuddelige
Art – einfach kaltließ. Knut sei nur eins von 140 000 Tieren
für ihn, stellte er klar, und nichts Besonderes.
Der Story von Knut tat er dennoch gut. Denn der grobschlächtige
Zoodirektor hatte ihr gerade noch gefehlt, um
filmreif zu werden, für Disney etwa oder für Regina Ziegler:
Blaszkiewitz war der Bösewicht. Dörflein der Gute. Und
Knut – eben Knut. Nur das Happy End wollte sich nicht einstellen.
Im September 2008 starb der 44-jährige Thomas Dörflein
überraschend an einem Herzinfarkt, und ganz Berlin trauerte
mit seiner Familie, vor allem aber mit Knut. Zwar waren
der Pfleger und sein Ziehsohn schon im Juli 2007 voneinander
getrennt worden, weil Knut damals bereits 50 Kilo auf
die Waage brachte. Eine zärtliche Rangelei unter Freunden
konnte da schnell zu einer lebensgefährlichen Angelegenheit
werden. Doch Dörflein besuchte Knut regelmäßig. Noch am
Samstag vor seinem Tod war er bei ihm. Wie immer streckte
er seine Hand durch das Gitter und wie immer leckte Knut sie
zärtlich ab. Doch jetzt würde Dörflein nicht mehr kommen
und der Bär war ganz allein auf der Welt. Da halfen auch die
vielen Fans nichts, die sich täglich vor seinem Gehege trafen,
nahm Knut, kurzsichtig wie alle Eisbären, diese doch nur als
große Duftwolke wahr, aus der es ab und an Croissants regnete
– in diesen schweren Tagen natürlich noch viel mehr als
sonst.
„Mit Dörflein haben die Berliner einen Sympathieträger
verloren“, sagte Klaus Wowereit. Doch der Tierpfleger war
mehr als das: Er war die fleischgewordene Liebe zwischen
Mensch und Tier. Er war ein Vorbild für eine ganze Generation
verunsicherter Männer, denen er bewies, wie man männlich
und zärtlich zugleich sein konnte und dabei sogar noch cool
rüberkam – und das pünktlich zur Einführung des Elterngeldes,
das ab 2007 die Väter stärker als bisher in die Kindererziehung
einband. Dörflein war zudem Träger des Landesverdienstordens,
der einzigen Auszeichnung, die der bescheidene
Tierpfleger je angenommen hat. Als nach seinem Tod einige
von Dörfleins Habseligkeiten im Internet versteigert wurden,
ging sein Schlafsack, in dem er neben Knut nächtigte, für stolze
1431 Euro weg, sein Elvis-Buch brachte 221 Euro.
In diesen traurigen Tagen interessierte sich kaum noch
jemand für das Riesenrad. So ging es fast ein bisschen unter,
als die Investoren des Projekts im Oktober verkündeten, dass
sie das Rad aufgrund der weltweit explodierten Stahlpreise
zehn Meter niedriger bauen würden als geplant: statt 185
also nur 175 Meter, womit es aber immer noch die Londoner
Version überragte. Ferner habe man auf der ganzen Welt niemanden
gefunden, der die Pott’sche Abflughalle maschinell
zu fertigen in der Lage sei, weshalb diese nur in Handarbeit
und für die doppelten Kosten hergestellt werden könne. Die
daraufhin neu entworfene Halle, ein asymmetrisches Fünfeck
mit drei Etagen, war zwar maschinell machbar, erforderte
allerdings eine neue Baugenehmigung. Damit war klar, dass
sich das Projekt erneut verzögern würde: Auf die alte Genehmigung
hatte man schließlich auch lange warten müssen.
Doch an Zeit sollte es bald nicht mangeln: Als der alte
Wirtschaftshof endlich abgerissen werden konnte, weil der
neue fertig war, fand man nämlich nicht nur Asbest in alten
Rohren, sondern auch Granaten und Brandbomben in der
Erde. Das hieß Gutachten erstellen, Arbeiten ausschreiben,
abwarten. An dem Eröffnungstermin hielten die Investoren
dennoch eisern fest: Im Jahr 2010, so hieß es bei der Great
Berlin Wheel GmbH, würde sich auf dem Areal am Zoo das
Rad drehen.
2009 war hier aber weder die Abflughalle noch das Riesenrad
gewachsen, dafür ein paar Meter weiter Knut. Der kleine
Knuddelbär hatte sich über die Jahre in ein wahres Raubtier
verwandelt. Das Kindchenschema hatte sich zur groben
Eisbärschnauze verzogen. Das Fell war nicht mehr strahlend
weiß, sondern oft so dunkel vom Dreck, dass sogar die „Süddeutsche
Zeitung“ irritiert fragte, ob es sich bei Knuts Vater
nicht doch um einen Braunbären gehandelt haben könnte.
Seine Unschuld hatte Knut in den Augen seiner Anhänger
spätestens in dem Moment verloren, als diese fassungslos
beobachten mussten, wie sich der Bär die zehn Karpfen, die
man in seinem Teich als tierische Putzkolonne ausgesetzt
hatte, genüsslich in den Rachen schob.
Es kamen immer weniger Menschen zu Knut in den Zoo.
Ein paar Tierschützer waren darunter und betrachteten den
Bären mit wachsender Sorge. Einer von ihnen diagnostizierte
aus der Ferne gar eine „erhebliche Störung“. Knut bewege
sich stereotyp, strecke etwa 200 Mal am Tag die Zunge raus
und winke ständig. Langsam wurde es wirklich Zeit für das
Riesenrad.
Im Frühjahr 2010, als sich das Rad eigentlich längst
drehen
sollte, hofften die Investoren, endlich mit dem Bau
beginnen zu können. Allerdings gab es noch ein kleines Problem:
Es fehlte das Geld. Das Projekt sollte mit Krediten
aus dem 2006 aufgelegten Fonds Global View finanziert werden.
Doch ohne Baugenehmigung, so erklärte die Great Berlin
Wheel GmbH, hatten sich kaum Kreditgeber gefunden.
In Berlin blieb man zunächst gelassen. Kommt Zeit,
kommt Rad. Und kommt es nicht, dann hätte Berlin zumindest
keinen großen Schaden davon. Immerhin war das
Grundstück bezahlt und von der Hälfte der Kaufsumme hatte
der Zoo bereits einen nagelneuen Wirtschaftshof bekommen.
Den konnte ihm niemand mehr wegnehmen. Genauso
wenig wie Knut übrigens, den die Berliner inzwischen in Neumünster
bezahlt hatten – nicht mit „ein paar Pinguinen“, wie
der Zoodirektor vorgeschlagen hatte, sondern mit 430 000
Euro, was ebenfalls zu verschmerzen war, soll Knut doch allein
in seinem ersten Lebensjahr ein Plus von fünf Millionen
eingespielt haben.
Auch in Sachen Riesenrad hatte die Stadt zunächst tatsächlich
nicht zu leiden. Dafür andere. Mehrere tausend Anleger
hatten gut 200 Millionen Euro in den Fonds Global
View eingezahlt, der neben dem Rad in Berlin auch eines in
Peking und ein weiteres in Orlando plante und den die Stiftung
Warentest bereits 2007 als „riskant“ eingestuft hatte.
Im Februar 2010 erfuhren die Anleger, dass das Rad in China,
das eigentlich 2008 eröffnet werden sollte, mitten im Insolvenzverfahren
steckte. Immerhin hatte man dort schon das
Fundament geschaffen. In Orlando stand hingegen so wenig
wie in Berlin.



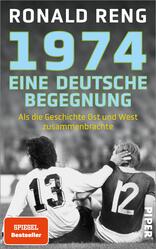
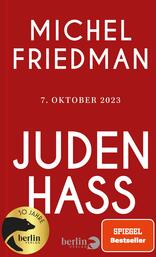
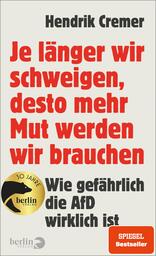
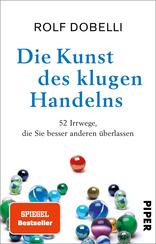
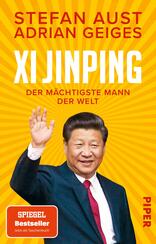



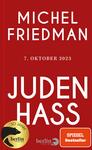
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.