
Unter Feinden
Roman
„Mich hat Oswald sofort gekriegt: 'Unter Feinden' ist ein hart kalkulierter Thriller, professionell nach angloamerikanischem Vorbild gearbeitet – mit dem kleinen, aber wirkungsvollen Trick, die hässlichen Konflikte aus Einwanderungsländern wie Frankreich oder Großbritannien auf Deutschland hochzurechnen.“ - Der Tagesspiegel
Unter Feinden — Inhalt
Diller ist angespannt und nervös im Vorfeld der internationalen Sicherheitskonferenz. Aber das ist es nicht. Sein Partner Kessel ist auf Drogen, und als der in Panik einen jungen „Arab“ überfährt, steckt Diller voll mit drin. Während Diller die internen Ermittlungen gegen sich und Kessel zu kontrollieren versucht, muss er weiter seine Arbeit tun und ein mögliches Attentat auf die Konferenzteilnehmer verhindern. Und die Uhr tickt. Denn wenn der junge „Arab“ aus dem Koma erwacht, wird er erzählen, wer ihn lebensgefährlich verletzt hat. Viel zu lange ist Diller nicht klar, dass sein alter Freund Kessel ein noch viel größeres Problem ist.
Wut, Verunsicherung, Mord – Georg M. Oswald zeigt in seinem mitreißenden literarischen Thriller die dunkle Seite des leuchtenden Münchens.
Leseprobe zu „Unter Feinden“
Mittwoch, 16. Januar
Es waren vier oder fünf Typen, die im Halbdunkel der einzigen intakten Straßenlaterne unter dem Basketballkorb herumhingen. Diller hatte seinen Sitz so weit wie möglich zurückgeklappt und sah von Zeit zu Zeit zu ihnen hinüber. Neben ihm auf dem Fahrersitz saß Kessel, der es sich auf die gleiche Weise bequem gemacht hatte. Vier oder fünf junge Männer, aber nicht immer dieselben. Ein paar gingen, ein paar kamen. Türken, Albaner, Nordafrikaner, Iraker, Iraner, was auch immer – Arabs jedenfalls. Warum waren sie so geschäftig, ständig in [...]
Mittwoch, 16. Januar
Es waren vier oder fünf Typen, die im Halbdunkel der einzigen intakten Straßenlaterne unter dem Basketballkorb herumhingen. Diller hatte seinen Sitz so weit wie möglich zurückgeklappt und sah von Zeit zu Zeit zu ihnen hinüber. Neben ihm auf dem Fahrersitz saß Kessel, der es sich auf die gleiche Weise bequem gemacht hatte. Vier oder fünf junge Männer, aber nicht immer dieselben. Ein paar gingen, ein paar kamen. Türken, Albaner, Nordafrikaner, Iraker, Iraner, was auch immer – Arabs jedenfalls. Warum waren sie so geschäftig, ständig in Bewegung, reden, debattieren, streiten, weggehen, wiederkommen? Obwohl nicht zu erkennen war, was genau sie taten, war es mehr als offensichtlich. Diller wusste es, Kessel auch, doch sie vermieden, darüber zu sprechen. Nur aus den Augenwinkeln schauten sie hin, so als wäre es ihnen voreinander peinlich. Was auch der Fall war. Ihr Auftrag bestand darin, auf die andere Straßenseite zu sehen und zwei Fenster in dem heruntergekommenen Mietshaus gegenüber im Auge zu behalten. Sie taten es jetzt über eine Stunde lang, und wenn es nach ihrem Präsidenten ginge, würden sie es noch die ganze Nacht tun. Es handelte sich um zwei Fenster im dritten Stock. Wenn sich dahinter tatsächlich jemand befand, hielt er sich seit sie hier waren im Dunkeln auf und würde es wohl auch die ganze Nacht lang tun, weil er begriffen hatte, dass er observiert wurde. Wahrscheinlicher aber war, dass sich niemand in der Wohnung aufhielt und sie die nächsten acht Stunden völlig nutzlos im Auto sitzen, die schwarzen Fenster anstarren und schließlich, völlig übermüdet und ohne jedes Ergebnis, ins Präsidium zurückfahren würden.
Was wirklich interessant war, spielte sich währenddessen unter dem Basketballkorb ab. Die Jungs dealten, das sah ein Blinder, und Diller hätte ihnen zu gerne einen Besuch abgestattet, was auch immer daraus geworden wäre. Aber das war nicht möglich. Er musste sich um seine beiden schwarzen Fenster kümmern. Und um Kessel.
Es war warm für eine Nacht im Januar. Einige von den Arabs liefen in T-Shirts herum. Kessel fror. Er trug einen Wollpulli und ein Tweedjackett und zog trotzdem die Schultern nach vorn, Diller bemerkte, dass er sich bemühte, sein Zittern zu unterdrücken, das ihn wie ein Vorbeben erfasst hatte.
Diller und Kessel kannten einander länger als zwanzig Jahre und wussten mehr voneinander, als andere je wissen durften. Zum Beispiel über Kessels Verhältnis zu Suchtstoffen aller Art. Als sie jung waren und bei der Drogenfahndung viel Zeit miteinander verbrachten, hatte Diller einen relativ genauen Überblick über Kessels Konsumgewohnheiten. Lange Zeit schien es, als habe Kessel die Sache im Griff. Nie rutschte er ganz ab, immer fand sich ein Ausweg. In der Gegenwart angelangt, hielt Diller ihn für ein polytoxisches Wrack und zugleich für ein biologisches Wunder, das immer noch lebte, obwohl es in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren alles zu sich genommen hatte, was es an verbotenen Substanzen in diesem Land zu kaufen gab. Nie so viel, dass es kein Zurück mehr gegeben hätte, aber eben doch viel zu viel. Diller ahnte das mehr, als dass er es wusste. Immer wieder gab es Ruhephasen, kalte Entzüge, das Gelöbnis der Besserung. Vor etwa sechs Jahren, versicherte ihm Kessel, habe er die Drogen endgültig aufgegeben. Alkohol hatte ihn bis dahin nicht sonderlich interessiert, doch nun fing er an, exzessiv zu trinken. Suchtverschiebung in Reinform.
Im Präsidium war Kessels Alkoholismus lange Zeit, zumindest offiziell, eine unausgesprochene Tatsache geblieben. Diller hatte sich nicht an dieses scheinheilige Tabu gehalten. „Du solltest eine Therapie machen“, hatte er ihm nach besonders schlimmen Nächten geraten. „Du solltest mich am Arsch lecken“, hatte Kessel geantwortet. Doch vor ziemlich genau zwei Jahren war es so weit gewesen. Eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte Kessel beinahe umgebracht. Zuerst kam der Zusammenbruch, dann die Therapie. Kessel war seitdem drogenfrei und trocken, sagte er und sagte der Bluttest, dessen Ergebnis er vor seiner Rückkehr in die aktive Einheit eingereicht hatte.
Sein Zittern sagte etwas anderes. Er war seit zwei Jahren zum ersten Mal wieder im Dienst auf der Straße unterwegs. Vor dem Einsatz hatte Diller Kessel gefragt, ob er das durchstehen würde. Kessel hatte ihn mit einem verächtlichen Blick bedacht. Doch mittlerweile war für Diller klar, dass Kessel in der Anfangsphase eines Entzugs steckte. Er hatte sich offenbar vorgenommen, in dieser Nacht, oder vielleicht auch nur, während Diller Zeuge war, nichts zu sich zu nehmen. Diller hätte gerne gewusst, wie Kessel den Bluttest gefälscht hatte, aber er fragte ihn nicht, weil er ohnehin keine Antwort bekommen hätte. Es war im Augenblick auch nicht wichtig. Wichtig war, eine Antwort auf die Frage zu finden, was er jetzt tun sollte. Nach den Vorschriften durfte man während einer Observation das Fahrzeug nicht verlassen, aber die Vorschriften waren nicht für siebenundvierzigjährige Suchtkranke gemacht, deren Entzugserscheinungen außer Kontrolle gerieten.
Es würde nicht mehr lange dauern, bis sich Kessel in Krämpfen wand. Diller konnte nicht einfach dabei zusehen, so viel stand fest. Einen Krankenwagen zu rufen hätte Aufsehen erregt, und um Kessel in ein Krankenhaus zu bringen, hätten sie ihren Posten aufgeben müssen, zumal bei einer Behandlung durch einen Arzt Kessels Betrug aufgeflogen wäre. Es gab eine einfachere und bessere Lösung. Als sie vor ihrer Ankunft um den Block gefahren waren, hatte Diller um die Ecke einen Vierundzwanzig-Stunden-Laden gesehen. Dort konnte er bekommen, was er brauchte, um Kessel zu einem glücklicheren Menschen zu machen. Einfach kurz aussteigen, hingehen, Schnaps kaufen, zurückkehren und Kessel beruhigen, das war der Plan. Die Arabs unter dem Basketballkorb würden es nicht mitbekommen, und wenn doch, würde es sie nicht kümmern. Diller ließ noch einige Minuten vergehen, hörte auf Kessels immer unregelmäßigeres Atmen und beobachtete weiter die Typen. Egal, wie es ausging, er musste es tun, dachte er, und schließlich ließ er die Tür aufschnappen. Zu seiner Erleichterung schienen es die Jungs gar nicht mitzubekommen. Er stieg aus und ging los. Was für eine Scheißgegend. Hier wohnten nur Leute, die alles dafür gegeben hätten, umzuziehen, aber was sie hatten, war dafür eben nicht genug.
Diller ging langsam und sah nicht zu den Typen hinüber, als wäre es dann weniger wahrscheinlich, dass er ihnen auffiel. Mit jedem Schritt aber gewann er mehr Sicherheit, und schließlich war er ein ganz normaler Passant, der den Bürgersteig entlangging.
Als Diller den Laden betrat, griff der Mann an der Kasse unter die Theke, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Diller nickte ihm zu und machte seiner Meinung nach ein freundliches Gesicht. Er signalisierte, dass er sich nur etwas umsehen wollte. Der Mann an der Kasse, auch ein Arab, behielt die Hand unter der Theke und beobachtete ihn. Diller nahm eine Literflasche Cola aus Plastik und eine Flasche Jack Daniels aus dem Regal, bezahlte ohne ein Wort und verschwand wieder.
Kessel hatte gewartet, bis Diller um die Ecke gebogen war, und allein, dass er ihn endlich nicht mehr sah, machte ihn gesünder, plötzlich wieder handlungsfähig. Er hatte nichts gegen seinen alten Freund, aber er musste zusehen, dass er auf die Beine kam, und dabei konnte ihm niemand anderer helfen als er selbst. Er ging auf die Arabs zu, als erwarteten sie ihn. Er nahm den, den er für ihren Chef hielt, ins Visier. Ein großer, schlanker, fast zierlicher Kerl, olivfarbene Haut, etwas hervortretende Augen, schwarzer Trainingsanzug mit goldenen Streifen. Der daneben war offensichtlich sein Pitbull, gleiche Hautfarbe, einen Kopf kleiner, breite Schultern, Oberarme wie Hartgummiklötze. Kessel hätte ihren Anblick ulkig finden können, wenn er Zeit dafür gehabt hätte. Während er auf den Großen zuging, bauten sich die anderen neben dem Pitbull auf. Kessel blieb vor ihnen stehen. Er krümmte sich etwas. Die Nervenbahnen in seinen Armen zogen. Er musste sich ziemlich zusammenreißen, aber er sprach nicht, bis ihn der Große mit einer sparsamen, aber überheblichen Kopfbewegung dazu aufforderte.
Kessel wollte keinen Zweifel daran lassen, dass er wusste, woran er war. „Du bist der Ice Cream Man, richtig?“
Die Typen sahen ihn einen Moment lang überrascht an, dann prusteten sie los: „Yo, yo!, Ice Cream Man!“
Kessel ignorierte den Spott, er musste bei seiner Linie bleiben, doch der große Kerl, an den er seine Worte gerichtet hatte, antwortete nicht.
„Okay, okay, ich kenne euch nicht, ihr kennt mich nicht. Schlechte Bedingung für Geschäfte. Aber ich garantiere euch, ich bin sauber, clean. Ein schneller Deal, und ich bin weg.“
Alle außer dem Großen wieherten vor Lachen über den übergewichtigen, knebelbärtigen Mann in Jeans, Hemd und Jackett mit den angegrauten halblangen Haaren, der so komisch redete.
„Ich verstehe Sie nicht“, sagte der Anführer, und die anderen begriffen das als Signal, ruhig zu sein.
Kessel verstand, dass das hier schlecht lief, aber er wollte nicht so ohne Weiteres lockerlassen. Es konnte nicht so schwer sein, zu kapieren, was er wollte.
„Ich brauche Stoff. Ihr … kennt doch bestimmt jemanden.“
„Wir haben keinen ›Stoff‹. Und selbst wenn wir welchen hätten: Können Sie uns einen vernünftigen Grund nennen, warum wir ihn einem Polizisten verkaufen sollten?“
Das Siezen, die akzentfreie, fast schon gewählte Ausdrucksweise waren außergewöhnlich. Kessel konnte nicht leugnen, dass ihn das ein bisschen verunsicherte, aber es war ihm egal, weil er etwas brauchte, etwas von dem Zeug, das sie ganz sicher hatten. Woher sollten sie wissen, dass er ein Polizist war. Sie wollten ihn nur testen.
„Ich weiß, ich bin nicht ganz euer Alter, nicht euer Style, aber ich bin kein Bulle. Ich will einfach nur ein kleines bisschen von eurem Stoff, und ich bezahle dafür den Preis, den ihr mir nennt.“
Es war nicht schwer zu erkennen, dass Kessel jemand war, der tatsächlich was brauchte. Der Große fixierte ihn, prüfte ihn. War das hier eine Falle oder ein Geschäft?
Kessel half nach: „Überlegt doch mal. Wenn ich ein Bulle wäre: Warum sollten die Bullen jemanden wie mich schicken? Da gibt es viel coolere, die da arbeiten. Welche, die so aussehen wie ihr.“
Die Jungs reagierten mit gespielter Fassungslosigkeit. Wie war denn der Typ drauf?
Abrupt änderte der Große die Tonlage: „Woher willst du das wissen, und was soll das heißen, und warum verpisst du dich nicht einfach zurück in deine Karre zu deinem schwulen Kumpel?“
Er konnte seine Manieren also auch weglassen, und das Gesicht, das er dazu machte, ließ ahnen, dass das nur der Anfang war. Kessel behielt den Großen im Auge und blieb stehen, obwohl er begriff, dass er seine Chance, hier Drogen zu kaufen, vertan hatte. Falls er je eine gehabt hatte. Aber er wollte darüber nicht nachdenken, er brauchte einfach nur ein ganz kleines bisschen von diesem verdammten Stoff, um den komplett geistesgestörten Job durchzustehen, die ganze Nacht frierend in einem Auto zu sitzen und dabei auf zwei dunkle Fenster zu starren, hinter denen sich ganz offensichtlich niemand befand. Sein Unterzucker, sein Turkey, sein Was-auch-immer zwangen ihn zu handeln, und obwohl er wusste, dass es ein Fehler war, ein schlimmer, vielleicht sogar tödlicher Fehler, zog er seine HK aus dem Brusthalfter und hielt sie dem Großen ins Gesicht. Der blieb völlig ruhig. Kessel nahm alles zusammen, was er hatte, um nicht zu zittern. Ganz kurz gelang es ihm, aber schon nach ein paar Sekunden konnte er die Waffe nicht mehr still halten.
„Sie sind nicht der erste Bulle, den ich sehe, der drauf ist“, sagte der Große verächtlich. Ziemlich kaltblütig, dachte Kessel. Wer sagte ihm, dass der Bulle nicht einfach schoss, weil ihm plötzlich alles scheißegal war? Vielleicht wusste er, dass Bullen nie plötzlich alles scheißegal ist, wie schlimm auch immer es um sie stehen mochte.
Der Große griff langsam in die Hosentasche, holte ein kleines Plastiksäckchen heraus. Zwei weiß-rote Kapseln waren darin. Er schüttelte es wie ein Glöckchen zwischen Daumen und Zeigefinger, dann warf er es Kessel vor die Füße. „Heb’s auf.“
Kessel bückte sich und hielt den Kopf dabei oben, genauso wie seine Waffe. Ohne das Säckchen anzusehen, steckte er es in die Tasche.
„Und jetzt bezahl dafür.“
Als Diller um die Ecke bog, sah er die offene Fahrertür ihres Wagens, was ihn schlagartig in höchste Alarmbereitschaft versetzte. Kessel hatte das Auto verlassen. Das konnte alles Mögliche bedeuten, aber sicher nichts Gutes. Im nächsten Augenblick hatte er Kessel entdeckt. Er stand allein mit gezogener Waffe vor fünf jungen Arabs. Aber es sah nicht so aus, als hielte Kessel sie wirklich in Schach. Diller zog seine HK, hielt sie in der Rechten, in der Linken weiterhin die Plastiktüte mit dem Jack Daniels und der Colaflasche, und lief zu Kessel hinüber. Er vermied es zu rennen. Er wollte Bestimmtheit signalisieren, aber nicht Panik.
„Was ist denn hier los?“, fragte Diller Kessel, als er beim Basketballkorb ankam.
„Ich habe diese Jungs hier beim Dealen erwischt“, antwortete Kessel.
Diller sah, wie seine HK zitterte, wie unsicher er dastand. Er glaubte Kessel kein Wort, aber wenn das hier keine Katastrophe geben sollte, musste es ihnen gelingen, so schnell wie möglich zu verschwinden.
„Okay, guter Fang, Kessel“, sagte Diller. Es klang so offensichtlich gelogen, dass es wehtat.
„Hört zu, Leute. Für diesmal wollen wir es gut sein lassen. Aber lasst euch kein zweites Mal beim Dealen erwischen, klar? Wir kommen in Zukunft öfter hier vorbei. Aber fürs Erste war’s das, und die Sache bleibt unter uns. Das nächste Mal kommt ihr nicht so einfach davon.“
Die Arabs strahlten vor Hass und sie waren sprungbereit. Ein Zeichen des Großen, und sie würden Diller und Kessel in Stücke reißen. Es waren allein Dillers HK und sein verhältnismäßig klarer Kopf, der sie davon abhielt, es zu tun. Diller würde schießen, das spürten sie, und dann würde auch Kessel schießen.
„Ihr bleibt genau da stehen, wo ihr seid“, sagte Diller.
Mit vorgehaltenen Waffen gingen sie langsam Richtung Auto. Diller fürchtete, Kessel könnte stolpern.
„Gib mir die Schlüssel“, sagte Diller, als sie außer Reichweite waren.
„Ich fahre“, sagte Kessel.
„Was ist mit dir los, Erich? Gib die Schlüssel her, mit dir stimmt irgendwas nicht.“
„Ist mir scheißegal, wie du das siehst. Ich fahre.“
Sie drehten sich um und rannten zum Auto. Offensichtlich hatte Kessel jetzt so viel Adrenalin im Blut, dass er seine Entzugserscheinungen kurzzeitig vergessen konnte. Diller fühlte die Arabs in ihrem Rücken näher kommen. Kessel und er sprangen in den Wagen, und Kessel fuhr mit quietschenden Reifen los, bog um die nächste Ecke, an der Asphaltfläche entlang, als es einen Schlag tat. Im selben Moment hatte Diller ein Spinnennetz in der Windschutzscheibe vor Augen. Sie warfen Steine, und sie trafen gut. Kessel und Diller zogen die Köpfe ein, Kessel, der erstaunlich sicher fuhr, lenkte hin und her, ohne die Werfer zu sehen, und versuchte, ihnen auszuweichen. An der nächsten Straßenecke konnte man nur rechts abbiegen, eine enge Neunzig-Grad-Kurve, weiter an dem Asphaltplatz entlang. Kessel driftete, und als er gegenlenkte, sahen sie ihn an der Ecke stehen, den Pitbull, mit einem Baseballschläger bewaffnet, bereit zum Schlag. Er hätte die Scheinwerfer einschlagen können, ein Seitenfenster oder die Windschutzscheibe. Er hätte versuchen können, ihnen ein bisschen Angst zu machen, mehr eigentlich nicht. Aber das waren alles Gedanken, die Diller erst hinterher kamen. In diesem Moment war es einfach so, dass Kessel sofort auf den Pitbull zuhielt, als er ihn am Straßenrand stehen sah. Diller erkannte noch, wie der Ausdruck der Aggression im Gesicht des jungen Mannes in schneller Folge jenem der Verblüffung und des Entsetzens wich, bevor ihn der Kühler erfasste und durch die Luft schleuderte. Diller sah ihn im Seitenspiegel hinter ihnen auf dem Asphalt aufschlagen. Tot, dachte er.
Kessel schwieg, stierte auf die Straße und fuhr viel zu schnell.
„Fahr langsamer“, sagte Diller nachdrücklich. „Wir sind die Polizei. Erinnerst du dich?“
Kessel trat auf die Bremse und fuhr rechts ran. Diller glaubte zuerst, er würde ihm jetzt eine Szene machen wollen, den nächsten Irrsinn abliefern, aber es schien Etwas anderes zu sein. Kessel blieb auf dem Parkstreifen neben einem Wohnblock stehen. Sie waren nicht besonders weit gefahren, aber weit genug, um für einen Moment keine Verfolger fürchten zu müssen. Kessel drehte den Motor ab, das Licht im Innenraum ging aus, er sank in sich zusammen und verharrte regungslos. Diller wusste nicht, was er sagen sollte. Er war so gebannt von der Katastrophe, die gerade geschehen war, dass es ihm kaum gelang, einen Gedanken zu fassen. Wenn das herauskam, waren sie beide ihre Jobs los. Für Kessel wäre es das sichere Ende, er konnte sich die Kugel geben. Mörder wurden von den schmierigeren unter den privaten Sicherheitsdiensten zwar gerne genommen, aber nicht wenn sie dazu noch alt, drogensüchtig und alkoholkrank waren. Für Diller sah es nicht viel besser aus. Er hätte die Observation abbrechen und Kessel in ein Krankenhaus fahren müssen. Kessels Laufbahn als aktiver Ermittler wäre damit für alle Zeiten beendet gewesen, seine aber nicht. Professionelle Helfer hätten sich um Kessels Alkohol- und Drogenproblem gekümmert. Diller hätte wahrheitsgemäß angeben können, davon nichts gewusst zu haben. Stattdessen war er losgezogen, um Sprit für ihn zu kaufen, und hatte ihn allein im Wagen zurückgelassen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon gewusst hatte, dass ihm, einem rückfälligen Süchtigen, nicht zu trauen war. Alles, was danach kam, war folglich allein Dillers Schuld. Wenn man wollte, konnte man es so sehen, und der Präsident würde es so sehen, da war er sicher. Diller dachte an seine Familie und an die Schmach, auf diese Weise seinen Job zu verlieren.
Es musste eine bessere Lösung geben.
Zuerst einmal mussten sie alles tun, um ihre Lage nicht weiter zu verschlimmern. Für Diller hieß das, er musste Kessel so schnell wie möglich an einen Ort bringen, wo er die nächsten zwölf Stunden gefahrlos bleiben konnte. Dazu musste es ihm aber erst gelingen, ihn zurück in die Gegenwart zu bekommen. Kessel saß da, als wäre er im Sitzen gestorben. Diller griff nach der Plastiktüte, die an seinen Füßen lag. Er öffnete die Autotür einen Spalt, goss die halbe Cola-Flasche auf den Asphalt und füllte sie mit Jack Daniels wieder auf. Dann hielt er sie Kessel hin. Der saugte an der Flasche wie ein Baby, in gierigen, langen Zügen, dann setzte er ab, rülpste und gab die Flasche zurück. Diller stieß ihm freundschaftlich mit
der Faust gegen den Oberarm und sagte: „Steig aus. Lass mich fahren.“ Kessel gehorchte ohne ein Wort.
Diller suchte nach einer Lösung. Er wusste nicht, ob Kessel wirklich auf Drogen war, aber er musste es jetzt annehmen. Was sonst hätte er von den Arabs haben wollen?
„Ich bringe dich jetzt in deine Wohnung. Dort bleibst du so lange, bis ich mich bei dir melde, hörst du? Du gehst nicht ans Telefon, und du redest mit niemandem. Brauchst du irgendetwas, was wir vorher noch besorgen sollten?“
Diller bemühte sich um einen halbwegs gelassenen, kollegialen Ton, der Zuversicht verströmen sollte.
Kessel griff den Ton auf. „Ich bin kein Junkie, Markus. Ich wollte keine Drogen von den Typen. Du hast doch bemerkt, dass sie die ganze Zeit zu uns herübergesehen haben. Wir hatten noch die ganze Nacht vor uns. Ich wollte mir einfach Respekt verschaffen. Es ist eskaliert. Es war ein Unfall. Und weil du’s wissen wolltest: Mit der Flasche hier komme ich aus, bis wir zu Hause sind, und da ist mehr.“
Diller verzog den Mund ein bisschen, weil er ahnte, dass das als Scherz gemeint und zugleich wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit war.
„Wenn wir dichthalten, können die uns nichts“, sagte er.
Sie wussten beide nur zu gut, dass das nicht stimmte. Aber es blieb ihnen nichts anderes übrig, als daran zu glauben.
Kessel wohnte in einem mindestens hundert Jahre alten, völlig verdreckten Haus in der Goethestraße auf Höhe des Hauptbahnhofs, in einem Viertel voller arabischer Obst- und Gemüseläden, türkischer Supermärkte, Sexshops, Automatenkasinos, Animierlokale und schäbiger Kneipen. Der Eingangsbereich stand für jedermann offen, blaue Müllsäcke lagen darin herum, und es stank nach Pisse. Hinter einem Eisengitter, für das nur die Bewohner einen Schlüssel besaßen, lag das Treppenhaus, und es gab sogar einen Lift, der funktionierte.
Obwohl sie sich so lange kannten, war Diller noch nie in Kessels Wohnung gewesen. Sie übertraf seine schlimmsten Erwartungen. Ein dunkles, unaufgeräumtes Anderthalbzimmerapartment, in dem es nach Essensresten, schmutziger Wäsche, Alkohol, kalter Asche und verzweifelter Männereinsamkeit roch. Seinem Bewohner durfte man alles zutrauen. Diller bemühte sich, so schnell und unauffällig wie möglich Dinge zu entdecken, die auf Drogenkonsum schließen ließen: Aluminiumfolie, gelbbrauner Glaskolben, verrußter Löffel, Röhrchen, Päckchen. Es fiel ihm nichts auf. Kessel rieb sich die Handflächen, trat von einem Bein aufs andere. Es war ihm sichtlich unangenehm, Besuch zu haben.
„Sie werden versuchen, dich zu finden. Kollegen, Arabs, andere Leute“, sagte Diller. „Du gehst nicht vor die Tür, hörst du? Wenn du Stoff brauchst, sag es jetzt. Es besteht eine winzige Chance, dass wir das wieder geradebiegen können. Versau es kein zweites Mal, okay?“
Kessel nickte schuldbewusst mit gesenktem Kopf und halb erhobenen Händen.
„Du hast recht, Markus. Ich bin okay, Markus. Ich werde hierbleiben, bis du mich anrufst. Ich werde nicht ans Telefon gehen, wenn ich nicht weiß, dass du es bist. Ich gehe nicht an die Tür. Ich bin nicht da, solange du mich nicht auf diesem Handy hier anrufst und ich deinen Namen auf dem Display sehe.“
Diller nickte. Kessel war jetzt auf eine Art schicksalsergeben, die ihm nicht gefiel. Es kam ihm in den Sinn, wie Kessel ausgesehen hatte, als er auf den Typen mit dem Baseballschläger zugefahren war. Pure, eiskalte Aggression.
Diller verabschiedete sich mit einer knappen Handbewegung und zog die Tür hinter sich zu. Er lief zum Wagen und fuhr nach Hause. Als er von der Wolfratshauser Straße in die Siemensallee einbog, fuhr er langsamer. Er überprüfte in allen Spiegeln, ob irgendjemand in der Nähe war. Nichts. Er reduzierte die Geschwindigkeit weiter, auf etwa zwanzig Stundenkilometer, zog dann den Wagen nach rechts und prallte mit der rechten Front gegen einen der Alleebäume. Er war langsam genug gewesen, um den Wagen nicht zu stark zu beschädigen. Er setzte zurück und fuhr weiter.
Kessel fischte das Plastiksäckchen aus der Tasche, zog Jackett, Schuhe und Hose aus und ging ins Bad. Er hatte es jetzt eilig. Er löste eine Kachel aus der Wand hinter der Kloschüssel und holte heraus, was er dort versteckt hielt. Steril verpackte Einwegspritzen, einen Löffel. Er zerbrach eine der rot-weißen Kapseln und kochte sich mit dem Feuerzeug einen Schuss auf, den er sich in eine Vene im Unterschenkel spritzte. In wenigen Sekunden löste sich jede Anspannung, und ihm wurde klar, dass er sich außerhalb jeder Gefahr befand. Der Große hatte ihn demütigen wollen, und es war ihm beinahe gelungen. Nur gerecht, dass er dem Typen mit der Keule eine Lektion erteilt hatte. Aber der Stoff war gut, das musste er zugeben. Er hatte die Sache im Griff, absolut und eindeutig im Griff, dachte er und ahnte zugleich, dass das nicht stimmen konnte. Er saß in Unterhosen auf dem Klodeckel, lehnte sich mit dem Kopf seitlich an die Wand, und langsam entgleisten seine Gesichtszüge.
Es war halb ein Uhr nachts, als Diller vor dem Reiheneckhaus in Solln parkte, das er seit ein paar Jahren mit seiner Familie bewohnte. Als er ausstieg, tauchte ein Wachmann des privaten Sicherheitsdienstes auf, der die Makartstraße bewachte, seit es hier in der Gegend eine Serie von Einbruchsdiebstählen gegeben hatte. Ein großer, kantiger Kerl in einer amerikanisch aussehenden Uniform. Er patrouillierte zu Fuß. Diller und er kannten sich vom Sehen. Diller wusste, dass der Mann Schneider hieß und wie so viele Mitarbeiter privater Sicherheitsfirmen ein ehemaliger Polizist war. Er war ungefähr halb so alt wie Diller und hatte wohl sofort nach der Ausbildung gewechselt. Vielleicht hatte er etwas ausgefressen. In ihren kurzen Gesprächen vor dem Haus taten sie so, als wären sie Kollegen, aber Diller spürte Schneiders Missgunst, von der er nicht genau wusste, worauf sie sich bezog. Auf das Haus vielleicht, die Familie, ganz allgemein vielleicht auf ein Leben, von dem er sich zu Unrecht ausgeschlossen fühlte.
„N’Abend, Herr Diller. Da hat’s aber ganz schön gekracht, was?“
Diller hätte nicht entscheiden wollen, ob es Neugier oder Schadenfreude war, die in Schneiders Stimme lag. Schneider blieb vor dem Wagen stehen und besah sich die verbeulte Kühlerhaube und die zersplitterte Verbundglasscheibe.
„Von der Straße abgekommen. Nicht der Rede wert.“
Schneider ignorierte Dillers Wunsch, es kurz zu machen. „Ah, und das da war wohl Steinschlag, wie?“ Er deutete auf die Scheibe.
„Könnte es Ihnen nicht sagen. Ging alles so schnell.“
„Das wird Ihre Dienststelle aber nicht freuen?“
„Ich vermute mal, das wird denen egal sein. Die haben Wichtigeres zu tun, als sich den Kopf über Blechschäden zu zerbrechen.“
„Von der Straße abgekommen. Obwohl es gar nicht glatt ist.“
Diller passte es nicht, dass Schneider sich so sehr für den Wagen interessierte. Beinahe provozierend.
„Ich war unaufmerksam. Das ist alles. Ich hoffe, Sie können von sich immer das Gegenteil behaupten.“
„Das hoffe ich auch, Herr Diller. Im Ernst. Bisher war die Nacht ruhig.“
„Ich sehe, Sie haben vorgesorgt. Soll ja noch kalt werden “, sagte Diller in Anspielung auf Schneiders dick gepolsterte Kleidung.
„Ja, soll einen Temperatursturz geben in den nächsten Stunden. Und morgen früh dann warmen Wind aus der Wüste.“
„Ja, irres Wetter.“
Die Männer wünschten einander eine gute Nacht, Schneider warf noch einmal einen Blick auf die eingedrückte Front des Wagens und schüttelte merklich den Kopf. „Kümmere dich doch um deinen eigenen Scheiß, du Trottel“, zischte Diller leise, als er das schwere Sicherheitsschloss der Haustür aufsperrte. Er zog sich im Dunkeln aus, warf seine Klamotten über einen Stuhl und ging dann ins Schlafzimmer, wo Maren längst schlief. Er schlüpfte auf seiner Seite des Bettes unter die Decke. Die Suspendierung, die ihm morgen bevorstand, war das Letzte, woran er dachte, bevor er erschöpft einschlief.
Donnerstag, 17. Januar
Beim Frühstück bemühte er sich, so alltäglich wie möglich zu erscheinen, obwohl er befürchtete, Kollegen könnten jeden Augenblick mit einem Haftbefehl gegen ihn vor der Tür stehen. Es störte ihn, dass Luis, sein dreizehnjähriger Sohn, nicht aus dem Bett fand. Luis musste um Viertel nach sieben das Haus verlassen, jetzt war es zehn vor, und er stellte sich immer noch tot. Trotzdem schaffte er es irgendwie, zehn Minuten später am Frühstückstisch zu sitzen. Ein Mensch gewordener Vorwurf in einem gelben FUCKUALL-T-Shirt. Diller fand, Luis war zu dünn angezogen, und das T-Shirt gefiel ihm nicht. Eine kurze Zeit schwiegen sie alle und aßen. Dann hielt es Diller nicht länger aus.
„Glaubst du, das ist die richtige Botschaft an einem katholischen Gymnasium?“
Diller wollte diese Frage eigentlich gar nicht stellen. Es interessierte ihn weder dieses bescheuerte T-Shirt noch, was irgendjemand darüber dachte. Er hatte einzig und allein das Bedürfnis, jemanden anzuschnauzen.
„Es ist ein Modelabel. Es bedeutet nichts“, sagte Maren.
„So. Ein Modelabel. Verstehen das Priester auch?“
„Es gibt nur einen Priester an der Schule, und der hat mit diesem T-Shirt bestimmt kein Problem.“
„Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet es, ›fickt euch alle‹! Ich hätte ein Problem, wenn jemand in meiner Abteilung so ein T-Shirt tragen würde.“
Luis rollte die Augen. „Muss ich es ausziehen?“ Er richtete die Frage an Maren, ohne sie wirklich zu stellen.
„Natürlich nicht. Es ist ein T-Shirt, Markus. Mona hat es ihm geschenkt“, sagte Maren.
„Na, wenn Mona es ihm geschenkt hat, dann kann es ja nicht verkehrt sein“, sagte Diller.
Er wusste, dass er mit diesem Satz den Ärger vergrößerte, weil er sich nicht nur gegen Luis, sondern auch
Gegen Mona und Maren richtete, und auf eine verzwickte Art wollte er genau das: sich mit all denen anlegen, die er liebte und die er so sehr würde enttäuschen müssen.
Luis stand auf und brachte sein Geschirr in die Küche. Diller hielt das für einen Aufbruch unter Protest, aber Luis kam mit einem Blatt Papier in der Hand zurück.
„Demnächst ist in der Schule ein Theaterabend. Ich will da hingehen. Ich brauche eure Unterschrift, dass ich darf.“
Diller war überrascht. Es war ihm neu, dass sich Luis fürs Theater interessierte. Aber seine schlechte Laune konnte er nicht sofort aufgeben.
„Und die Eltern? Sind die nicht eingeladen?“
„Ich glaube nicht, dass euch das interessiert.“
„Woher willst du das wissen? Was wird denn gespielt?“
„Mockinpott.“
Luis sprach den Titel aus, als wäre er so berühmt wie Faust oder Romeo und Julia. Diller hatte ihn noch nie gehört, was er aber gewiss nicht zugegeben hätte.
„Mockinpott also. Prima, da gehen wir hin, nicht wahr, Maren?“
„Warum nicht?“, sagte sie. Sie schien zufrieden, dass sich ihr Mann beruhigte.
Diller setzte seine Unterschrift auf das Papier und bat Luis, zwei Karten für sie zu besorgen.
„Werd sehen, was ich machen kann“, sagte Luis, betont gönnerhaft, packte seine Sachen zusammen und machte sich auf den Schulweg.
Diller beeilte sich, ebenfalls loszukommen und dabei Maren auszuweichen, die, das spürte er, wissen wollte, was wirklich mit ihm los war.
Über Nacht war es tatsächlich fünfzehn Grad kälter geworden, und es waren bestimmt zwanzig Zentimeter Schnee gefallen. Der milden Nacht im Januar folgte ein klirrend kalter Wintertag. Die Luft fuhr Diller eisig in die Lungen, als er vor die Haustür trat, ohne Hoffnung, einer weiteren Begegnung mit dem Wachmann entkommen zu können. Bei seinen ersten Schritten prüfte er den Untergrund. Der Boden war vereist. Das war gut. Vielleicht waren die Spuren, die sie im Westend bei ihrem Unfall hinterlassen hatten, schon verloren. Diller sah sich um, bevor er anfing, die kaputte Windschutzscheibe des Dienstwagens freizukratzen. Das schwarze SUV der Sicherheitsleute parkte am Anfang der Makartstraße. Schneider saß darin und erwartete frierend und übernächtigt das Ende seiner Schicht. Er hob mit einem aufgesetzten Lächeln die Hand zum Gruß. Diller deutete eine Erwiderung an. Schneider würde jede Gelegenheit nutzen, um bereitwillig auszusagen, wann er Diller wo begegnet und was ihm dabei aufgefallen war, und er würde es genau mit diesem aufgesetzten Lächeln tun. Wahrscheinlich war es nicht einmal etwas Persönliches. Es wäre ihm genug, sich ein bisschen wichtig zu fühlen, zu zeigen, dass er auf dem Posten war. Der Schnee hatte die lädierte Kühlerhaube dick genug bedeckt, um den Blechschaden am Kühlergrill zu verbergen. Diller wischte noch das Dach frei, stieg ein und fuhr los. Als er an Schneiders Wagen vorbeikam, wich er seinem Blick aus.
Dillers Ermittlungsapparat setzte sich in Gang, jener komplizierte Mechanismus aus Erfahrung, Beobachtung und Verdacht, der ihn seine Entscheidungen treffen ließ. Doch anders als sonst, richtete sich dieser Apparat jetzt nicht gegen jemanden, den er verfolgte, sondern gegen ihn selbst.
Diller ging Schritt für Schritt durch, was er jetzt zu tun hatte. Zuerst musste er den Wagen wegbringen, dann so früh wie möglich zu Strauch, dem Leiter des gestrigen Einsatzes, um seinen Bericht abzugeben. Mündlich vorerst. Wie lagen die Fakten? Falls sich in der Wohnung in der Geroltstraße nachts nichts getan hatte, würde sich verheimlichen lassen, dass sie die Observierung abgebrochen hatten. Nicht verheimlichen ließ sich hingegen, dass Kessel mit ein paar jugendlichen Drogendealern in Streit geraten und Diller dazugekommen war, bevor die Situation eskalierte. Und erst recht nicht ließ sich verheimlichen, dass sie wenig später einen dieser jungen Männer überfahren hatten. Auch wenn sie niemanden gesehen hatten, würde es dafür Zeugen geben. Sie würden aussagen, dass der zivile Polizeiwagen auf den jungen Mann zugehalten und nicht gebremst hatte. Dafür, dass die Jugendlichen Drogen verkauften und dass der Pitbull mit seiner Baseballkeule ihre Windschutzscheibe zertrümmern wollte, gab es selbstverständlich keine Zeugen. Dafür gab es nur Kessels und Dillers Aussagen, und die wären, wenn es darauf ankäme, nichts weiter als Schutzbehauptungen. Schneider und Dillers Familie dagegen konnten wahrheitsgemäß angeben, dass er die zweite Hälfte der Nacht zu Hause verbracht hatte, was ausreichte, um ihm ein Dienstvergehen, die eigenmächtig abgebrochene Observation, nachzuweisen. Schneider konnte darüber hinaus sicher wörtlich ihre Unterhaltung wiedergeben und den Schaden an dieser Karre genau beschreiben. Es war aussichtslos. Sollte sich irgendjemand auch nur die geringste Mühe geben, ihn und Kessel fertigmachen zu wollen, würde es ihm mit Leichtigkeit gelingen.
Diller drehte das Radio an und suchte einen Nachrichtensender. Dann fischte er sein Handy aus der Jackentasche. Bevor er Kessels Nummer tippte, fragte er sich, ob irgendjemand irgendeinen belastenden Schluss daraus würde ziehen können, dass er Kessel jetzt anrief. Fuck you all, dachte er. Es war sowieso längst alles hinüber. Alles, was er noch tun konnte, war, ein bisschen zu zappeln, sich ein bisschen zu wehren. Also tat er es. Er hatte keine genaue Idee, was er mit Kessel besprechen wollte, aber es gab einige Dinge zu klären. Ob er noch lebte, zum Beispiel. Ob er in der Zwischenzeit Besuch bekommen hatte. Dass er noch immer unter keinen Umständen die Wohnung verlassen, mit niemandem sprechen durfte. Kessel nahm nicht ab, was nur dazu führte, dass Diller sich noch mehr Sorgen machte.
Endlich brachten sie im Radio die Meldung, auf die er gewartet hatte. Aber es klang ganz anders als das, womit er gerechnet hatte:
„Bei einem Polizeieinsatz im Münchner Westend kam es in der vergangenen Nacht zu schweren Krawallen, nachdem ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden war. Mehrere Dutzend Jugendliche in dem überwiegend von Einwanderern bewohnten Stadtviertel bewarfen Streifenpolizisten mit Flaschen und Steinen. Einige Fahrzeuge, darunter auch ein Polizeiauto, gingen in Flammen auf. Mülltonnen wurden in Brand gesteckt. Nach ersten internen Ermittlungen waren die Beamten nicht in den Unfall verwickelt. Zahlreiche Zeugen berichteten aber, die Polizisten hätten sich nicht sofort um das Unfallopfer gekümmert. Dies sollen die Ermittlungen klären. Kurze Zeit nach dem Unfall versammelten sich Dutzende, später Hunderte Jugendliche in der Nähe des Schauplatzes. Bei weiteren Ausschreitungen wurden nach Angaben der Behörden zwei Polizeiwachen zerstört und etwa zwanzig Geschäfte und eine McDonald’s-Filiale geplündert.
Berichten zufolge sollen Jugendliche mit Schrotgewehren auf Polizisten und Journalisten geschossen haben. Ein Sprecher der Polizeigewerkschaft teilte mit, achtunddreißig Beamte seien bei den Unruhen verletzt worden, drei davon schwer. Auch ein Journalist zählte zu den Verletzten. Das Polizeipräsidium teilte mit, zwei Jugendliche seien in Gewahrsam genommen worden. Am frühen Morgen wurde die Lage von dem seit Anfang des Monats im Amt befindlichen Polizeipräsidenten März in einer Stellungnahme als ›nach wie vor explosiv‹ bezeichnet. Die Familie des Opfers rief die Protestierenden zur Ruhe auf.“
Diller konnte kaum glauben, was er hörte, und doch hoffte er sofort, dass sich diese Entwicklung günstig für ihn und Kessel auswirken könnte. Der Radiosprecher wies auf eine Sondersendung im Anschluss an die Nachrichten hin: „Aufstand im Westend – die Ursachen.“ Dann gab der Oberbürgermeister ein Interview. Er mimte den Besonnenen, versuchte die Sache herunterzuspielen, rief ebenfalls zur Ruhe auf.
Diller drehte das Radio ab und versuchte für das, was er gerade gehört hatte, eine Erklärung zu finden. Kessel und er hatten den Pitbull überfahren und waren geflohen. Der Pitbull lag am Boden. Schwer verletzt, aber nicht tot. Jemand rief die Polizei. Eine Funkstreife kam, vielleicht die beiden jungen Beamten, mit denen er tags zuvor gesprochen hatte. Um das Opfer scharten sich Leute aus der Nachbarschaft und sahen, dass es der Pitbull war. Ihn und seine Freunde, die auf dem Asphaltplatz herumhingen, kannten sie. Sie bedrängten die Polizisten, etwas zu unternehmen. Die Beamten riefen einen Krankenwagen, der unverständlich lange auf sich warten ließ. Der Unmut der Leute wuchs, ein junger Mann, ein Freund des Pitbulls, der sich besonders aufregte, schlug mit der flachen Hand auf die Kühlerhaube des Polizeiautos, die Polizisten reagierten falsch, ließen sich auf eine Autoritätsdiskussion ein, mehr Leute versammelten sich auf der Straße, der Krankenwagen kam nicht durch, einige stimmten Sprechchöre gegen die Polizei an, die Beamten forderten Verstärkung an, ein vergitterter Mannschaftstransporter erschien, die Leute fühlten sich herausgefordert, der erste Pflasterstein knallte gegen die Heckscheibe des Streifenwagens. Vielleicht war es so.
Vielleicht aber gab es auch Zeugen, die ihn und Kessel gesehen hatten. „Zwei Zivilbullen in einem blauen BMW. Hier, wir haben die Nummer.“ Und vielleicht wollten die Streifenpolizisten davon nichts wissen, wollten es nicht glauben, weil sie das in einer ohnehin für sie schwierigen Situation beinahe selbst schon zu Schuldigen gemacht hätte.
Diller griff noch einmal nach seinem Handy, rief Kessel an, der immer noch nicht abnahm, und sprach ihm auf die Mailbox: „Falls du noch am Leben bist, geh nicht vor die Tür, sprich mit niemandem, schau ins Internet, schalte den Fernseher ein und warte in deiner Wohnung, bis ich dich abhole. Es ist noch nicht vorbei.“
Die Leseprobe hat Ihnen gefallen?
Das Buch „Unter Feinden“ von Georg M. Oswald finden Sie überall im Buchhandel.
Mehr Informationen zu Georg M.Oswald und weiteren Büchern aus dem Piper Verlag unter
www.piper-verlag.de.
Der Jurist und Schriftsteller Georg M. Oswald legt mit „Unter Feinden“ einen packenden Thriller vor. Das Thema: Unmittelbar vor der Münchner Sicherheitskonferenz, an der die Mächtigsten der Welt teilnehmen, deutet alles auf einen Terroranschlag hin.
„Georg M. Oswald gehört in eine Reihe mit Richard Price und Håkan Nesser.“ Feridun Zaimoglu
Die Einordnung Ihres Buches „Unter Feinden“ in ein Genre fällt schwer. Was schlagen Sie vor?
Georg Oswald: Für mich fühlt es sich so an, als wäre es das erste Mal, dass ich einen echten Krimi geschrieben habe. Wobei: Mein Verleger sagt, das Buch sei mehr als ein Krimi. Andere nennen es einen Thriller. Ich weiß nicht, ob es so wichtig ist, wie man es nennt. Ich wollte eine Geschichte erzählen, die sich mit unseren Vorstellungen von Sicherheit beschäftigt. Polizisten sind nun mal berufsmäßig damit beschäftigt, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Da lag es nahe, dieses Genre zu wählen.
Was hat Sie an der Münchner Sicherheitskonferenz gereizt?
Georg Oswald: Eben das Thema Sicherheit. Sie gibt der Konferenz ihren Namen, zugleich scheint diese eine extrem unsichere Sache zu sein – oder warum sonst müssen Kanaldeckel versiegelt werden, Hundertschaften der Polizei die Innenstadt abriegeln, überall Personenkontrollen durchgeführt werden? Ein bisschen hochgestochen könnte man sagen: Die Sicherheitskonferenz ist eine Großmetapher für unsere Vorstellungen von Sicherheit und Bedrohung.
Sie sind Anwalt. Wie viel Einfluss hat der Jurist Oswald auf den Autoren Oswald?
Georg Oswald: Gerade bei diesem Thema war es hilfreich, dass ich weiß, wie es in einem Polizeipräsidium aussieht, eine Vorstellung davon habe, wie Ermittlungen geführt werden, weiß, wie Staatsanwälte und Richter in Verhandlungen und außerhalb reden. Ich konnte meine Erfahrungen als Anwalt als Material verwenden.
Warum entscheidet in „Unter Feinden“ kein Jurist über Schuld und Strafe, obwohl Sie einer sind?
Georg Oswald: Juristen sind auch nur Menschen und können nur über das urteilen, was sie kennen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, aber der Einzige, der am Ende von „Unter Feinden“ das wirkliche Ausmaß der Katastrophe kennt, ist der Leser.
Glauben Sie denn an eine moralische Gerechtigkeit?
Georg Oswald: Sich auf die Moral zu berufen, ist oft eine Anmaßung. Ich ziehe das Recht vor. Im demokratischen Idealfall besteht es aus Regeln, auf die sich eine Gesellschaft geeinigt hat und die sie dann einhält. Dann kommt sie ganz ohne mahnenden Zeigefinger aus.
„Gut geschrieben, spannend zu lesen und für Krimifans eine willkommene Abwechslung, auch das Münchner Westend hat düsteres Potential.“
„(…) düster, soghaft und von allerhöchster Spannung.“
„Unter Feinden ist ein packend erzählter Politikthriller, einer so plastische wie punktgenaue Charakterstudie über Wut und Verzweiflung sowie eine nachtschwarze Milieuschilderung. Mit Georg M. Oswald ist ein weiterer Stern am Himmel krimischreibender Anwälte aufgegangen. Von seinen unorthodoxen Ermittlern wünscht man sich weitere Geschichten.“
„Ein spannender und psychologisch sehr stimmiger Thriller über Polizisten zwischen Pflichttreue und Freundschaft.“
„Polizeiarbeit, Großstadt, Migration und moralische Fragwürdigkeiten in einer souveränen hardboiled-Prosa.“
„Ein kühler, kluger Krimi. Authentisch und ohne sentimentales Lokalkolorit.“
„Klasse geschrieben, Tiefgang mit Drive“
„Georg M. Oswald hat einen wunderbaren Thriller vorgelegt. Gentrifizierung, latenter Rassismus, wegschauende Behörden und korrupte Beamte – ein Plot, der sozialkritisch nicht aufgeladener sein könnte.“
„Er erzählt straight und lässt den kommenden Aufstand, von dem ein Manifest bereits in der Realität kündet, von den heruntergekommenen Hinterhöfen der vermeintlichen Hochburg der Beschaulichkeit bis auf die Maximilianstraße schwappen. Das macht den Reiz dieser Dystopie aus, die sich stark an der Wirklichkeit orientiert und sie nur ins Extrem fortspinnt. (…) Ein bis zum Ende spannender Thriller, der auf deine Fortsetzung hoffen lässt.“
„Reichlich Brandherde hat Georg M. Oswald in Unter Feinden versammelt, die großen Fragen ergeben sich nebenbei: Den guten Mord, gibt’s den? Wie viel Integrität ist erlaubt, wo muss der Korpsgeist enden? Sein spannender Thriller beantwortet sie alle.“
„Nicht nur spannend, sondern auch kluger Thriller über Terrorangst und gesellschaftliche Verunsicherung.“
„Lustvoll unterläuft der Münchner Rechtsanwalt alle dramaturgischen Klischees.“
„Georg M. Oswald zeichnet in seinem neuen Roman ein düsteres Bild von München, voller Ängste, Anspannung und Konflikte und weit entfernt von der Idylle, die sonst gern dargestellt wird. Ein spannender Krimi, der das alltägliche Sicherheitsgefühl in Frage stellt.“
„Ein cooler gegen den Strich gebürsteter Krimithriller!“
„Mich hat Oswald sofort gekriegt: 'Unter Feinden' ist ein hart kalkulierter Thriller, professionell nach angloamerikanischem Vorbild gearbeitet – mit dem kleinen, aber wirkungsvollen Trick, die hässlichen Konflikte aus Einwanderungsländern wie Frankreich oder Großbritannien auf Deutschland hochzurechnen.“
Georg M. Oswald gehört in eine Reihe mit Richard Price und Håkan Nesser!
„Der Schriftsteller Georg M. Oswald hat eine kühle Gesellschaftsanalyse im Schafspelz eines Unterhaltungsbuchs geschrieben. (...) Ein Buch, das - wie alle Bücher von Oswald - klüger ist als seine Oberfläche.“
„Ein richtig guter Krimi ist das, eine schnelle spannende Cop-Story, die sich hart an den Realitäten einer deutschen Großstadt stößt und die ihre Qualität dem Umstand verdankt, dass ihr Autor das Genre in seinem klassischen Kern erfasst hat.“
„Oswald, der erfahrene Anwalt für Arbeits- und Sozialrecht, ist auch ein politischer Autor, dessen Romane randvoll mit gesellschaftlicher Wirklichkeit sind.“
Zwar ist er Rechtsanwalt, aber schreiben kann er wie ein Advocatus Diaboli.





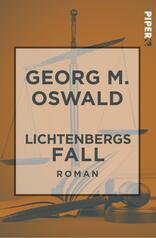










DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.