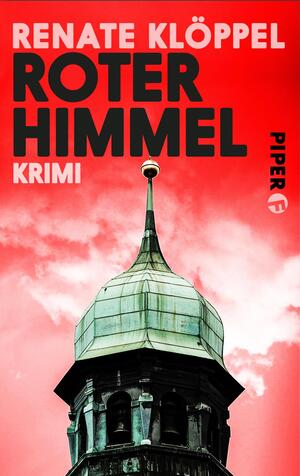
Roter Himmel (Alexander Kilian 6)
Kriminalroman
„Renate Klöppel versteht es, Spannung aufzubauen.“ - Badische Zeitung
Roter Himmel (Alexander Kilian 6) — Inhalt
Fassungslos steht der Medizinprofessor Alexander Kilian vor seinem brennenden Institut. Schon bald steht fest: Es muss Brandstiftung gewesen sein. Wenig später findet man in der Ruine die Leiche eines Mannes, der dort schon länger unbemerkt gehaust haben muss. Könnten hinter dem Anschlag die militanten Tierschützer stehen, die Kilian eine tote weiße Ratte vor die Haustür gelegt haben? Plötzlich sieht sich der Professor gemeinsam mit seiner bislang so pflichtbewussten Sekretärin Beate Brändle in einen höchst gefährlichen Fall verwickelt.
Leseprobe zu „Roter Himmel (Alexander Kilian 6)“
Leseprobe
Jenseits der Altstadt, dort wo Herdern liegen musste, flackerte der Nachthimmel in einem schmutzigen Rot, und die tief hängenden Regenwolken schoben sich wie von roten Scheinwerfern angestrahlt auf den Schlossberg zu. Weiter im Osten, wo der Schwarzwald begann, löste das grelle Licht eines Blitzes eine bewaldete Kuppe aus der Finsternis. Gleich darauf verschwand die blau flackernde Anhöhe wieder, die roten Wolken blieben.
Als Alexander Kilian an der Schwabentorbrücke in den Schlossbergring einbog, verdeckte der Berg das gespenstische Schauspiel. [...]
Leseprobe
Jenseits der Altstadt, dort wo Herdern liegen musste, flackerte der Nachthimmel in einem schmutzigen Rot, und die tief hängenden Regenwolken schoben sich wie von roten Scheinwerfern angestrahlt auf den Schlossberg zu. Weiter im Osten, wo der Schwarzwald begann, löste das grelle Licht eines Blitzes eine bewaldete Kuppe aus der Finsternis. Gleich darauf verschwand die blau flackernde Anhöhe wieder, die roten Wolken blieben.
Als Alexander Kilian an der Schwabentorbrücke in den Schlossbergring einbog, verdeckte der Berg das gespenstische Schauspiel. Er drehte das Radio lauter. Seit Tagen hatte er keine Nachrichten gehört. Während der Konferenz in Dresden hatte ein kleines und den Normalsterblichen weitgehend unbekanntes Lebewesen namens Zebrafisch sein Denken beherrscht, und er war gemeinsam mit über sechshundert Wissenschaftlern und Technikern aus aller Welt von einer Veranstaltung zur nächsten geeilt. Was außerhalb der Stadt oder, genauer gesagt, des Kulturpalastes aus der Zeit des real existierenden Sozialismus geschah, war unbemerkt an ihm vorbeigegangen. Auf dem Flug von Dresden nach Stuttgart hatte er geschlafen.
Der Nachrichtensprecher berichtete von der zunehmenden Schuldenlast für jeden einzelnen Bundesbürger: fast fünfundzwanzigtausend Euro öffentliche Schulden pro Kopf. Dabei waren Säuglinge und Greise ebenso mitgerechnet wie alle weiteren für den Schuldenabbau untauglichen Staatsbürger. Alexander schaltete das Radio aus. Seine Hoffnung auf eine gute Nachricht würde sich auch heute nicht erfüllen, zum Beispiel, dass der Freiburger Universität ab sofort der zehnfache Forschungsetat zur Verfügung stehen würde.
Als er vor seiner Haustür aus dem Wagen stieg, hatte er den roten Himmel längst vergessen. Der Gewitterregen war weitergezogen, aber die Nässe hing noch wie warmer Atem zwischen den Häusern. Alexander nahm den kleinen Lederkoffer vom Rücksitz und schlug die Autotür zu. Nicht zum ersten Mal überfiel ihn bei der Rückkehr nach einer Reise plötzlich die Furcht, während seiner Abwesenheit könne sich ein Unglück ereignet haben, von dem er nichts wusste. Er atmete tief durch die Nase ein. Was da in der Luft hing, war nicht der Rauch eines Holzfeuers oder der Geruch von angebrannten Grillwürsten, es war der beißende Qualm eines zerstörerischen Brandes. Prüfend sah er zu seiner Wohnung empor, bis er sich sicher war: Die stinkenden Schwaden stammten nicht aus diesem Haus. Wieder mal hatte sich seine Befürchtung nicht bestätigt.
In der Ferne hörte er ein Martinshorn. Es kam näher, war plötzlich direkt hinter ihm. Mit flackerndem Blaulicht und heulender Sirene jagte ein Polizeifahrzeug durch die stille Mozartstraße, vorbei an ein paar Menschen am Straßenrand, die gestikulierend herumstanden. Den Blick hatten sie in eine Ferne gerichtet, die er von seinem Haus aus nicht sehen konnte. Zögernd setzte sich die Gruppe in die Richtung in Bewegung, in der das Polizeifahrzeug verschwunden war.
Alexander stellte seinen Koffer in den Wagen zurück und ging auf die Mozartstraße zu, kehrte jedoch nach ein paar Schritten wieder um. Er, Professor Alexander Kilian, Leiter des Instituts für Molekulare Genetik, würde sich nicht unter die Gaffer mischen, die sich wie Geier um das Aas um jeden Unglücksfall scharten. Er nicht!
Beunruhigt blieb er neben seinem Auto stehen.
Und wenn er doch etwas Wichtiges versäumte?
Sekunden kämpfte er mit sich selbst, dann folgte er langsam und unschlüssig dem Grüppchen, ehe er seinen Schritt beschleunigte und die anderen überholte.
Die Nässe verschleierte grau und gespenstisch die Konturen der Häuser und Bäume, aber ein paar Steinwürfe entfernt zuckten blaue Lichter in der Finsternis. Alexander ging noch schneller, lief schließlich auf das Schauspiel zu. Das ungute Gefühl hatte sich längst wieder eingestellt, nach weiteren hundert Metern war daraus eine Gewissheit geworden. Noch ein paar Meter, dann erstarrte er.
Alexander Kilian schloss die Augen. Am liebsten hätte er sie gar nicht wieder geöffnet, als könne er die Katastrophe ungeschehen machen, indem er sie nicht zur Kenntnis nahm. Das träume ich nur, redete er sich ein, das ist nicht die Wirklichkeit. Ich muss nur aufwachen, dann ist alles wie immer.
Er riss die Augen auf.
Nichts war wie immer.
Fünfzig Meter von ihm entfernt standen rot-weiße Kegel auf der Straße. Der Fußweg war mit einem flatternden Band gesperrt – die Grenze zwischen Gaffern und Rettern. Wenn es denn noch etwas zu retten gab! Hinter dieser Grenze stand auf der rechten Straßenseite eine große Villa aus der Gründerzeit, ein hohes Haupthaus, an das sich beiderseits zwei schiefergedeckte Seitenflügel anschlossen. Man sah dem Haus nicht an, dass die letzte Renovierung erst zehn Jahre zurücklag. Die Nässe unter den alten Kastanien hatte dem Mauerwerk zugesetzt, die filigrane Steinbrüstung des Balkons in der Mitte des Haupthauses war mit den Jahren schwarz geworden, und von den geschwungenen und verzierten Konsolen und den Stuckquadern der Hauswand blätterte die Farbe. Das Gebäude beherbergte sein Institut.
Er hatte das alte Haus in der Nähe des Stadtgartens abseits des Institutsviertels der Universität vom ersten Tag an geliebt und als sein zweites Zuhause betrachtet. Nun züngelten aus dem Dach des Südflügels kleine rote Flammen. Harmlos anzusehen war das, aber er wusste, dass dies die Vorhut eines Feuersturms war, der nur noch auf das Kommando zum Ausbruch wartete. Auf der Stirnseite loderten die Flammen bereits meterhoch. Zwei Fenster im Obergeschoss waren geborsten. Prasselnd und fauchend verschlang das Feuer, was sich dahinter befunden hatte. Die Fenster gehörten zu Frau Brändles Zimmer. Brändle wie brennen. Er verfluchte den Tag, als ihm der Satz zum ersten Mal in den Sinn gekommen war. Mit diesem Gedanken über seine Sekretärin musste er das Feuer geradezu angelockt haben!
Neben den beiden Fenstern des Sekretariats zersplitterte mit lautem Knall die nächste Scheibe, und in einem Funkenregen loderten die Flammen in den nächtlichen Himmel. Es war ein Fenster seines Arbeitszimmers.
Alexander schlug die Hände vor das Gesicht. Alles, was er in seinem Leben geleistet hatte, ging dort in Flammen auf. Sein Lebenswerk brannte wie Zunder: die Zeitschriften mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten, die Urkunden über Ehrungen und Wissenschaftspreise, die er in langen Jahren zusammengetragen hatte. Was blieb davon? Nichts als Asche!
Er nahm die Hände vom Gesicht und drängte sich zwischen den Gaffern hindurch bis zur Absperrung. Vor dem brennenden Institut standen sechs oder sieben Feuerwehrautos: Fahrzeuge mit Drehleitern, Löschfahrzeuge mit Schläuchen, ein Einsatzleitwagen. Für einen winzigen Augenblick dachte er, dass seine kleine Corinna bei dem Anblick leuchtende Augen bekommen hätte. Ihm hingegen war zum Heulen zumute. Er starrte auf die Männer in Uniform, zuckende Akteure, deren neonfarbene Reflexstreifen sich im Blaulicht ruckartig bewegten wie die Glieder von Tänzern in einem modernen Ballett. Mit den Helmen sahen die Köpfe der Tänzer wie fahlgelb fluoreszierende Kugeln aus. Die Männer rannten hin und her, brüllten Kommandos, zerrten Schläuche durch die Eingangstür, verschwanden mit Atemmasken und Pressluftflaschen im Haus. Nur eines taten sie nicht: löschen! Zumindest sah er nichts davon. Interessierte es denn niemanden, dass hier sein ganzes Leben in Flammen aufging?
Wenigstens aus einem einzigen Schlauch könnte doch endlich Wasser kommen! Es dauerte eine Ewigkeit, bis schließlich eine Drehleiter vor den Fenstern ausgefahren war und ein armdicker Wasserstrahl ins Feuer schoss. Eine Ewigkeit! So kam es ihm jedenfalls vor.
Dann ein zweiter Strahl, ein dritter. Wassermassen ergossen sich durch die geborstenen Fenster und auf das brennende Dach, flossen von dort in Sturzbächen am Gebäude herunter, überschwemmten die Straße. Das ganze Haus musste gleich in den Fluten versinken. Was das Feuer übrig ließ, zerstörte das Wasser. Ohnmächtig sah Alexander der Vernichtung zu.
Als er sich endlich abwandte, fiel sein Blick auf ein Gesicht inmitten der Gaffer. Ina! Ein paar Meter von ihm entfernt stand sie in der ersten Reihe und starrte gebannt in die Flammen. Gebannt, ja, auch erschrocken, aber nicht verzweifelt. Sie sah aus wie immer, wenn sie für kurze Zeit das Haus verließ. Ihr schulterlanges braunes Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, und zur engen Jeans trug sie ein hüftlanges Top und darüber eine kurze schwarze Jacke.
Ohne Rücksicht auf fremde Füße, Schultern und Bäuche drängte er sich zu ihr durch. „Ina!“ Er klammerte sich an sie wie ein Schiffbrüchiger an den einzigen Rettungsring im tosenden Ozean. „Dass du hier bist!“
Eine Weile standen sie so, bis sich Ina aus seiner Umarmung befreite. „Die Polizei wollte dich benachrichtigen und hat bei mir angerufen, weil du nicht zu erreichen warst. Ich bin sofort gekommen.“ Inas Stimme: Wie immer. Besonnen, nüchtern. Sein Entsetzen schien sie nicht zu teilen. Und das, wo sie doch sonst so einfühlsam war!
„Hattest du kein Handy dabei?“
Er dachte an das Handy, das wie fast immer ausgeschaltet in seiner Tasche steckte, und überging die Frage seiner Lebensgefährtin. „Alles ist verloren!“, stieß er hervor.
„Alles?“ Ina sah mit hochgezogenen Augenbrauen zu ihm auf.
Er nickte in stummer Verzweiflung.
„Dein Laptop? Alle neuen Arbeiten?“ Jetzt klang Inas Stimme doch besorgt.
Alexander schüttelte den Kopf. „Der ist im Koffer“, antwortete er knapp. „Ich hatte ihn in Dresden dabei.“
„Na, siehst du. Nicht alles.“
In der Tat war wahrscheinlich nichts von dem, was er elektronisch gespeichert hatte, durch den Brand verloren gegangen. Seit er einmal seinen Laptop verloren hatte und ihm schon unzählige SD-Karten und USB-Sticks auf unerklärliche Weise aus den Hosentaschen entkommen waren, speicherte er alles doppelt und dreifach. Schwierig war nur das Wiederfinden.
„Aber alles andere ist verloren! Die ganzen Veröffentlichungen, meine Bücher, überhaupt alles.“ Sein Ton erinnerte ihn an den von seiner kleinen Corinna, wenn sie sich nicht den Anlass für ihre Tränen nehmen lassen wollte. Er versuchte es noch einmal auf die vernünftige Art: „Es ist ein Unterschied, ob ich von meinen Arbeiten eine Kopie auf dem Computer habe oder den gedruckten Artikel in der Hand halte.“
„Verstehe“, sagte Ina. „Aber die gedruckten Artikel wird man ersetzen können, wenn du sie unbedingt brauchst. Auch die Bücher. Wozu hast du Frau Brändle?“
„Die wird vermutlich anderes zu tun haben“, widersprach er matt.
Ina sah ihn lange an, und die steile Falte auf ihrer Stirn verriet ihm, wie angestrengt sie überlegte. „Du musst …“ Sie stockte und sah zu den lodernden Flammen hinüber.
Er ahnte, was jetzt kommen würde: ein Rat, den er nie und nimmer berücksichtigen konnte, weil er unweigerlich eine seiner vielen Schwächen berühren würde.
„Du musst das Positive sehen. Du kannst endlich deine guten Vorsätze umsetzen und Ordnung schaffen. Du brauchst nicht einmal etwas wegzuwerfen. Du kannst ganz neu anfangen.“
Er schwieg. Immer wieder hatte er neu angefangen: ein neuer Arbeitsplatz, eine neue Wohnung, eine neue Frau, ein neuer Computer. Nur er selbst war nicht neu. Das war der Haken an jedem Neuanfang. Er selbst machte jeden guten Vorsatz in kürzester Zeit zunichte. Wie oft hatte er sich vorgenommen, unvermeidbare Aufgaben sofort zu erledigen und die unnötigen gleich abzuweisen. Unerledigte Arbeiten, verbunden mit Stapeln von Erinnerungszetteln, die ihn jeder Freiheit beraubten und seine Kreativität schon im Keim erstickten, sollten längst Vergangenheit sein. Doch ihr Überlebenswille war mächtiger als jeder Neuanfang. Ina musste wissen, wie sinnlos ihr Rat war, schließlich war sie eine kluge Frau.
„Nimm den Brand als die Chance deines Lebens“, sagte sie mit dem Kopf-hoch-Ton, der kaum geeignet war, sein Unglück zu mindern.
„Ich verstehe nicht, wie du dieser Katastrophe noch etwas Positives abgewinnen kannst“, stieß er so heftig hervor, als wäre sie schuld an dem Feuer. „Es wird Monate dauern, bis wir hier wieder arbeiten können.“
„Da hast du wahrscheinlich recht“, räumte Ina ein.
Alexander starrte in den dichten Qualm, der jetzt statt der lodernden Flammen aus dem Sekretariat drang. Was sich dort befunden hatte, war nur noch Schutt und Asche. Bei diesem Gedanken besserte sich seine Stimmung ein ganz klein wenig. Die Postmappe zum Beispiel, mit den seit Langem unerledigten Anfragen und Anträgen, die ihm seine Sekretärin jeden Morgen aufs Neue mit unerschütterlichem Optimismus auf den Schreibtisch legte. Zumindest hier würde es einen Neuanfang geben.
In diesen winzigen Trost hinein entdeckte er jetzt die Verluste, die wirklich schmerzten: die Kleinigkeiten, deren Wert sich nicht in Geld messen ließ und die keine Versicherung ersetzte. Das letzte Foto von seinen Eltern, kurz bevor sie vor fast fünfzig Jahren bei einem Verkehrsunfall umgekommen waren – es hatte in einem Regal zwischen anderen Bildern gestanden. Oder der kleine Kaktus, den seine Sekretärin einst aus einem Samenkorn gezogen hatte und der in diesem Jahr zum ersten Mal Blütenknospen hervorgebracht hatte.
Überhaupt Frau Brändle: Ihr Reich war zerstört, nicht nur die Blumen auf der Fensterbank, auch das schwarze Adressbüchlein auf ihrem Schreibtisch, aus denen sie Adressen und Telefonnummern in einer Geschwindigkeit hervorzauberte, die jeden Computer übertraf. Auch ihr PC war vermutlich vernichtet, ebenso wie die Espressomaschine, die sie erst vor drei Wochen mit der Bahn aus Italien herbeigeschleppt hatte. Eine Gaggia aus poliertem Edelstahl, angeblich ein Traum eines jeden Espressoliebhabers. Hatte die Gute nicht alles, was ihr wichtig war und was die Seele des Instituts ausgemacht hatte, in ebendiesem Zimmer aufbewahrt? Wenigstens die Kaffeemaschine würde ersetzt werden können.
Die erste wirkliche Katastrophe erkannte er Augenblicke später, und die übertraf alles andere bei Weitem. In den Räumen unter dem brennenden Stockwerk lagerten in Brut- und Gefrierschränken die Produkte der jahrelangen Anstrengungen junger Forscher, dort hatte sich materialisiert, was in ihren Köpfen herangewachsen war und worum sich ihre Zukunftsträume rankten. Ob als genau temperierte Bakterienkulturen, als tiefgekühlte Proben oder in kleinen Glasbecherchen wimmelnde Fruchtfliegen, als Zebrafische in den Aquarien oder als winzige Würmer in flachen Glasschalen – hier wuchsen die Karrieren der nächsten Generation als vergängliche Substanz heran. Seine eigene war längst in Papier und elektronischen Dateien festgeschrieben.
„Vielleicht wirst du immer noch gesucht“, sagte Ina. „Du solltest dich bei der Feuerwehr oder bei der Polizei melden.“
Diesen Gedanken hatte Alexander gerade selbst gehabt, schließlich musste er in Erfahrung bringen, wie es um die Stromversorgung in den unteren Räumen stand, er musste wissen, welche Schäden das Löschwasser dort anrichtete, er musste alle Mitarbeiter informieren, die in diesen Räumen ihre Schätze aufbewahrten. Und deren Telefonnummern? Er blickte zu den rauchenden Fenstern des Sekretariats. Auch die Nummern waren nur noch Staub und Asche.
„Man müsste die Mitarbeiter verständigen“, sagte Ina in diesem Augenblick.
„Die Telefonnummern sind auch verbrannt.“
„Wozu gibt es eine Telefonauskunft?“
Er dachte daran, welcher Schritt jetzt der nächste sein müsste, der einzig sinnvolle. Der Schritt, der längst hätte getan sein müssen und der wie ein Berg vor ihm stand.
„Du solltest Frau Brändle anrufen“, fuhr Ina in ihrem telepathischen Höhenflug fort.
„Ich weiß ihre Privatnummer nicht“, sagte er, obwohl er nur ein wenig in seinem Gedächtnis hätte suchen müssen.
„Weißt du sie wirklich nicht?“
„Doch.“ Er zog sein Handy aus der Tasche. „Außerdem ist die Nummer hier gespeichert, auch ihre Handynummer.“ Er hielt Ina das Telefon hin. „Kannst du nicht …? Ich sollte jetzt unbedingt der Feuerwehr sagen, dass ich hier bin.“
Ina zögerte, dann nahm sie das Handy ohne Widerspruch entgegen, mitleidig irgendwie, und er wusste nicht, ob das Mitleid ihm oder Frau Brändle galt.
„Danke“, sagte er. „Ich gehe dann mal.“
Bereits die Vorstellung, jetzt auch noch seine in Tränen aufgelöste Sekretärin trösten zu müssen, überforderte ihn. Er versuchte seine Feigheit hinter Gedanken wie „So ein Unglück wird besser von Frau zu Frau mitgeteilt“ zu verstecken, stieg über die Absperrung und ging zum Einsatzleitwagen. Der Mann neben dem Fahrzeug – etwa vierzig Jahre, gelbliche Haut, auffällig klein und wie verloren unter einem großen Helm und einer weiten Uniform – war mit seinem Sprechfunkgerät beschäftigt.
„Entschuldigung“, sagte Alexander, obwohl es eigentlich nichts gab, wofür er sich entschuldigen musste. „Sie haben mich vorhin gesucht.“
Der Blick des Einsatzleiters streifte ihn, blieb am quakenden Sprechfunkgerät hängen, kehrte wieder zu ihm zurück.
„Kilian“, stellte er sich vor. „Ich bin der Leiter des Instituts.“
Der Einsatzleiter sagte etwas, aber Alexander verstand kein Wort. In seiner Vorstellung war der Brand eines Hauses etwas gewesen, was sich lautlos vollzog. Doch das war völlig falsch. Es war nicht nur der Lärm, der unmittelbar vom Feuer ausging, lauter noch waren die Fahrzeugmotoren und Pumpen, aber am schlimmsten waren die Sprechfunkgeräte.
„Was ist mit dem Strom?“
„Der Strom ist selbstverständlich abgeschaltet“, erklärte der Mann in der übergroßen Uniform. Alexanders Protest über das stromlose Institut ging im Quaken des Sprechfunkgeräts unter. „Sind Menschen im Haus?“
Wie hätte er das mit Sicherheit wissen sollen? „In den brennenden Räumen sicher nicht“, schrie er. Das Sprechfunkgerät machte ihn verrückt. „In den unteren Stockwerken stehen Gefrierschränke und andere Geräte, die unbedingt Strom brauchen!“
Der kleine Mann, der hier das Sagen hatte, sah ihn an, als hätte er es mit einem Schwachsinnigen zu tun. Ganz offenbar hatte er andere Sorgen.
Alexander versuchte es noch einmal in derselben Lautstärke: „Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Stromversorgung wiederherzustellen?“
Jetzt reagierte der Mann. „Heute und in diesem Teil des Hauses sicher nicht.“
„Aber es muss sein! Verstehen Sie denn nicht? Es stehen die Ergebnisse jahrelanger Forschung auf dem Spiel.“
Der Helm des Einsatzleiters begann sich im raschen Wechsel mal nach rechts zu drehen und mal nach links. Offenbar schüttelte der Mann unter dem Helm seinen Kopf. „Sie sehen doch selbst, was hier los ist!“
Alexander gab auf. Diese Art zu reden kannte er. Es war der schneidende Ton eines kleinwüchsigen Mannes in leitender Position, der sich nicht mit seiner rein körperlichen Unterlegenheit abfinden wollte. Kompromisse waren nicht zu erwarten. Er ließ den Einsatzleiter stehen.
Jetzt stürzte wirklich alles um ihn herum zusammen. Nicht ihn ereilte das Unglück mit voller Wucht, sondern der Nachwuchs war am schlimmsten betroffen. Er dachte an die hoffnungsvollen Doktorandinnen, die mit blassen Gesichtern ihre freie Zeit mit Pipetten, Elektrophoreseplatten und Zentrifugen verbrachten, während ihre Freundinnen im Schwimmbad waren, an die Postdocs, die sich anschickten, mit revolutionären Ideen die Wissenschaft in nie gekannte Höhen zu führen, und an die Arbeitsgruppenleiter, ohne deren Einsatz weder die Finanzierung noch die Koordination der vielen Projekte möglich waren. Und mit diesen Gedanken landete er wieder bei sich selbst, denn woran wurde er gemessen, wenn nicht an den Arbeiten seiner fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Keine Sekunde würde er sich von der Brandstelle entfernen, solange auch nur die geringste Chance bestand, den Wettlauf mit der Zeit doch noch zu gewinnen. Es ging ja nicht nur um die Stromversorgung. Auch die Zebrafische, Fruchtfliegen und Fadenwürmer konnten nicht ewig unversorgt überleben. Nur die Knock-out-Mäuse, auf denen er seinen Ruhm gegründet hatte, waren nicht in Gefahr. Die fristeten ihr freudloses Leben in den unterirdischen Tierställen beim pharmakologischen Institut.
Vergeblich suchte sein Blick nach Ina, bis er im nächsten Augenblick mit ihr zusammenstieß.
„Hast du mich nicht gesehen?“
Er hatte nicht. Kein Wunder bei ihrer Größe. Dabei war sie nicht wirklich klein mit ihren hundertzweiundsiebzig Zentimetern, aber er entdeckte sie nie, wenn er sie in einer Menschenmenge suchte.
„Was hat Frau Brändle gesagt?“, fragte er.
Ina schüttelte bedauernd den Kopf. „Gar nichts. Ich habe auf ihrem Handy die Nachricht hinterlassen, dass sie dich so bald wie möglich anrufen soll.“ Sie gab ihm das Handy zurück und sah auf die Uhr. „Ich sollte längst wieder zu Hause sein.“
„Ist Corinna allein zu Hause?“, fragte er so erschrocken, als sei seine Tochter noch ein kleines Kind und keine achtjährige Schülerin.
„Corinna wartet bei Jana auf mich.“
„Corinna wartet“, wiederholte er und konnte sich nicht vorstellen, dass seine Tochter bei dieser besonderen Freundin mit der frühreifen Schwester auch nur eine einzige Sekunde an ihre Mutter denken würde.
Ina umarmte ihn stumm und sah ihn dann mit einem festen Blick an, der wohl Zuversicht signalisieren sollte. Einen Augenblick glaubte er, sie würde ihm ein „Alles wird gut“ zurufen, aber sie drehte sich um und ging. Dabei hatte er mit ihr nicht einmal über die Katastrophe gesprochen, die sich im stromlosen Gebäude anbahnte. Es gab Augenblicke, da bedauerte er, von Ina getrennt in einer eigenen Wohnung zu leben. Dieser gehörte dazu.
Stundenlang harrte Alexander bei den qualmenden Trümmern aus, während die Menschenmenge langsam von den Rändern her zerbröckelte und sich schließlich auflöste. Zuletzt stand er allein neben der Absperrung. Für die Gaffer lohnte sich der Anblick nicht mehr. Die meisten Schläuche waren eingerollt, der erste Löschzug abgerückt. Ein paar Männer befanden sich noch im Gebäude. Was sie dort trieben, wusste er nicht. Die Ruhe war gespenstisch: Es war die Ruhe eines Friedhofs. Keine Autos fuhren, niemand sprach, selbst das Sprechfunkgerät quakte nicht mehr.
Alexander näherte sich dem kleinwüchsigen Einsatzleiter. Dies war die letzte Chance. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dachte er und fürchtete doch, dass jegliches Leben im Südflügel bereits der Hoffnung in den Tod vorangegangen war.
„Wir brauchen schnellstens wieder Strom im Gebäude. Unsere gentechnisch veränderten Organismen kann man nicht einfach ersetzen!“
Der Mann mit der Macht über Leben und Tod von abertausend Lebewesen in den unteren Räumen verzog seinen Mund. Einen Augenblick sah er aus, als hätte er in eine Zitrone gebissen, gleich darauf ähnelte das ganze gelbe Gesicht einer sauren Frucht. „Ich dachte, der Breisgau wäre eine gentechnikfreie Zone!“
Mit Gentechnik hatte Alexander offenbar das falsche Stichwort gegeben. „Wir haben nichts mit Genmais oder irgendwelchen Monsterkühen zu tun“, beeilte er sich, die Sachlage richtig darzustellen. „Wir forschen, damit Krankheiten wie Alzheimer vielleicht eines Tages geheilt werden können.“ Das ›vielleicht‹ hätte er wohl besser weggelassen. Das Zitronengesicht blieb. „Es geht hier nicht um materielle Werte, es geht um die Wissenschaft.“
„Wir tun, was wir können.“
Alexander bezweifelte das. Die Miene des Einsatzleiters war nicht geeignet, ihm die geringste Hoffnung zu machen. Daher machte er einen neuen Vorschlag: „Wir könnten die empfindlichen Bestände herausholen und anderswo im Gebäude unterbringen.“
„Ich sagte, wir tun, was möglich ist.“
Alexander wich auch jetzt nicht von der Seite des einzigen möglichen Retters. Vielleicht war der froh, wenn von den genmanipulierten Monstern nichts übrig blieb – selbst wenn es nur harmlose Fadenwürmer waren?
Waren die genmanipulierten Organismen womöglich der Grund für das Feuer? Es gab viele Menschen, die in Wissenschaftlern wie ihm die Handlanger der Apokalypse sahen, denen man das Handwerk legen musste.
Der Einsatzleiter hatte sich in sein Fahrzeug zurückgezogen. Offenbar telefonierte er. Und zwar lange. Alexander lief ungeduldig in immer engeren Kreisen um den Wagen herum. So lange konnte doch kein Mensch in dieser Situation telefonieren! Endlich stieg der Mann aus.
„In zehn Minuten kommt ein Techniker von der Badenova und wird im Haupthaus und dem unbeschädigten Seitenflügel die Stromversorgung wiederherstellen.“ Sein Tonfall dabei: Als hätte er das schon immer gesagt. „Sobald meine Männer im Gebäude grünes Licht geben, können Sie Ihre persönlichen Gegenstände und das, was gefährdet ist, aus den unteren Räumen holen. Das zweite Stockwerk können Sie nicht betreten, ehe es der Baustatiker freigegeben hat.“
Für einen Augenblick war Alexander sprachlos. Wie sollte er allein all das retten, was gerettet werden musste?
„Nur ich oder auch die Mitarbeiter?“
„Jeder, der hier arbeitet. Anschließend werden Sie diesen ganzen Trakt für mehrere Tage nicht betreten können.“
Warum hatte er das nicht gleich gesagt! Jetzt stand er hier als Einziger mitten in der Nacht, und vor ihm lag eine Aufgabe, die für ihn allein unlösbar war.
Auf seinem Handy hatte er die Nummern von ein paar Mitarbeitern gespeichert. Zwei davon hatten in dem zerstörten Flügel gearbeitet. Er erreichte beide und bat sie, ein paar Kollegen zu benachrichtigen und dann sofort zu kommen.
Er hatte nicht gedacht, dass Telefonketten im elektronischen Zeitalter noch funktionierten. Oder wurden solche Nachrichten heute getwittert? Eine Viertelstunde nach seinem ersten Anruf wimmelte es in dem Gebäude wie in einem Ameisenhaufen. Allerdings hatte er noch nie so ratlose Ameisen gesehen. Wohin mit dem ganzen Zeug? Alles, was in diesem Haus zur Aufbewahrung geeignet schien, war sowieso überfüllt. Er tat, als würde er nicht bemerken, dass die Ersten begannen, ihre Schätze in Kühltaschen aus dem Haus und vermutlich in die eigenen Gefriertruhen oder Kühlschränke zu schleppen. Gentechnisch veränderte Organismen ohne Genehmigung aus dem Institut zu schaffen war nicht erlaubt.
Vom Münsterturm schlug es Mitternacht, als er – durch den Anblick des zerstörten Südflügels um mindestens zehn Jahre gealtert – zu seiner Wohnung zurückkehrte. Geisterstunde, dachte er, als er die Glocke hörte, und gab sich schwarzen Gedanken hin.
Doch das, was vor seiner Haustür lag, war weiß. Leuchtend weiß, wie ein kleines Fleckchen Schnee. Ein Taschentuch? Schon ehe er sich bückte, wusste er, dass es keine harmlose Erklärung für dieses kleine bisschen Weiß vor seiner Wohnung geben würde. Er berührte den weißen Fleck und fuhr zurück. Sein Herz schlug schneller. Nein, das war kein Papier, es war viel weicher und glatter. Etwas Haariges? Ein totes Tier? Er schaltete das Licht an.
Auf dem Abtreter lag eine tote Ratte. Keine graue, wie sie hunderttausendfach in Freiburg hausten. Nein, es war eine weiße Ratte. Eine graue Ratte hätte ihn weniger erschreckt. Die nächste Falle mit Giftködern stand im Stadtgarten nicht weit von seiner Wohnung entfernt. Er erwartete schon lange, eines Tages auf eine vergiftete Ratte zu stoßen. Irgendwo mussten die armen Tiere schließlich ihr Leben beenden. Aber diese Ratte war weiß.
Eine Weile betrachtete er unentschlossen das ungewöhnliche Exemplar, dann entschied er, ihm nicht mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als er es bei einem grauen getan hätte. Der Brand allein war schlimm genug. Er hob das Tier an der Schwanzspitze hoch und versenkte es in der Mülltonne.
Ein Unglück kommt selten allein, dachte er, als er die Tür aufschloss, und im selben Augenblick überkam ihn die Gewissheit, dass sich das nächste bereits ereignet hatte. Die Wohnung roch, wie sie nicht riechen sollte. Unangenehm wäre für das, was ihm entgegenschlug, stark untertrieben. Die Wohnung stank widerlich. Leichengeruch? Den hatte er glücklicherweise nur ein einziges Mal in seinem Leben so intensiv wahrgenommen, und das lag lange zurück. Dreißig Jahre? Damals war er Medizinstudent gewesen und hatte eine Leichenöffnung in der Rechtsmedizin ertragen müssen. Der Tote damals war erst viele Tage nach seinem Ableben in einem von der Sonne beschienenen Bauwagen gefunden worden. Genauso wie der Tote damals roch es jetzt in seiner Wohnung.
Und nun? Die Polizei anrufen? Alles in ihm wehrte sich dagegen, der nächsten Katastrophe ins Auge zu sehen, noch dazu allein. Doch er hatte keine andere Wahl.
Schritt für Schritt bewegte er sich in den Flur. Die Haustür hatte er offen gelassen. Als Fluchtweg. Er stieß die Wohnzimmertür so weit auf, dass sie an der Wand anschlug. Dahinter war nichts. Hier war alles in Ordnung, abgesehen von den Rosen in der Vase, die wie eine Ansammlung von Trauernden die Köpfe hängen ließen. Er betrat sein Arbeitszimmer. Der Rollladen war geschlossen, das war ungewöhnlich. Hatte seine Putzfrau im Dunkeln geputzt? Nein, sie war diese Woche krank – jetzt erinnerte er sich.
Er kehrte in den Flur zurück und fuhr erschreckt zusammen, als die Schlafzimmertür mit lautem Knall ins Schloss fiel. Mit einem schnellen Schritt erreichte er eine Nische neben der Garderobe, die im Dunkeln lag. Er atmete kaum. Nichts geschah. In der Wohnung war es totenstill, nur durch die offene Wohnungstür hörte er die Blätter der alten Akazie rauschen.
Nach einer Zeit, die ihm endlos erschien, wagte er die Nische zu verlassen. Er öffnete die Schlafzimmertür und knipste das Licht an. Niemand war hier, und auch sonst entdeckte er nichts, was ihn beunruhigte. Er bückte sich trotzdem und sah unter das Bett. Nichts. Zumindest kein Einbrecher, auch keine Leiche, nur dicke Mäuse – Wollmäuse –, zwei alte Taschentücher und ein Zettel, der ihn an etwas erinnern sollte, was längst Vergangenheit war, und der aus einer Zeit stammte, als sich seine Putzfrau noch bester Gesundheit erfreute.
Er fand die Leiche in der Küche, zumindest die Teile, die Ina, Corinna und er davon übrig gelassen hatten. Sie lag im Mülleimer. Es war ein roher Hasenrücken, von dem Ina vor dem Braten mit gekonnten Bewegungen die Filets gelöst hatte. Den Rest, an dem jetzt dicke weiße Maden fraßen, hatte er selbst im Mülleimer entsorgt. Angeekelt trug er den stinkenden Beutel zur Mülltonne. Morgen kam die Müllabfuhr, aber bis dahin würde die ganze Umgebung nach Verwesung riechen.
Er riss alle Fenster auf und öffnete die Terrassentür. Draußen schaukelte seine altmodische Laterne in der windigen Nacht und warf ein unruhiges Licht in die Finsternis.
Ein Geräusch ließ ihn herumfahren. Im Garten bewegte sich etwas. Was es war, konnte er nicht erkennen, aber er hörte deutlich das Rascheln im Efeu unter den Hainbuchen. Ein Igel? Eine Katze? Vielleicht hatte eine Katze die tote Ratte vor seiner Haustür abgelegt, vielleicht die fette mit dem grauweißen Fell und dem zu kleinen Kopf? Katzen gab es hier genug. Nur passte das Geräusch nicht zu einer Katze, jedenfalls nicht zu einer auf vier Beinen.
Er hätte jetzt nachsehen können, aber er zögerte. Für heute keine erschreckenden Entdeckungen mehr! Das Maß der zumutbaren Aufregung war nicht nur voll, es war längst übergelaufen. Nein, er hielt die tote Ratte nicht ernsthaft für das Präsent einer Katze.
Halbherzig tat er ein paar Schritte in den Garten, der in völliger Finsternis vor ihm lag, dann kehrte er um und ging zu seinem Auto, um den Koffer zu holen. Sorgfältiger als gewöhnlich verschloss er danach alle Fenster und Türen seiner Wohnung. Den Gestank von Verwesung, der immer noch in den Räumen hing, würde er ertragen müssen.
In dieser Nacht träumte Alexander von Zebrafischen. Riesengroß waren sie und hatten silbrig-weiße und blaue Längsstreifen, die wie Neonröhren leuchteten. Die Tiere schwammen in einem Aquarium, das fast den ganzen Raum ausfüllte. Der Raum, das erkannte er erst jetzt, war ein großes Zirkuszelt mit zwei Masten, und statt einer Manege stand in der Mitte das Wasserbecken wie ein großes Haus. Im Aquarium schwebte ein Mann, der wie ein Dompteur gekleidet war, nicht wie ein Taucher. Es war Thomas Tuschl, ein jüngerer Kollege, der seit ein paar Jahren einen Wissenschaftspreis nach dem anderen abräumte. Alexander wunderte sich – weniger über Tuschls Auftritt im Zirkus als über die Zebrafischnummer. Mit Fischen hatte Tuschl doch gar nichts zu schaffen. Alexander hörte das vor Begeisterung tosende Publikum und spürte eine bohrende Eifersucht auf den erfolgreichen Wissenschaftler.
Auf einmal sah er sich selbst. Er stand neben dem Tunnel für die Raubtiere. Mit beiden Händen hielt er einen Käfig, in dem Dutzende kleiner Mäuse wie verrückt hin und her hüpften. Es mussten seine Knock-out-Mäuse sein. Mit solchen Tieren hatte er vor vielen Jahren durch das Ausschalten einzelner Gene deren Funktion erforscht und damit seinen Ruhm begründet. Er wusste nicht, warum sich seine Mäuse kurz vor ihrem großen Auftritt so wild gebärdeten. Gab es deswegen die ausbruchsicheren Raubtiergitter? Nie zuvor hatten seine Tierchen solche Käfige gebraucht.
Die Zeit verging, und in Alexander stieg das brennende Gefühl auf, dass man seinen Auftritt vergessen hatte. Tuschl hatte ihm die Schau gestohlen! Mit diesem Gefühl in der Brust drängte er sich durch die Gaffer hindurch, die hinter einer rot-weißen Absperrung herumstanden. Er suchte den Zirkusdirektor. Plötzlich entdeckte er Ina in der Menge. Sie sah ihn an, und die steile Falte auf ihrer Stirn sah aus wie ein dunkler schmaler Tannenbaum. Den Direktor, mit quakendem Sprechfunkgerät und im gleichen Dompteurkostüm wie Thomas Tuschl, fand er draußen neben einem winzigen Auto, mit dem er eben davonfahren wollte. „Die Mäuse?“, sagte der Direktor und schüttelte den Kopf. „Ihr Auftritt ist längst vorbei.“ Alexander wollte widersprechen. „Sie sehen doch selbst, was hier los ist“, schnitt ihm der Zirkusdirektor das Wort ab. Plötzlich wurde Alexander sehr traurig. Er presste den Käfig an seine Brust und schlich davon mit seinen Mäusen, die nun ganz still saßen und ihn ansahen, als würden sie seine Enttäuschung teilen.
Mit diesem Gefühl abgrundtiefer Traurigkeit über den verpassten Auftritt wachte Alexander auf. Gnadenlos hatte ihm der Traum vor Augen geführt, was er schon seit Jahren befürchtete: Seine Erfolge waren Auslaufware. Darüber täuschte auch die Tatsache nicht hinweg, dass die Väter der Knock-out-Mäuse 2007 den Nobelpreis bekommen hatten. In den Achtzigerjahren war ihre Methode eine Sensation gewesen. Er selbst hatte ebenfalls in dieser Zeit die Idee gehabt, kleine Teile des Erbguts einer Maus auszuschalten, um aus den Veränderungen am erwachsenen Tier auf die Funktion dieses Gens zu schließen. Anderen war dies schneller gelungen als ihm, sonst – er konnte den Satz noch immer nicht zu Ende denken, ohne die Enttäuschung wie eine riesige Faust im Magen zu spüren – sonst hätte er vermutlich den Nobelpreis bekommen.
Mittlerweile gab es andere Möglichkeiten, die Funktion von Genen aufzuklären, als Mäuse zu züchten und umzubringen. Tuschl kam sogar ganz ohne Versuchstiere aus. Andere Forscher hatten sich statt der Mäuse längst Haustiere zugelegt, deren Schicksal weniger Mitleid erregte. Zebrafische zum Beispiel oder Fadenwürmer. An dieser Tatsache änderte auch sein Interview mit der Badischen Zeitung nichts, in dem er die große Bedeutung der Knock-out-Mäuse auch in der heutigen Zeit betont hatte. Die Mäuse waren im Vergleich mit anderen Organismen Auslaufware. Er wiederholte in Gedanken das Wort: Auslaufware – genau wie sein eigener Name es eines Tages sein würde.
Er konnte sich nicht entschließen aufzustehen, sondern blieb mit offenen Augen liegen und sah zu, wie der Morgen mit seinen Grautönen ins Zimmer drang, einer deprimierender als der andere. Das Beste wäre, als Forscher noch einmal von vorn anzufangen, Ideen hatte er genug. Er beneidete die Kollegen, die für den Fortschritt der Menschheit und nicht nur für den Fortbestand der Bürokratie arbeiteten. Wenn er wenigstens wieder eine eigene Arbeitsgruppe leiten könnte, wenn er schon selbst keine Pipette mehr in die Hand nahm! Stattdessen würde er seine letzten zehn Jahre an der Uni in nervtötenden Sitzungen und mit dem Korrigieren von Aufsätzen verbringen, die in irgendeiner wissenschaftlichen Zeitschrift erscheinen sollten. Viel zu wenig Zeit blieb für die Besprechungen, in denen es um das ging, was ihn am meisten interessierte: um die Forschung seiner eigenen Mitarbeiter. Zehn Jahre würde es noch so weitergehen – und dann? Ein Kämmerchen mit einem Schreibtisch, das war in der Regel das Äußerste, was eine deutsche Universität ihren Professoren als Altenteil zugestand, und dieser Augenblick rückte unbarmherzig näher. Für einen Neuanfang war es höchste Zeit. Gestern erst hatte er mit Ina darüber gesprochen.
Plötzlich war die Erinnerung wieder da. Das Feuer! Oder hatte er auch das nur geträumt, genau wie den verpassten Auftritt im Zirkus? Die Ratte vor der Haustür. Nein, beides hatte er nicht geträumt. Die Erinnerung an die ausgebrannten Fensterhöhlen im Südflügel traf ihn so heftig, dass ihm ein Kribbeln bis in die Fingerspitzen fuhr. Er sprang aus dem Bett.
Frau Brändle hatte nicht angerufen. Er suchte sein Handy, um die Anruferliste durchzusehen, aber das Display blieb dunkel. Wieder einmal hatte der Akku im entscheidenden Augenblick den Geist aufgegeben. Als hätte er ein Gespür dafür! Auf dem Anrufbeantworter seines Festnetztelefons waren elf Anrufe eingegangen, seit er nach Dresden geflogen war – eindeutig zu viele, um sich jetzt darum zu kümmern.
Ein Montag, dachte er und wusste im selben Moment, es würde nicht einfach nur der Montag nach dem Brand bleiben oder der Montag mit den elf unerledigten Anrufen. Ein schrecklicher Montag würde es werden, einer, an den er sich noch Jahre später erinnern würde. Er wählte die Privatnummer seiner Sekretärin. Es meldete sich nur der Anrufbeantworter: „In dringenden Fällen probieren Sie es bitte unter 0172 …“ Doch unter der Handynummer landete er auf der Mailbox.
Der Brand. Die Ratte. Aber da war noch etwas anderes gewesen, was ihn beunruhigt hatte. Richtig, das Geräusch im Garten. Das war keine Katze gewesen, auch kein Igel.
Es gibt Dinge, die erst Wirklichkeit werden, wenn man sie mit eigenen Augen gesehen hat. Bis dahin bleiben sie eine vage Ahnung. Seit Jahren hatte er trainiert, solche Vermutungen so lange wie möglich nicht in Gewissheit zu verwandeln. Aber jetzt war es so weit. Er wollte wissen, was gestern Abend passiert war.
Als er hinten im Garten stand, von wo er das Geräusch gehört hatte, konnte er der Wahrheit nicht mehr ausweichen. Sie sprang ihm förmlich ins Auge. An dieser Stelle war der rostige Maschendraht nach außen gebogen. Irgendetwas hatte hier den Garten verlassen. Etwas Großes. Ein großes Tier? Wenn der Zaun von einem Tier zerstört worden war, musste es mindestens ein Wildschwein gewesen sein. Oder eine Kuh, aber beide gingen nicht in der Stadt spazieren. Also ein Mensch. Der Mensch, der die Ratte vor der Tür abgelegt hatte?
Alexander wandte sich ab. Er wollte nicht länger betrachten, was ohnehin offensichtlich war. Der Brand, die tote Ratte vor seiner Haustür, ein Mensch, der über den Gartenzaun gestiegen war: Der Zusammenhang drängte sich förmlich auf. Andererseits hatte er sich schon oft darüber gewundert, wie seine Mitmenschen Zusammenhänge erkannten, wo keine waren. Zwischen dem zunehmenden Mond und der angeblich gleichzeitig steigenden Zahl der Geburten zum Beispiel. War es jetzt bei ihm selbst schon so weit gekommen?
Der Zaun war wahrscheinlich schon seit Jahren beschädigt, und das Institut war bei einem Gewitter in Brand geraten, also durch Blitzschlag. Er hatte den Blitz doch mit eigenen Augen gesehen!
Das Feuer hat nichts mit mir zu tun. Es hat nichts mit mir zu tun. Wie ein Mantra wiederholte er diesen Satz.
Fünfzehn Minuten vor acht schloss Alexander sorgfältig die Haustür hinter sich zu und schlug den Weg zum Institut ein. Um sieben Minuten vor acht würde Frau Brändle dort eintreffen, vielleicht auch zwei oder drei Minuten später, wenn ihre Straßenbahn aus Littenweiler nicht pünktlich am Bertoldsbrunnen eintraf, aber niemals früher. Er blieb in Sichtweite des Instituts in einer Querstraße stehen, um auf sie zu warten.
Frau Brändle, es ist etwas Schlimmes passiert – oder sollte er sagen: etwas Schreckliches? Er entschied sich für etwas Schlimmes, das klang weniger dramatisch, weniger endgültig. Er sah seine Sekretärin schon vor sich, wie sie in stummer Verzweiflung die Hände rang, sogar die Arme, den ganzen Körper, bis sie aussah wie die Maria am Hochaltar des Münsters unter dem Kreuz mit ihrem sterbenden Sohn. Er kannte Frau Brändles Aufregung von anderen Anlässen, zum Beispiel, als ihr neuer indischer Freund und, wie sie hoffte, ihr künftiger Ehemann tagelang für sie verschollen gewesen war.
Minuten vergingen, und er bekam Bauchschmerzen wie in den ersten Schuljahren beim Verkünden der Zensuren.
Drei Minuten nach acht Uhr. Frau Brändle war nicht gekommen.
Seine Sekretärin erwartete ihn vor dem Gebäude, stumm, gefasst, großäugig. Seit ein paar Wochen waren ihm ihre weit geöffneten Augen aufgefallen, jünger und lebhafter als in den Monaten und Jahren davor. Er hatte die Veränderung auf ihre Verliebtheit geschoben, die dieses Mal nicht ihm galt. Doch jetzt erkannte er in den aufgerissenen Augen das reine Entsetzen.
„Sie sind schon hier?“, fragte er.
Frau Brändle schwieg.
„Sie wussten von dem Feuer?“
Sie nickte. „Frau Kaltenbach …“ Sie stieß einen Seufzer aus, der wie ein Schluchzen klang, und verstummte, ohne den Satz zu beenden. Natürlich, sie wusste von Ina, was geschehen war. Vermutlich hatte sie bei ihr angerufen, als er nicht erreichbar war.
Langsam stieg er die steinernen Stufen empor. Seine Sekretärin folgte in einigem Abstand, so als hielte sie das Betreten des Hauses schon von vornherein für falsch. Das Treppenhaus stank nach Verbranntem, woran auch die weit geöffneten Fenster nichts änderten. Wenig später hatten sie den Flur im zweiten Obergeschoss erreicht und standen an der Tür, die das Haupthaus vom Südflügel trennte. Sie war von der Kriminalpolizei versiegelt worden. Frau Brändles Gesicht zeigte einen Ausdruck, der ihm von Ina vertraut war: Das habe ich gleich gewusst. Dann drehte sie sich um, ging ein paar Schritte und blieb am Fenster im Treppenhaus stehen.
Bei Alexander dauerte es etwas länger, bis er zähneknirschend zur Kenntnis nahm, dass weder er noch sonst irgendjemand in den Südflügel durfte – nicht einmal die Kriminalpolizei, von der das Siegel stammte. Es fehlte noch das grüne Licht des Baustatikers, von dem der Einsatzleiter gesprochen hatte.
Im ersten Stock des Haupthauses, direkt hinter der Tür zum Treppenhaus, stand zwischen zwei modernen Sesseln ein altes, viel zu niedriges Ledersofa, dessen Bezug mit den Jahren stumpf und rissig geworden war. Auf ebendiesem Sofa, umgeben vom beißenden Geruch einer Brandruine, verbrachte Alexander den größten Teil des Vormittags, während die Personen rechts und links auf den Sesseln regelmäßig und nach überwiegend unerfreulichen Gesprächen wechselten. Schließlich erfuhr er, dass im Haus keine Einsturzgefahr bestand und dass sogar der Dachboden über dem Südflügel betreten werden durfte. Dessen Existenz hatte er längst vergessen, aber seine Einsturzgefahr war der Grund für die Wassermassen gewesen, mit denen die Feuerwehr von außen den Südflügel hatte fluten müssen.
Nach zwei Stunden stieg Alexander Kilian wieder hinauf zum versiegelten Flur, wo sich bis vor Kurzem sein Arbeitszimmer befunden hatte. Hier hatte sich nichts verändert, nicht einmal Frau Brändle. Reglos stand sie am Fenster des Treppenhauses an derselben Stelle, wo er sie vor zwei Stunden verlassen hatte, und sah hinunter auf die Straße: eine Heimatlose in dem Haus, in dem sie den größten Teil der letzten zehn Jahre verbracht hatte. Von der Aufregung, die er erwartet hatte, war nichts zu sehen oder zu hören. Seine Sekretärin hatte sich in einen Stein verwandelt.
Er war eben zum Sofa zurückgekehrt, als ein junger rot gelockter Beamter der Kriminalpolizei auf einem der Sessel neben dem Sofa Platz nahm und ihm mitteilte, dass die Kripo wie auch schon die Feuerwehr momentan von Brandstiftung ausgehe.
„Aber ich habe den Blitz doch mit eigenen Augen gesehen“, widersprach Alexander verzweifelt.
„Blitzschlag kommt nicht in Betracht. Der Feueralarm ging bei der Leitzentrale um einundzwanzig Uhr vierzig ein, zwei Minuten vor dem ersten Blitz in Herdern.“
„Aber so genau kann man das doch gar nicht wissen“, versuchte er es noch einmal, als sei eine erträgliche Brandursache nur eine Frage der richtigen Argumentation.
„Blitzschläge werden genau registriert und die Anrufe in der Feuerwehrleitzentrale ebenfalls.“
„Vielleicht ging eine Uhr falsch.“
„Da ist noch etwas anderes“, sagte der Kommissar, ohne auf den Einwand einzugehen, und Alexander ahnte, dass Brandstiftung noch nicht das Schlimmste war, was er heute würde ertragen müssen. Es reicht, dachte er, so viel Unglück auf einmal, das hatte niemand verdient, er schon gar nicht.
„Kommen Sie mal mit, bitte?“
Gleich hinter der Tür zum Obergeschoss des Südflügels befand sich in der Decke eine Öffnung, die Alexander noch nie aufgefallen war. Jetzt führte eine Leiter nach oben. Von dort aus sah man direkt in den wolkenverhangenen Freiburger Himmel. Früher musste dort das Dach gewesen sein.
Der Beamte stieg hinauf, und Alexander folgte ihm. Hier oben war alles nass und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Geblieben war Verbogenes, Verkohltes, Verklebtes: eine gespenstische Masse. Über allem war der graue Himmel, aus dem jetzt einzelne Tropfen fielen. Sie durchquerten den Dachboden in seiner ganzen Länge auf einem schmalen Pfad, der notdürftig vom Brandschutt befreit worden war. Ganz am Ende, halb verdeckt unter geborstenen Dachschindeln und den Überresten verkohlter Balken, lag ein formloses schwarzes Bündel auf dem Boden, beinahe so groß wie ein Mensch. Alexander schloss die Augen, öffnete sie wieder. Das verkohlte Bündel war einmal ein Mensch gewesen. Er sah an dem verbrannten Körper vorbei und kämpfte gegen den Schwindel, der ihn bei dem Anblick befallen hatte. Zur toten Ratte nun ein grauenvoll verkohlter Mensch – als hätte ihn das Entsetzen noch nicht genügend im Griff!
Nun standen ihm noch die Befragungen der Kripo bevor. Ihm graute vor dem, was dabei zutage treten mochte. Wer war dieser tote Mensch auf dem Dachboden, den er selbst nie betreten hatte? Wie kam er hierher? Und wie hing alles miteinander zusammen?
Alexander verließ den Bodenraum und rannte die Treppen hinunter, als stünde das Haus noch immer in Flammen. Er brauchte Luft. Sofort! Minutenlang blieb er keuchend auf dem Gehweg stehen, ehe er sich zögernd zum Gebäude umdrehte – zu seinem Schloss – oder was davon übrig geblieben war. Ein Haupthaus, das mit dem nachgemachten Bossenmauerwerk etwas protzig wirkte, daneben der Nordflügel mit dem schiefergedeckten steilen Mansardendach, das den hochherrschaftlichen Eindruck noch verstärkte. Doch dann fiel sein Blick auf den Südflügel: verkohlte Dachbalken, ausgebrannte Fensterhöhlen wie die leeren Augen einer Fratze, darüber eine vom Rauch geschwärzte Fassade. Und Ina hatte von der Chance seines Lebens gesprochen.
Mit einer verkohlten Leiche im Haus?
Alexander fühlte eine Hand, die sich auf seine Schulter legte, und sah sich um. Der Arm, zu dem die Hand gehörte, endete knapp unterhalb eines breiten Schädels, der ihn mit dem hängenden Schnauzbart an den eines Walrosses erinnerte. Sein Freund, der Kommissar Jörg Gessler.
„Mein herzliches Beileid“, sagte Gessler, und es klang nicht einmal ironisch. „Ich soll mich hier nützlich machen.“
„Wegen des Toten?“, fragte Alexander irritiert.
Gessler nickte. „Wenn es sich denn um einen Mann handelt.“
Die Möglichkeit, dass es eine Frau sein könnte, hatte Alexander noch gar nicht in Betracht gezogen. Das Leben bot viele Überraschungen, leider nur schlimme in der letzten Zeit. Auch die Erkenntnis, dass sein bester Freund für die Aufklärung des Brandes zuständig war, fand er nicht erfreulich. Gern sah er ihn als verschwiegenes Bindeglied zur Kripo oder als heimlichen Berater und Beichtvater. Aber doch nicht als offiziellen Ermittler!
„Und warum ausgerechnet du?“, fragte er.
„Mein Chef geht davon aus, dass bei dir seine besten Leute gebraucht werden.“
Alexanders Blick blieb an einer Lederjacke unmittelbar neben dem Kommissar hängen. Sie spannte sich über der üppigen Oberweite einer rothaarigen Frau, deren Anblick geeignet war, ihn sofort in die Flucht zu schlagen. Es war eine Walküre wie aus einer Wagneroper mit rot gefärbten Haaren und einem dunklen Damenbart, die ihre Körperfülle in eine glänzende Lederjacke mit großen goldenen Schließen gezwängt hatte. Korpulent, fiel ihm ein. Korpulent klang wie Körper. Wie zu viel Körper. Man sollte das Wort viel häufiger aus der Versenkung holen, dachte er, die Kommissarin hingegen darin verschwinden lassen. Sie war ihm nur zu gut bekannt, und die Erinnerung an sie gehörte in die Rubrik unangenehm. Genau genommen: sehr unangenehm. Damals hatte sie noch nicht im Dezernat Kapitalverbrechen gearbeitet, sondern sich mit eher harmlosen Vergehen befasst. Mit der vergeblichen Suche nach angeblich schlampigen Aufzeichnungen über gentechnisch veränderte Organismen in seinem Institut zum Beispiel. Die besten Leute dieses Dezernats? Bei dieser Person hatte er Zweifel.
„Wir brauchen einen Raum, um Ihre Mitarbeiter einzeln zu befragen.“ Die Stimme der Lederjackenkommissarin passte zu ihrer Erscheinung: besitzergreifend und unabwendbar.
Alexander duckte sich unwillkürlich. „Es gibt eine Sitzecke im Flur“, sagte er und dachte an das alte Ledersofa, auf dem er den Vormittag verbracht hatte.
„Ein Flur dürfte kaum der geeignete Ort sein, um Personen einzeln zu befragen“, donnerte die Kommissarin in einem Ton, der jegliches Denken seinerseits im Keim erstickte.
Frau Brändle! Endlich gab es für sie eine Aufgabe.
„Meine Sekretärin wird Ihnen einen geeigneten Raum zeigen.“
„Bitte“, sagte die Walküre, und es gelang ihr, selbst dieses unschuldige Wort mit einem so vorwurfsvollen Ton von sich zu geben, dass er sofort ein schlechtes Gewissen hatte.
Nachdem er die einzige lösbare Aufgabe an seine Sekretärin abgetreten hatte, fühlte sich Alexander so nutzlos wie am ersten Arbeitstag in fremder Umgebung. So ging es nicht weiter. Er musste versuchen, das Unglück zu bewältigen, am besten mit System. Aber wie konnte er vernünftig nachdenken, wenn er sich nirgends zurückziehen konnte? Folglich brauchte er als Erstes eine wie auch immer geartete Bleibe, ein Arbeitszimmer sozusagen, oder noch besser zwei, damit Frau Brändle in Reichweite blieb.
Alexander machte sich auf den Weg durch den Teil des Instituts, der vom Brand verschont geblieben war. Einige Räume schieden von vornherein aus. Der Kühlraum zum Beispiel. Andere, die von vielen Mitarbeitern genutzt wurden, wie der Spülraum und der Raum mit den großen Zentrifugen, waren ebenfalls nicht geeignet. Vielleicht sollte er als Chef einfach ein schönes Zimmer für sich konfiszieren? Auch diese Idee war nicht wirklich brauchbar. Er ging von Tür zu Tür und fühlte sich wie bei der Suche nach einem komfortablen Parkplatz am Feldbergpass an einem sonnigen Sonntag während der Skisaison. Auf den ersten Blick war die Lage hoffnungslos, aber mit einer originellen Idee konnte man sich einen kilometerweiten Fußmarsch entlang der Bundesstraße ersparen.
Er war ernsthaft überrascht, wie viele Räume es gab, die er noch nie betreten hatte. Im Nordflügel stieß er im zweiten Obergeschoss auf eine Tür, die schmaler war als die anderen. Den Raum dahinter konnte man bestenfalls als Kämmerchen bezeichnen. Immerhin gab es ein Fenster mit Blick auf eine alte Kastanie. Er wusste sofort, dass er gefunden hatte, wonach er suchte. Ein Raum, in dem kein Platz für viele lästige Besucher war. Besser hätte es gar nicht kommen können. Ein Problem sah er, aber ein lösbares: An allen Wänden standen große Metallregale, wie man sie in Kellerräumen zu verwenden pflegt. Sie waren vollgestopft mit Kartons voller Labormaterial, außerdem mit großen Kanistern und Flaschen, doch auf dem Flur vor dem Zimmer war noch Platz. Sein Verbot, die Gänge als Abstellraum zu missbrauchen, würde er in einem Notfall wie diesem vorübergehend außer Kraft setzen. Blieb nur noch das Problem Brändle.
Leise wie ein Eindringling, der etwas Verbotenes getan hat, schloss er die Tür und kehrte in den ersten Stock zurück. Tatsächlich befand sich hier ein ebensolcher Raum wie im Stockwerk darüber, aber ein paar Meter hinter dem Fenster war ein Mauervorsprung, der die Aussicht versperrte.
Als Alexander ins Haupthaus zurückkehrte, roch es im Flur vor der Bibliothek nach Kaffee. Dort hatte seine Sekretärin hinter verschlossener Tür Jörg Gessler und seine Lederjackenkollegin einquartiert. Mit eifrigen Bewegungen schaffte sie Stühle heran und stellte sie neben die Tür – für die Wartenden wahrscheinlich, von denen noch nichts zu sehen war. Offensichtlich war Frau Brändle aus ihrer Erstarrung erwacht und klammerte sich an die neue Aufgabe wie an einen Rettungsring, der sie vor dem Ertrinken bewahrte. Doch jetzt hatte er eine andere Aufgabe für sie, eine größere, die ihren Fähigkeiten angemessener war. Er bat sie, mit ihm zu kommen.
Die Treppen zum zweiten Obergeschoss nahm er demonstrativ mühelos, um ihr zu zeigen, wie sicher er seiner Sache war. Die leichte Atemnot verbarg er, indem er nichts sagte. Dieses Mal folgte ihm seine Sekretärin mit einem Gesicht, das er ebenfalls gut kannte, dem Eigentlich-habe-ich-keine-Zeit-Gesicht. Mit einer Geste, als führe er sie in einen Palast, öffnete er die Tür zu dem kleinen Magazin, das er zu seinem Arbeitszimmer machen wollte.
Erst einmal sagte sie gar nichts. „Hier?“, fragte sie dann und dehnte das eine Wort, bis es die Länge eines ganzen Satzes hatte. Zu seiner Überraschung teilte sie seine Begeisterung für das Kämmerchen nicht, ganz im Gegenteil, sie sah erschüttert aus.
Er ließ sich nicht beirren. „Bitte lassen Sie den Raum vom Hausmeister leer räumen, und sorgen Sie für einen Schreibtisch und einen Stuhl und wenn möglich für ein Telefon.“
„Raum?“, wiederholte sie.
„Zimmer, wenn Ihnen dieser Ausdruck lieber ist.“
„Das Zimmer“, sagte sie und schüttelte den Kopf. „Und wo bleibe ich?“
Alexander setzte eine zuversichtliche Miene auf, die nicht zu seinen schlimmen Erwartungen passte, und führte sie ein Stockwerk tiefer.
Er hatte sich nicht getäuscht. Frau Brändle stand einen Augenblick stumm und fassungslos, als er die Tür zu dem winzigen Zimmerchen öffnete, dann brach sie in Tränen aus. „Wir können auch tauschen“, bot er an, bereute es aber sofort wieder. Dieses Zimmer mit Blick auf eine Mauer war in der Tat schlimmer als eine Gefängniszelle.
„Zu klein?“, fragte er mitfühlend.
Seine Sekretärin schüttelte den Kopf.
„Zu dunkel?“
Sie schüttelte heftiger. „Das ist es nicht“, brachte sie endlich hervor.
„Was ist es dann?“
„Hier im ersten Stockwerk? So weit von Ihrem Zimmer entfernt …“ Sie hörte gar nicht wieder auf, ihren Kopf zu schütteln.
Irgendwie hatte sie recht. Eine Vorzimmerdame, die nicht im Vorzimmer saß, war keine gute Lösung. „Es ist ja nicht für immer“, tröstete er sie.
„Ja“, sagte sie, und mit sichtbarer Mühe gelang ihr ein Lächeln. „Die Kripo wartet auf mich“, bemerkte sie dann und verschwand mit eiligen Schritten.
Alexander kehrte zu seinem Kämmerchen zurück. Lange stand er vor der offenen Tür und suchte nach einer Lösung, mit der seine Sekretärin leben konnte. Dann fand er sie. Der kleine Raum war einer der letzten in dem langen Flur, und genau daraus ergab sich eine Möglichkeit: Man musste nur den hinteren Teil des Korridors durch einen Wandschirm abtrennen – und schon entstand dort ein brauchbarer Arbeitsplatz, der sogar ein schönes Fenster hatte.
Alexander war der Zweite auf der Liste der Institutsangehörigen, die von der Polizei befragt werden sollten. Aus irgendeinem Grund hatten Jörg Gessler und die Lederjackenkommissarin Frau Brändle an die erste Stelle gesetzt. Wahrscheinlich war das Gesslers Werk, weil er wusste, wer in diesem Institut den Überblick hatte. Vielleicht war seine Sekretärin auch einfach nur als Erste greifbar gewesen, weil sie den beiden den Raum zugewiesen hatte? Trotzdem irritierte ihn die Reihenfolge.
Noch etwas irritierte ihn: Beate Brändles zu Boden gerichteter Blick, als sie nach ihrer Aussage an ihm vorbei aus der Bibliothek schlich. Die Flammen hatten zuerst nur im Sekretariat gelodert. Vielleicht war sie schuld an dem Brand? Vielleicht die neue Kaffeemaschine? Leider nein. Der rot gelockte Beamte von der Kripo hatte von Brandstiftung gesprochen.
Alexander wunderte sich, wie ein angenehmer Raum wie die Bibliothek plötzlich zu einer furchterregenden Kammer werden konnte. Eine grimmige Walküre reichte aus, um die vertraute Umgebung in die Höhle eines Löwen zu verwandeln.
„Was macht Ihnen mehr zu schaffen: mir und meinem Kollegen die Wahrheit über das Feuer zu offenbaren oder die Tatsache, dass diese an die Öffentlichkeit gelangen könnte?“, eröffnete Frau Funkel – so hieß die Lederjackenkommissarin – das Gespräch, kaum dass er an dem viel zu großen Besprechungstisch Platz genommen hatte.
Alexander schwieg eine Weile, denn er fühlte sich von der seltsamen Frage überrumpelt. Er hatte gedacht, sie würde wissen wollen, wer sich auf dem Dachboden versteckt haben könnte, aber danach fragte sie nicht.
„Ich weiß nicht, worauf Sie hinauswollen“, antwortete er schließlich. „Da ich die Wahrheit nicht kenne, kann ich sie Ihnen nicht offenbaren.“
Der Kommissarin gelang das Kunststück, auf ihn, den Größeren, herabzuschauen. Jedenfalls hatte ihr Gesicht diesen Ausdruck. „Ich helfe Ihnen: Das Feuer wurde im zweiten Obergeschoss offenbar an zwei Stellen gelegt – einerseits im Sekretariat direkt an der Tür zu Ihrem Zimmer und andererseits im Flur, vermutlich vor einem Schrank mit Büromaterial, der unter dem Zugang zum Dachboden stand. Der Täter hat sich nicht die Mühe gemacht, die Brandstiftung zu verschleiern, ganz im Gegenteil. Die Kanister für den Brandbeschleuniger waren schon für die Feuerwehr nicht zu übersehen.“
„Ich verstehe immer noch nicht, was Sie von mir wollen. Sie wissen offenbar mehr als ich. Welche Wahrheit soll ich Ihnen unter diesen Umständen noch offenbaren?“
Sie fixierte ihn und presste für einen Augenblick die Lippen zusammen, wie amerikanische Präsidenten es gern tun, um ihre Entschlossenheit zu demonstrieren. „Sie wissen, warum das Sekretariat und Ihr Arbeitszimmer in Flammen aufgegangen sind, aber Sie wollen den Grund verheimlichen.“
Alexander überlegte, ob er auf diese unsinnige Unterstellung überhaupt eingehen sollte. „Wissen Sie, was mich stört?“, sagte er und merkte selbst den scharfen Ton in seiner Stimme. „Ich habe das Gefühl, Sie wollen diesen Brand mit meiner Person verknüpfen.“ Seine Stimme wurde lauter. „Verstehen Sie, es reicht mir, dass es gebrannt hat, dass vermutlich Brandstiftung die Ursache ist und – was noch viel schlimmer ist – dass ein Mensch dabei ums Leben gekommen ist. Deshalb möchte ich, dass Sie Ihre Ermittlungen durchführen wie immer und mir nicht irgendwelche Geheimnisse unterstellen.“
Vergeblich suchte er den Blick seines Freundes. Der müsste doch jetzt zustimmend nicken! Doch Gessler blickte zur Seite, als hätte er mit dem Ganzen nichts zu schaffen.
Die nächsten Fragen hatte seine Sekretärin vermutlich viel zuverlässiger beantwortet, als er das konnte. Wer die Klappe zum Dachboden öffnen konnte, sollte er der Lederjackenkommissarin erzählen, und ob die eingebaute Ausziehleiter auch von oben bedient werden konnte.
„Wie soll ich das wissen?“, antwortete er und zuckte mit den Schultern. „Ich wusste nicht einmal, dass es einen begehbaren Dachboden gab.“
„Obwohl sich der Zugang in unmittelbarer Nähe Ihres Zimmers befand?“
„Ich lege meinen Kopf beim Gehen nicht in den Nacken, deswegen habe ich die Klappe an der Decke nicht bemerkt“, erklärte er mit übertriebener Ernsthaftigkeit.
„Aber Sie haben die Schritte über Ihrem Zimmer gehört.“
„Nein“, sagte er unwirsch, „nächste Frage, bitte.“
Die Walküre warf erst ihm einen zornigen Blick zu, dann ihrem Kollegen einen verschwörerischen. Entweder war ihr bei der Begrüßung entgangen, wie gut er Jörg kannte, oder sie hatte es schon wieder vergessen.
„Übrigens war die Haustür aufgebrochen. Sonst gab es nirgends Einbruchspuren.“
„Keine Einbruchspuren am Sekretariat?“ Er war ehrlich erstaunt.
„Sie haben es erfasst. Ist das Sekretariat nie abgeschlossen?“
Er ärgerte sich über den arroganten Ton. „An einem Sonntagabend ist das Sekretariat immer abgeschlossen“, sagte er und lieferte ihr damit die nächste Vorlage.
„Wie können Sie sich so sicher sein? Dann müsste der Brandstifter einen Schlüssel gehabt haben.“
Er seufzte und schwieg. Sie schien es darauf anzulegen, ihn ins Unrecht zu setzen. Außerdem wunderte er sich über ihre Behauptung, was die fehlenden Einbruchspuren an der verkohlten Tür zum Sekretariat betraf. Wer konnte das so schnell beweisen?
„Ich bin kein Hellseher“, erklärte er und berichtete, dass er die letzten Tage vor dem Brand in Dresden gewesen sei.
„Aber die Klappe zum Dachboden wurde nicht erst während Ihrer kurzen Abwesenheit eingebaut. Deren Funktion müsste Ihnen bekannt sein.“
„Nein, ich sage Ihnen noch einmal: Ich habe davon nichts gewusst. Denken Sie, ich würde es Ihnen verschweigen, wenn ich etwas wüsste?“
„Ihre Sekretärin sagt, sie wisse nichts von einem Dachboden, Sie spielen ebenfalls den Ahnungslosen, aber irgendjemand muss diesem Menschen, der dort oben verbrannt ist, Zugang verschafft haben.“
Alexander suchte wieder Jörgs Blick, aber sein Freund starrte jetzt angestrengt auf einen Punkt der weißen Tischplatte, an dem überhaupt nichts zu sehen war. Der Block, auf dem er offenbar so etwas wie ein Protokoll schreiben wollte, war noch immer leer.
„Der Gedanke, dass ich jemandem Zutritt zum Dachboden verschafft haben könnte, ist absurd. Vielleicht gab es Mitarbeiter, die von dem Zugang wussten?“ Er erschrak plötzlich. „Und womöglich ist der Tote ein Mitarbeiter?“
Sie überging seine Frage. „Ich habe nicht behauptet, dass der Tote mit Ihrer Hilfe auf den Dachboden gelangt ist, aber ich gehe davon aus, dass Sie wissen, wer dort oben war und warum.“
Vielleicht glaubte sie selbst nicht, was sie ihm unterstellte, und wollte ihn nur aus der Reserve locken. Aber er wusste nichts, da konnte sie locken, so viel sie wollte.
Er fixierte sie grimmig. „Wo das Wissen fehlt, bleibt nur die Vermutung“, stellte er fest und nickte dazu.
Ihr Blick war vernichtend und machte ihm klar, wie wenig sie von Männern hielt, die sich um ein übergeordnetes Verständnis für die Fallstricke des Alltags bemühten.
„Wer ein Feuer legt, will – warum auch immer – einen Schaden anrichten, oder er will gezielt etwas vernichten. Vielleicht eine wissenschaftliche Arbeit, vielleicht sogar einen Menschen. Fällt Ihnen dazu nichts ein?“
Sie spricht wie ein entnervter Prüfer zu einem schlecht vorbereiteten Studenten, dachte er. Außerdem stellt sie die falschen Fragen. Er müsste ihr von der toten Ratte erzählen, von dem niedergedrückten Zaun, aber mit dieser Frau konnte er nicht reden. Von Jörg Gessler kam kein einziges Wort. Natürlich hätte er von der toten Ratte erzählt, wenn die Lederjackenkommissarin normal mit ihm geredet hätte. Aber das tat sie nun einmal nicht.
Eine halbe Stunde dauerte das unerfreuliche Gespräch, dann stand Alexander wieder vor der Bibliothek. Diese neugierigen Mitarbeiter, die auf ihn warteten! Er hätte jetzt etwas sagen sollen, aber sein Mund war wie zugeschnürt. Er ärgerte sich. Jörg Gessler, der Feigling! Offenbar hatte er keine Lust gehabt, der Walküre in die Parade zu fahren, deswegen hatte er die ganze Zeit geschwiegen.
In die Parade fahren. Er stellte es sich bildlich vor. Jörg auf einem Motorrad und dann mitten hinein in die in Reih und Glied aufgestellten Soldaten der Kommissarin. Vielleicht wäre danach ein sinnvolles Gespräch möglich gewesen.
Er musste eine Weile überlegen, bis er sich erinnerte, wo das Kämmerchen lag, in dem er die nächsten Wochen oder Monate verbringen wollte. Vielleicht sollte Frau Brändle die Tür mit seinem Namen beschriften? Oder wäre es besser, wenn ihn kaum jemand fände? Endlich einmal könnte er in Ruhe arbeiten. Nur was, unter diesen Umständen?
Wie zur Probe setzte er sich an seinen Schreibtisch. So also sah der Neuanfang aus: leere Schubladen, eine bis auf ein Telefon und einen Kugelschreiber leere Tischplatte. Er erhob sich wieder von dem Stuhl, der noch keine Zeit gehabt hatte, seiner zu werden. Für heute reicht es, dachte er und suchte vergeblich nach einem Schlüssel, um sein Zimmerchen hinter sich abzuschließen.
Als er Frau Brändles neuen Arbeitsplatz betrat, der jetzt durch einen Wandschirm vor neugierigen Blicken verborgen war, fand er ihn so leer und aufgeräumt vor, wie das Sekretariat am Feierabend zu sein pflegte. Frau Brändle hatte sich nicht verabschiedet. Hatte sie ihn vergessen? Oder hatte sie es eilig gehabt und nicht warten wollen, bis er wieder in sein Kämmerchen zurückgekehrt war?
Seit sie frischverliebt war, kam er öfter zu kurz. Daran änderten auch ihre Tränen beim Angebot eines weit von ihrem Chef entfernten Zimmers nichts. Vermutlich würde sie wieder aufmerksamer mit ihm umgehen, wenn sie erst einmal verheiratet war. Ein Trauschein schien ihm seit seiner eigenen gescheiterten Ehe ein probates Mittel gegen heftige Liebe. Jedenfalls hatte sie Andeutungen über eine baldige Trauung im kleinen Kreise gemacht, aber noch schien sie um das Jawort ihres Liebsten zu bangen. Er hätte es nie für möglich gehalten, dass seine früher so altjüngferlich scheinende Sekretärin jemals heiraten würde.
Hundert Meter vom Institut entfernt entdeckte er sie. Frau Brändle war in eine Seitenstraße gebogen, die auf den Schlossberg zuführte, schien aber unschlüssig, wohin sie nun gehen sollte. Der Weg zur Straßenbahn lag in der entgegengesetzten Richtung. Alexander bog ebenfalls in die Seitenstraße ein. An einem solchen Tag ohne Abschied zu verschwinden, fand er nicht angemessen, zumal er sich ein paar tröstende Worte für die Bedauernswerte zurechtgelegt hatte.
Seine Sekretärin ging weiter auf den Schlossberg zu, und er folgte ihr, ohne sich darum zu bemühen, sie einzuholen. Wenn er nicht beobachtet hätte, wie sie sich in den letzten Wochen ganz allmählich verwandelt hatte – er hätte sie auf diese Entfernung nicht erkannt. Bemerkenswert war die Veränderung ihres Ganges. Das eilige Trippeln, Zeichen ihrer unentwegten Geschäftigkeit, beschränkte sich nun auf besondere Ausnahmen. Stattdessen hatte ihr Gang etwas Wiegendes, Sinnliches bekommen. War es den durch die Verliebtheit reichlicher ausgeschütteten weiblichen Hormonen zu verdanken, dass seine Sekretärin plötzlich so heftig mit den Hüften wackelte? Oder hatte sie sich das absichtlich angewöhnt, um ihrem Freund zu gefallen?
Auch ihre Haare hatten sich verändert. Sie waren nicht mehr kurz und glatt wie früher, sondern kringelten sich anmutig und sehr weiblich in die Stirn. Das Gesicht sah um Jahre jünger aus, was nicht nur an den weit offenen Augen lag. Es war, als hätte die Liebe in ihrem Gesicht ein Licht angeknipst. Vor ein paar Tagen war ihm ihr Busen aufgefallen – trotz seiner Größe ziemlich spitz. Hatte auch der sich verändert?
Beate Brändle hatte die Längenhardstraße erreicht und blieb am Straßenrand stehen. Sie schien etwas zu suchen. Wenige Meter von ihr entfernt stieg ein Mann aus einem in einer Einfahrt geparkten dunkelblauen Mazda. Ihn hatte sie gesucht. Der Mann hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem dicklichen Beamtentyp, den er seiner Sekretärin als zukünftigen Ehemann zugetraut hatte. Nein, es war ein Bild von einem Mann! Groß, schlank und die Haut in der Farbe von Milchkaffee, Haare und Vollbart in sattem Schwarz. Er sei Inder, hatte sie ihm vor ein paar Wochen mit verklärtem Blick erzählt. Jetzt, wo er ihn sah, musste er sofort an das Kamasutra denken, wahrscheinlich Pflichtlektüre für jeden gebildeten Inder.
Der Inder trug ein bunt gemustertes Hemd und eine helle Hose. Es fehlte nur die Blumenkette, und das Bild von einem wohlsituierten Hindu wäre perfekt gewesen. Die helle Haut sprach für eine hohe Kaste. Richtig. Er sei Brahmane, hatte sie erzählt. So ein sanftes Gesicht! Und dieser Mann verliebte sich in seine Frau Brändle.
Er erinnerte sich, dass Jörg vor Jahren versucht hatte, mit ihr anzubändeln, und dass er selbst sie anfangs durchaus attraktiv gefunden hatte. Vielleicht lag es an ihrer Tüchtigkeit, dass sich diese Einschätzung bald verflüchtigt hatte. Solche mustergültigen Frauen erzeugten in ihm unweigerlich das Gefühl, ein Versager zu sein. Inas Tüchtigkeit hatte sich erst an seiner Seite entwickelt. Jetzt musste er damit leben.
Er hätte jetzt gehen können, seine Sekretärin hatte offenbar anderes im Sinn, als sich von ihrem Chef trösten zu lassen, doch er blieb. Der gut aussehende Inder legte ihr einen Arm um die Schultern, während der andere wie zufällig auf ihrem Po zu liegen kam. Mit diesem zog er sie an sich und verbog sie dabei, bis sie aussah wie ein in verkehrter Richtung gespannter Bogen. Aus irgendeinem Grund, den er nicht verstand, empfand Alexander so etwas wie Eifersucht. Er sah weg. Das Liebesleben seiner Mitarbeiter ging ihn nichts an. Als er wieder hinsah, hatten sich die beiden Gesichter einander genähert. Noch fünf Zentimeter bis zum Kuss. Alexander entfernte sich. Den Rest brauchte er sich nicht anzusehen. Seine gewissenhafte, tüchtige und längst nicht mehr junge Sekretärin – den vierzigsten Geburtstag hatte sie gerade hinter sich gebracht – schickte sich an, auf der Straße herumzuknutschen wie ein Teenager! Der Anblick war unangenehm, nicht nur weil sie kein Teenager mehr war. Es war noch etwas, das ihn störte. Der Mann passte nicht zu ihr: zu schön, zu jung. Er sah schon ihre rot geweinten Augen vor sich, wenn sie zur Kenntnis nehmen musste, dass ihr exotischer Liebhaber mit einer anderen im Bett lag.
Das Haus, in dem er wohnte, stand noch, als Alexander aus dem Institut zurückkehrte. Ein wenig wunderte ihn das. Seit gestern war alles, was früher fest gefügt schien, auf eine beängstigende Weise in Bewegung geraten, und die einfachsten Dinge hatten ihre Selbstverständlichkeit verloren. Was würde ihn in der Wohnung erwarten? Die nächste Katastrophe oder zumindest die nächste tote Ratte? Er schloss die Tür auf, öffnete sie vorsichtig einen Spaltbreit, schob sie weiter auf. Nichts. Jedenfalls nichts, was ihn hätte beunruhigen können. Er griff sich den Fahrradschlüssel und verließ die Wohnung gleich wieder, um zu Ina zu fahren.
Als er sein Fahrrad auf die Straße schob, sah er die junge Frau. Sie stand ein paar Meter von ihm entfernt, ihr Gesicht war halb verdeckt von einem weit ausladenden Haselnussstrauch. Mit den Sandalen an den nackten Füßen, dem knöchellangen blau gemusterten Rock, einem türkisfarbenen T-Shirt und dem um Schultern, Hals und die blonden Haarspitzen geschlungenen Tuch erinnerte sie ihn an die Hippiemädchen aus seiner Jugendzeit. Bewegungslos starrte sie auf einen Punkt irgendwo im Garten. Als sie ihn bemerkte, wandte sie sich so ruckartig ab, als hätte er sie bei etwas Verbotenem ertappt, und ging rasch auf den Stadtgarten zu. Sie kam ihm bekannt vor, aber er konnte sich nicht erinnern, wo sie ihm schon einmal begegnet sein könnte. Als ihm kurz darauf an der Mozartstraße ein Auto von links die Vorfahrt nahm, hatte er sie wieder vergessen.
Ausnahmsweise hielt er heute an jeder roten Ampel, machte einen übertrieben großen Bogen um die Fußgänger, die blindlings wie Schlafwandler die Herrenstraße überquerten, und fuhr in der Salzstraße hinter der Straßenbahn her, anstatt wie sonst im letzten Augenblick die Poleposition zu erkämpfen. Das Schicksal nicht herausfordern, dachte er, nicht heute. Der Satz vom Unglück, das selten allein kommt, war leider nur zu wahr.
Als er die Dreisam hinter sich gelassen hatte und bei Rot in einer viel zu kleinen Lücke zwischen den Autos über die Talstraße schoss, hatte er die guten Vorsätze schon wieder aufgegeben: Dem Schicksal war sein Fahrstil völlig gleichgültig. Auch vorsichtige Menschen wurden nicht vom Unglück verschont.
Gegen zehn Uhr radelte Alexander sehr langsam wieder nach Hause. „Du musst das Problem bei den Hörnern packen“, hatte Ina gesagt, und dann hatte sie geredet und geredet und tausend Ideen gehabt, was er tun sollte: nach freien Arbeitsflächen in den erhaltenen Räumen suchen, bei der Univerwaltung Anträge auf Ersatz der zerstörten Geräte und Möbel einreichen, gleichzeitig nach gebrauchten Geräten als Zwischenlösung Ausschau halten, eine Hilfskraft für die zusätzlichen Arbeiten beantragen, eine Mitarbeiterversammlung einberufen, um die Probleme gemeinsam zu lösen. Den Rest hatte er schon wieder vergessen. Er hatte ihr zugehört, hatte versucht, ein dankbares Gesicht aufzusetzen, und genickt, aber er wollte das nicht hören, nicht jetzt. Er war noch nicht so weit. Noch wollte er sich seiner Trauer hingeben.
Erst kurz bevor er gegangen war, hatte er über das verkohlte Bündel vom Dachboden gesprochen, das einmal ein Mensch gewesen war.
Ina war sehr blass geworden. „Ein Mann oder eine Frau?“, hatte sie gefragt. „Alt oder jung?“ Er hatte es noch immer nicht gewusst. Die tote Ratte fiel ihm erst wieder ein, als er auf dem Fahrrad saß und nach Hause radelte.
Alexander erreichte Jörg Gessler über dessen Handy.
„Es brennt mal wieder“, stellte dieser trocken fest, als Alexander seinen Namen gesagt hatte.
„Es brennt?“, wiederholte der entsetzt.
„Ich meinte im übertragenen Sinne, warum sonst rufst du um diese Zeit und auf meinem Handy an?“
Die Verbindung war schlecht, Gessler schien im Auto oder in einer Bahn zu sitzen.
„Ich wollte dich nur fragen, wer von euch beiden der Chef ist, du oder deine Kollegin?“
„Ich natürlich.“
„Und warum hast du vorhin kein Wort gesagt?“
„Weil du in Gegenwart meiner lieben Kollegin sowieso nicht mit für dich unangenehmen Einzelheiten rausrückst.“
Alexander fühlte sich ertappt und schwieg. Er bereute, überhaupt die Handynummer gewählt zu haben, als er Jörg nicht zu Hause erreicht hatte. Die Stimme seines Freundes klang wie die eines Fremden. Alexander verstand nicht, wie manche Menschen stundenlang mit diesen dürftigen Geräten telefonieren konnten, die aus jedem Gesprächspartner einen quakenden Zombie machten.
„Um solche Details geht es doch jetzt, nehme ich an“, hörte er Gessler sagen.
„So ist es“, gestand Alexander kleinlaut ein. Schon wieder wurde er sofort durchschaut, und das trotz der schlechten Verbindung und einer neugierig fragenden Frauenstimme im Hintergrund. War das Verhalten anderer Menschen ebenso vorhersehbar wie seines, oder machte er es seinen Mitmenschen besonders leicht, weil er immer gleich handelte?
„Ich habe gestern Abend vor meiner Wohnungstür eine tote Ratte gefunden“, sagte er. „Eine weiße.“
Gessler schwieg, und Alexander wusste nicht, ob die Verbindung abgebrochen war oder sein Freund die Registerkarten in seinem Gehirn nach dem Stichwort tote weiße Ratte durchblätterte.
„Kein Drohbrief oder Ähnliches?“ Jörg schien eine passende Kategorie gefunden zu haben.
„Warum fragst du?“
„Wenn ausgerechnet vor deiner Haustür eine weiße Ratte liegt, würde ich …“ Gesslers Stimme löste sich in Rauschen auf.
„Was würdest du?“
Es rauschte immer noch.
Als Alexander zum dritten Mal fragte, war die Verbindung wiederhergestellt. „… würde ich annehmen, dass dir jemand etwas klarmachen möchte“, setzte Gessler mit deutlicher Verspätung seinen Satz fort.
„Du denkst an Gentechnikgegner?“
„Zum Beispiel.“
Der Brand, die tote Ratte: Was der Kommissar sagte, lag auf der Hand. „Glaube ich nicht“, widersprach Alexander trotzig in das nun leisere Rauschen hinein.
„Weil du es nicht glauben willst.“
Natürlich hatte Jörg recht, und Alexander wusste selbst, dass er keine anderen Tatsachen schaffen würde, indem er sich der Erkenntnis verschloss. „Als ich ein paar Minuten später auf die Terrasse gegangen bin, habe ich hinten im Garten lautes Rascheln gehört“, rief er, als könnte er die schlechte Verbindung dadurch überbrücken. Er bemerkte selbst seine viel zu laute Stimme. Gut, dass Ina ihn nicht hörte.
„Ein Igel?“
„Könnte man meinen. Heute Morgen habe ich gesehen, dass dort, von wo die Geräusche kamen, der Zaun nach außen heruntergedrückt ist.“
Schweigen. Ein langes Schweigen. Vielleicht war auch die Verbindung wieder abgerissen.
„Warum sollte jemand über den Zaun verschwinden, wenn er genauso gut das Gartentor benutzen könnte?“, hörte er endlich Jörgs Stimme.
„Berechtigte Frage. Die Flucht über den Zaun hätte nur dann einen Sinn, wenn es einen Verfolger gab. Mich, zum Beispiel, als ich nach dem Brand auf die Terrasse gegangen bin.“
Das nächste Schweigen dauerte noch länger.
„Hallo?“
Nichts.
„Hallo?“
„Ich sagte, wenn das nach dem Brand war, kann es nicht der Tote gewesen sein, der bei dir über den Zaun gestiegen ist“, hörte er endlich wieder Gesslers Stimme.
„Diese Erkenntnis hatte ich auch schon. Also hat jemand erst das Institut in Brand gesteckt“, fuhr Alexander fort, „und dann eine tote Ratte vor meiner Haustür abgelegt. In diesem Augenblick bin ich nach Hause gekommen. Deswegen die Flucht über den Zaun.“
„So könnte es gewesen sein.“ Die Skepsis in Jörgs Stimme war trotz der schlechten Verbindung unüberhörbar. „Auf alle Fälle schicke ich dir meine Kollegen vorbei.“
„Nein!“ Er sprach schon wieder viel zu laut. Dieses Mal war nicht die schlechte Verbindung schuld daran, dass er so schrie. „Ich will die Kripo nicht in meinem Garten! Auf gar keinen Fall!“ Er versuchte seine Stimme zu dämpfen. Mit mäßigem Erfolg. „Es reicht schon, dass sich irgendjemand Fremdes dort herumgetrieben hat!“
„Die Kripo in deinem Garten dürfte wohl das kleinere Übel sein im Vergleich zu dem, was dir sonst noch zustoßen könnte.“
Jetzt war es Alexander, der lange schwieg.
„Wann kommen die?“, fragte er mit matter Stimme.
„Ich sage den Kollegen, dass sie sich vorher anmelden sollen.“
Alexander blieb mit dem Hörer in der Hand tatenlos sitzen, als Gessler längst aufgelegt hatte, als wären seine Bewegungen mitten im Ablauf stecken geblieben. Seine Gedanken ebenfalls. Er erwachte erst wieder aus der Erstarrung, als sein Blick auf das Blinken des Anrufbeantworters fiel, doch er konnte sich nicht entschließen, die alten Nachrichten abzuhören. Ereignisse vor dem Brand gehörten einer fernen Vergangenheit an.
Er würde sein Leben einteilen in die Zeit vor dem Brand und die danach, beschloss er. Wenn nicht noch Schlimmeres geschah, was sein normales Leben für immer unterbrechen würde. Er seufzte und begann die neuesten Nachrichten abzuhören. Ein Anruf am heutigen Vormittag kam von der Verwaltung des Zentralfriedhofs in Karlsruhe, eine jugendlich klingende Dame bat um Rückruf. Wahrscheinlich ging es um die Verlängerung der Pflege von Ingrids Grab. Wenigstens die war er seiner verstorbenen Frau schuldig, wenn auch die letzten Jahre ihrer Ehe wenig erfreulich verlaufen waren.
Eine andere Nachricht kam vom Kaufhaus Saturn. Sein Netbook sei seit drei Wochen von der Reparatur zurück. Möglicherweise habe er die erste Benachrichtigung nicht erhalten. Er hatte sie erhalten, aber vergessen, weil er doch wieder seinen Laptop auf Reisen mitnahm. Die Mickymaus-Tastatur des Netbooks war nichts für seine großen Hände.
Am nächsten Morgen wählte er von zu Hause die Friedhofsnummer, das verschaffte ihm Zeit, bis er sich dem niederschmetternden Anblick des zerstörten Instituts ausliefern musste. Die junge Dame vom Anrufbeantworter meldete sich – nett, wirklich angenehm – und verband ihn weiter. Auch der Mann am Apparat war nicht unfreundlich, nur ernst, todernst sogar, was nicht allein seinem Tätigkeitsfeld zuzuschreiben war.
Der tragische Unterton galt Ingrids Grab. Es war verwüstet worden. Irgendwann in der Nacht von Sonntag auf Montag war jemand mit brutaler Gewalt über den Grabstein hergefallen, was diesen nicht nur die Standfestigkeit gekostet, sondern ihn darüber hinaus in zwei Teile zerlegt hatte. Der nächste Satz ließ Alexander zusammenfahren, als wäre neben ihm eine Bombe detoniert. „Stop killing animals“, hatte jemand mit roter Farbe auf den Grabstein geschmiert.
„Wir haben bereits Anzeige gegen unbekannt erstattet. Die Polizei wird sich deswegen noch mit Ihnen in Verbindung setzen.“
Alexander brachte noch immer keinen Ton heraus.
„Kommen Sie her, um sich den Schaden anzusehen?“
„Ich weiß es noch nicht. Ich melde mich später noch einmal“, hörte er eine dünne, bebende Greisenstimme sagen, die ihm gehören musste. Dann legte er den Hörer auf.
Seine Hände und Knie zitterten. Er konnte sich nicht erinnern, beim Anblick des brennenden Instituts gezittert zu haben. Das Entsetzen hatte unterschiedliche Gesichter.
Kein Drohbrief, wie Jörg erwartet hatte, sondern eine unmissverständliche Botschaft hatte der Täter hinterlassen. Nicht Gentechnikgegner, sondern militante Tierschützer waren die Urheber der Anschläge. Oder ging es um beides? Tierschützer, die eine tote Ratte ablegten? Und warum traf es ihn? Etwa wegen seiner Knock-out-Mäuse, wegen dieser lächerlich geringen Zahl von Versuchstieren, die er auf dem Gewissen hatte und über die er sich unlängst in einem Interview in der Badischen Zeitung geäußert hatte? Kein Vergleich mit Huntingdon Life Sciences, Europas größtem Tierlabor, an dessen Kunden und Mitarbeitern sich die militanten Tierschützer immer wieder ausgetobt hatten. Zwölftausend Hunde, Affen, Mäuse und andere Tiere sollte HLS allein für eine Studie über Splenda – einen neuen Süßstoff – gequält und getötet haben. Aber richteten sich die Aktionen nicht auch gegen ganz andere? Irgendwo im Norden von Deutschland war kürzlich eine Hähnchenmastanlage abgefackelt worden, kurz bevor sie in Betrieb gehen sollte, Schlachtbetriebe waren gestürmt worden, Metzger bedroht. Und jetzt er als Zielscheibe!
Etwas anderes war noch unbegreiflicher, und bei diesem Gedanken kroch ihm eine Gänsehaut über den Nacken und bis zu den Haarwurzeln: Woher wusste der Täter vom Grab seiner Frau? Ingrids Todessturz vom Turm der Zähringer Burg hatte Aufsehen erregt, aber kaum jemand hier hatte die Beerdigung in Karlsruhe zur Kenntnis genommen, und er war der Einzige, der von Freiburg zur Beisetzung gefahren war. Er hatte sich längst von Ingrid getrennt, als sie starb. War jemand aus Ingrids Umkreis der Täter? Er verwarf den Gedanken sofort wieder. Ingrid war seit Jahren tot, und nie hatte jemand aus Karlsruhe zu ihm Kontakt aufgenommen. Nur wenige Freiburger wussten von dem Grab auf dem Karlsruher Zentralfriedhof: Ina natürlich, Jörg Gessler, Frau Brändle. Und sonst?
Mit dem miserablen Gefühl, sich unabwendbar in den Klauen einer unbekannten bösen Macht zu befinden, schlich er wenig später zum Institut. Erst auf der Treppe fiel ihm ein, dass er von nun an in einem Raum hauste, für den die Bezeichnung Kämmerchen noch schmeichelhaft war, und Frau Brändle auf dem Flur davor.
Dort, wo er seine Sekretärin vermutet hatte, war niemand, aber ihr Arbeitsplatz hatte sich auf bemerkenswerte Weise verändert. Unter dem Schreibtisch stand ein Dinosaurier von Computer, sowohl was das Aussehen als auch was den Geräuschpegel des Lüfters betraf, auf dem Tisch hingegen ein moderner Flachbildschirm. Als Bildschirmschoner entließ der aus besseren Zeiten vertraute Toaster eine goldbraun geröstete Brotscheibe nach der anderen. Vermutlich hatte sie in ihrer Tüchtigkeit ihre gesamte Software im Rechenzentrum gespeichert und auf diese Weise nicht nur ihren Bildschirmschoner gerettet.
Er fand Frau Brändle in seinem eigenen Kämmerchen. Ihr Gesicht, als sie ihn begrüßte, zeugte von ihrer gewohnten Geschäftigkeit. Neben ihr stand ein Mann. So abgeklärt, wie er aussah, musste es ein Techniker vor einer überschaubaren Aufgabe sein. Offenbar schickte er sich an, auch für ihn einen Computer und einen Internetanschluss zu installieren.
Es fiel ihm schwer, seine Sekretärin unbefangen zu begrüßen. Er bekam das Bild nicht weg, wie sie eng umschlungen mit dem Bärtigen auf der Straße gestanden hatte.
„Das Grab meiner Frau wurde verwüstet“, sagte er, als der Techniker den Raum verlassen hatte. Es lag ihm nichts daran, seine Sekretärin zu schockieren, er musste nur diese Szene von gestern Abend aus seinem Kopf vertreiben.
Sie sah ihn ratlos an.
„Das Grab in Karlsruhe. Der Grabstein wurde umgestürzt und zerstört.“
Frau Brändle sagte nichts, aber sie wurde kreideweiß. Nicht plötzlich, sondern fast wie in Zeitlupe. So hatte er sie noch nie gesehen: als ob ihr der Leibhaftige begegnet wäre.
„Ist Ihnen nicht gut? Frau Brändle!“
„Mein Gott, wie furchtbar“, sagte sie und sah aus, als blicke sie direkt in die Hölle. „Mein Gott“, wiederholte sie. Dann merkte sie, dass der Techniker zurückgekehrt war, und auch ihr Blick kehrte allmählich ins Diesseits zurück. „Mein Gott“, sagte sie ein drittes Mal.
Eine so heftige Erschütterung hatte Alexander nicht erwartet, völlig unangemessen war sie in seinen Augen, und er suchte vergeblich nach einer Erklärung.
„Wohin soll der Anschluss?“, fragte der Techniker, und jetzt, wo es etwas zu regeln gab, tauchte seine Sekretärin aus dem Schrecken auf wie aus einem Albtraum.
„Aber es wird doch kein Zusammenhang zu dem Feuer bestehen“, sagte sie später, als der Techniker endgültig fort war.
„Ich hoffe, nicht“, antwortete er, obwohl er nicht den geringsten Zweifel daran hatte.
Frau Brändle sagte nichts mehr, fragte auch nichts. Sie machte sich an seinem Schreibtisch zu schaffen, sie rückte die Tastatur ein wenig zur Seite, schob das Telefon an einen anderen Platz, schob es wieder zurück, bis sie ihn unvermittelt und wortlos verließ.
Er startete den Computer und rief die E-Mails auf. Dreiundzwanzig neue, nicht sehr viel nach seiner mehrtägigen Abwesenheit. Frau Brändle hatte die unwichtigen offenbar schon aussortiert. Jetzt kam es ihm vor, als habe er schon immer in dem Kämmerchen gehaust, denn mit einem Internetzugang sah die Welt überall gleich aus. Er schloss das Programm wieder.
Die Vorfälle der vergangenen Tage ließen ihn nicht los. Warum gab es drei Anschläge in einer Nacht? Warum jetzt? Warum dieser massive Angriff? Hing es doch mit dem Interview in der Badischen Zeitung zusammen, in dem er sich über seine Versuche mit Knock-out-Mäusen ausgelassen hatte? Seine Äußerungen zum Anlass für die Anschläge zu nehmen wäre aber doch lächerlich! Oder ging es gar nicht um ihn persönlich, sondern um ihn als Chef eines Instituts, in dem gentechnisch veränderte Tiere lebten und starben? Kämpften die Tierschützer jetzt auch für das Wohlergehen von Fadenwürmern und Zebrafischen? Allmählich ahnte er, was die Attentäter antreiben konnte: die Kombination von Tierschutz und Ablehnung von Gentechnik jeder Art.
Aber eine andere Frage stellte sich: Warum war seine Sekretärin so erschüttert über das verwüstete Grab? Hatte sie in diesem Augenblick begriffen, dass es die Täter auf ihn abgesehen hatten? Von der toten Ratte wusste sie ja nichts und auch nicht von den Schmierereien auf dem Grab.
Das Telefon klingelte, was ihn wunderte. Er hatte gehofft, nicht so schnell wieder erreichbar zu sein. Jörg war am Apparat: „Heute um dreizehn Uhr, passt dir das?“
Alexander brauchte eine Weile, bis er begriff, dass zu diesem Zeitpunkt die Kripo zu ihm nach Hause kommen sollte. Es passt nie, dachte er. „Ja“, sagte er, „wenn es nicht so lange dauert.“
„Gibt es etwas Neues?“
Alexander schwieg.
„Was ist passiert?“, hakte Gessler nach.
Alexander schwieg immer noch.
„Hat sich der Rattenmörder bei dir gemeldet?“
„Nicht bei mir, sondern bei Ingrid“, antwortete er zögernd.
Gessler wusste sofort, wen er meinte. Er selbst hätte vermutlich länger gebraucht. „Im Jenseits?“, fragte Gessler.
Alexander erzählte vom verwüsteten Grab und der Schmiererei auf dem Grabstein.
„Stop killing animals“, wiederholte Gessler. „Daher weht also der Wind. Haben dich die Tierschützer ins Visier genommen?“
„Die Friedhofsverwaltung hat die Polizei schon benachrichtigt.“
„Dann werde ich dafür sorgen, dass die Kollegen erfahren, was hier in Freiburg abgeht.“
Als Alexander um zehn nach eins nach Hause kam, machten sich zwei Gestalten in seinem Garten zu schaffen: keine Eindringlinge mit finsteren Absichten, sondern die Beamten, die Jörg angekündigt hatte. Sie forderten ihn auf, den Garten vorerst nicht zu betreten, und Alexander zog sich auf die Terrasse zurück, von wo aus er das Treiben beobachtete. Er fragte sich, warum er für diese Aktion überhaupt nach Hause gekommen war. Die Herren kamen auch ohne ihn aus.
Nein, offenbar doch nicht. Einer der beiden näherte sich der Terrasse. Er wollte wissen, ob sich nach dem Gewitter am Abend des Brandes eine Frau im hinteren Teil des Gartens aufgehalten habe, denn sie hätten dort Schuhabdrücke entdeckt, deren Größe und Art darauf schließen lassen würden.
Alexander wusste sofort, wer in seinem Garten gewesen sein musste: natürlich das Mädchen mit dem langen Rock und dem blauen Tuch um den Schultern. Er hatte sie sofort verdächtigt, als sie gestern an der Gartenmauer lehnte und in seinen Garten starrte. Trotz des schummrigen Lichts bei ihrer Begegnung konnte er ihre Kleidung einigermaßen genau beschreiben. Der Beamte notierte alles ohne die geringste Regung. Zu Alexanders Enttäuschung teilte er nicht seine Zuversicht, mit dieser Frau die Schuldige gefunden zu haben.
Als die beiden Polizisten gegangen waren, setzte er sich auf die Terrasse. Fünfzig Meter von ihm entfernt wurde ein Parkplatz neu gepflastert. Er war sich nicht sicher, was schlimmer war: das Kreischen der Steinschneidemaschine, das völlig regellos von Zeit zu Zeit ertönte und jeden klaren Gedanken auslöschte, oder der fast unaufhörliche Lärm der Rüttelmaschine. Bald hatte er das Gefühl, in einen lärmenden Sandstrahl geraten zu sein, der allmählich alle Schutzschichten seines Bewusstseins abtrug. Noch fünf Minuten, und er würde schreien.
Der Klügere gibt nach, dachte er schließlich und ging nach vier Minuten ins Haus.
Gegen vierzehn Uhrwar Alexander wieder im Institut. Mittlerweile war er fest davon überzeugt, dass diese Frau die Brandstifterin gewesen war. Ob sie verantwortlich für alle Ereignisse der letzten Tage war? Erst in Karlsruhe gewütet, dann den Brand gelegt und anschließend seine Haustür mit einer toten Ratte garniert? Nein, mindestens zwei Täter mussten beteiligt gewesen sein. Um einen Grabstein umzustürzen, war sie zu schmächtig.
Er hastete in sein Kämmerchen, kickte die Tür mit dem Fuß zu, stürzte zum Telefon und wählte Jörgs Nummer.
„Bei mir im Garten war eine Frau.“
„Das wundert mich nicht.“
„Am Zaun nach dem Gewitter in der Brandnacht, als ich die Ratte gefunden habe. Ina kann es nicht gewesen sein. Außerdem steigt sie nicht über den Zaun in den Nachbargarten.“
„Du hast doch diesen attraktiven Arzt als Nachbarn.“
Einen Augenblick war Alexander irritiert. „Blödsinn!“
„Okay, okay. Ina hat mit den Spuren nichts zu tun.“
„Wahrscheinlich habe ich diese Frau gestern gesehen.“ Alexander erzählte von der Frau mit dem langen Rock.
„Vielleicht hat tatsächlich diese Frau die Ratte vor deiner Tür abgelegt und dann den Garten über den Zaun verlassen.“
„Vorausgesetzt, die Ratte lag nicht schon seit Tagen dort“, gab Alexander selbst zu bedenken.
„Wäre das möglich?“
Eine Wohltat, diese Festnetzverbindung, dachte Alexander. Telefonieren mit dem Luxus des vergangenen Jahrtausends. „Ich war verreist, und die Putzfrau war in der Zwischenzeit nicht da.“
„Und der Briefträger?“
„Sonntags kommt kein Briefträger, und wahrscheinlich hätte er sich auch nicht um eine tote Ratte gekümmert.“
„Kann man die Stelle, wo die Ratte lag, von der Straße aus sehen?“
„Kaum, man müsste schon sehr genau hinschauen.“
„Wo ist die Ratte jetzt?“
„Auf der Müllkippe. Heute Vormittag war die Müllabfuhr da.“
„Warte mal“, sagte Gessler, und im nächsten Augenblick klickte es in der Leitung, dann geschah gar nichts mehr. Und nun? Warten oder Auflegen? Alexander entschied sich für Auflegen. Minuten vergingen. Er wählte noch einmal Jörgs Nummer. Jetzt war besetzt. Wieder einmal ärgerte er sich über das Telefon.
Drei Sekunden später klingelte es.
„Fehlanzeige“, sagte Gessler.
„Was meinst du?“
„Bei Ingrids Grab konnten die Kollegen keine verwertbaren Spuren sichern. Wenn es überhaupt Spuren gab, sind sie im Regen davongeschwommen.“
„Also wurde das Grab vor dem Gewitter verwüstet.“
„Auch das ist nicht sicher. In Karlsruhe hat es die ganze Nacht geregnet.“
Wieder Fehlanzeige. Alexander verabschiedete sich und legte auf. Er war enttäuscht, und zwar von Jörg, und es gelang ihm nicht, den Ärger dahin zu tun, wohin er gehörte: zur Sache selbst.
In diesem Moment fiel sein Blick auf einen Zeitungsartikel auf seinem Schreibtisch. Frau Brändle versorgte ihn mal wieder mit Informationen, die er gar nicht hatte lesen wollen. Doch jetzt konnte er nicht widerstehen:
Hoher Sachschaden entstand bei einem Brand, der am Sonntagabend im Institut für Molekulare Genetik der Freiburger Universität ausgebrochen war. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandes arbeitete niemand in dem Gebäude. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, schlugen die Flammen aus mehreren Fenstern im zweiten Obergeschoss und dem Dach eines Seitenflügels der Gründerzeitvilla. Ein Übergreifen auf das Haupthaus konnte verhindert werden. Vom Feuer direkt betroffen waren lediglich Verwaltungsräume. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen, die Kripo ermittelt.
Eine Routinemeldung, wie er sie schon oft in der Zeitung gelesen hatte. Verletzt worden war niemand. Er hätte ohne Beunruhigung weitergeblättert, ohne Mitleid mit den Betroffenen. Ja, wenn es denn eine Familie gewesen wäre, die ihre Bleibe durch ein Feuer verloren hätte. Aber Verwaltungsräume! Eine Meldung, die er rasch vergessen hätte – wenn sie nicht ihn selbst betroffen hätte. Von dem Toten schien die Presse noch nichts erfahren zu haben.
Er hatte gedacht, in dem abgelegenen Kämmerchen in Ruhe arbeiten zu können, doch er hatte sich geirrt. Ganze Menschenmassen strömten zu ihm in die hintere Ecke des zweiten Stockwerks und wollten ihn sprechen. Früher hatte Frau Brändle streng über seine Termine gewacht, jetzt war er Freiwild für seine Mitarbeiter. Und während er sich bemühte, Ersatz für Räume, Geräte und was sonst noch fehlte zu finden, kam irgendjemand und behauptete, jetzt zu dieser Minute einen seit Wochen vereinbarten Gesprächstermin zu haben. Frau Brändle habe den in ihrem Kalender notiert, der nun leider nicht mehr vorhanden sei. Alle brauchten sie ihn!
Ganz allmählich begann Alexander Gefallen an der Situation zu finden. Er konnte seinen heimatlos gewordenen Mitarbeitern helfen, Ina sei Dank! Schon am nächsten Abend nach dem Brand, als er noch trauern wollte, hatte sie gewusst, was nun zu tun sei. Also telefonierte er, rief Internetseiten mit gebrauchten Geräten auf, versammelte die Arbeitsgruppenleiter in der Bibliothek, ging mit ihnen durch das Gebäude. Ina hatte recht gehabt: Der Brand eröffnete ihm gänzlich neue Möglichkeiten. Endlich hatte auch er Gelegenheit, tüchtig zu sein. Wenn ihn Ina so sehen könnte! Oder Jörg! Oder sonst jemand, der immer noch an seinen besonderen Fähigkeiten zweifelte!
Da klopfte es an der Tür, die sich im nächsten Augenblick öffnete. Neben Frau Brändles Gesicht, das heute wieder todunglücklich aussah, erschien ein zweites: das von Jörg.
Frau Brändle verschwand, und Gessler trat ein. „Darf ich stören?“
„Bitte“, sagte Alexander und ließ den Freund Zeuge werden, wie er schon am zweiten Tag nach dem Brand per Telefon zwei gebrauchte Kühlschränke ins Obergeschoss des Nordflügels dirigierte.
„Ich dachte, für so niedere Tätigkeiten hättest du deine Sekretärin.“
Alexander schwieg. Diesen Kommentar hatte er nicht erwartet.
„Oder hat sie den Schock noch nicht überwunden?“
„So ist es.“ Frau Brändles Starre, ihr Entsetzen über die Grabschändung, ihr verzweifeltes Gesicht in der offenen Tür. Nein. Nichts hatte sie überwunden. „Was führt dich zu mir?“
„Es war tatsächlich ein Mann, wie du schon vermutet hast.“
„Der Tote?“
Jörg nickte. „Offenbar hatte er sich dort oben häuslich eingerichtet.“
„Häuslich eingerichtet?“ Alexander wiederholte die Worte, als müsste er etwas Ekelerregendes in den Mund nehmen.
„Unsere Leute haben auf dem Dachboden Geschirr, einen kleinen Campingkocher mit einer glücklicherweise leeren Gaskartusche und die Überreste einer Campingtoilette gefunden. Möglicherweise hat der Mann seit Wochen oder zumindest seit Tagen dort gehaust.“
„Campingkocher!“ Alexander strich sofort den angewiderten Unterton aus seiner Stimme und schaltete um auf Begeisterung. „Also doch keine absichtliche Brandstiftung!“
„Das wäre dir lieber, nicht wahr?“
„Ein Campingkocher auf dem Dachboden! Da muss es doch brennen!“
„Aber die Benzinkanister oben im Treppenhaus und in Frau Brändles Zimmer? Du musst dich wohl mit den Tatsachen abfinden. Wir haben übrigens noch keinen Hinweis, wer den Mann dort oben versorgt haben könnte und ihm den Zugang verschafft hat.“
Alexander hörte kaum noch hin. Ein Campingkocher auf dem Dachboden. Hätte ihm der Kommissar die Chance auf eine weniger niederschmetternde Brandursache als eine Brandstiftung nicht ein wenig länger gönnen können?
„Noch etwas.“ Jörg zog die Augenbrauen hoch. „Der Tote hatte einen Schlüssel.“ Er machte eine Pause, aber Alexander fragte nicht nach. Er hatte einfach keine Lust auf weitere Neuigkeiten. Gute waren nicht zu erwarten.
„Einen Schlüssel für die Eingangstür des Instituts“, fuhr Gessler fort.
Alexander sagte noch immer nichts. Er versuchte im Geiste zu zählen, wie viele Mitarbeiter einen Schlüssel haben konnten. Bei fünfundzwanzig gab er auf. Von solchen organisatorischen Dingen hatte er nun mal keine Ahnung. Immerhin wusste er aus eigener Erfahrung, dass man nicht einfach zur Schlüsselzentrale gehen konnte, um einen Nachschlüssel für das Institut zu besorgen.
„Dann müsste der Tote leicht zu identifizieren sein“, sagte er. „Entweder es fehlt jemand, der einen Schlüssel bekommen hat, oder jemand hat seinen Schlüssel nicht mehr, weil er ihn dem Mann vom Dachboden gegeben hat.“
„Schön, wenn es so einfach wäre, aber eine vollständige Liste der Schlüsselbesitzer gibt es nicht.“
„Frau Brändle hat von allen wichtigen Dateien Sicherungskopien im Rechenzentrum angelegt“, widersprach er heftig.
„Die Schlüsselliste gab es nur in Papierform.“
Glaube ich nicht, dachte er. Nicht bei Frau Brändle!
„Sie versucht gerade, sich zu erinnern.“
„Und?“
„Das Ergebnis ist ungewiss.“
Alexander atmete tief ein, atmete tief aus. Den Tatsachen ins Auge blicken! „Sah sie deswegen eben so unglücklich aus?“
„Das tat sie schon, als ich kam.“
„Jörg?“
„Ja?“
„Warum hat sich der Mann nicht gerettet, wenn er offenbar selbstständig ein und aus gehen konnte?“
„Er hatte keine Chance. Vielleicht hat er versucht, die Klappe von oben zu öffnen. Ohne das Feuer hätte er es jedenfalls gekonnt. An der untersten Stufe der ausklappbaren Treppe war ein Drahtseil befestigt, so eines, wie man es auf Segelbooten benutzt. Damit konnte der untere Teil nach dem Ausklappen wieder nach oben gezogen werden. Aber es lag ein Benzinkanister direkt unter der Klappe. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn du dann die Klappe öffnest? Da kannst du gleich ins Fegefeuer springen.“
Als Jörg gegangen war, hatte sich Alexanders Stimmung wieder einmal dem absoluten Nullpunkt genähert. Gerade noch hatte er sich selbst mit seinem Elan übertroffen, jetzt blieb er wie ein flügellahmer Vogel zurück. Das Bild des hilflosen Mannes auf dem brennenden Dachboden ließ ihn nicht los. Er zwang sich, nicht an den Toten, sondern an die Schlüsselliste zu denken. Vielleicht gab es doch noch irgendwo elektronisch gespeichert die Namen derer, die einen Schlüssel bekommen hatten! Im nächsten Augenblick versank er wieder in Lethargie. Wenn seine Sekretärin die Liste nicht mehr hatte, gab es keine.
Er quälte sich durch den Rest des Arbeitstages. Keine Erfolge mehr. Jeder Versuch, noch einem der abgebrannten Mitarbeiter in den ohnehin überfüllten Laborräumen einen Platz zu verschaffen, scheiterte. Gegen siebzehn Uhr gab er die Hoffnung auf, für die restlichen zwei Doktoranden und eine Postdoc mehr als Stehplätze ohne Computer und sonstige Geräte zu finden. Er vertröstete sie auf den folgenden Tag und versperrte die Tür seines Kämmerchens sorgfältig mit dem neu angebrachten Schloss, dann suchte er Frau Brändle, um sich wenigstens heute angemessen zu verabschieden. Ihr in Leid erstarrtes Gesicht in der Tür, ihr wortloser Rückzug beunruhigten ihn. Ob sie zu allem Überfluss Ärger hatte mit ihrem Zukünftigen?
Er trat hinter den Wandschirm, der den Arbeitsplatz seiner Sekretärin verbarg, aber da war niemand. Allerdings sah der Schreibtisch nicht so aus, als wäre sie schon fort. Der Computer lief, und der Toaster auf dem Bildschirm entließ die beneidenswert gleichmäßig gebräunten Scheiben. Eine Weile wartete er vergeblich. Frau Brändle dürfe sich nie ohne Handy im Institut bewegen, hatte er einmal vorgeschlagen. Doch wie so oft hatte er sich mit einer guten, wenn auch ungewöhnlichen Idee nicht durchsetzen können. Sie selbst hatte die Anschaffung des Handys sofort blockiert. Wenn er sich deswegen wieder nicht verabschieden konnte, war es ihre eigene Schuld!
An der Tür zum Treppenhaus glaubte er hinter sich Geräusche zu hören. Er drehte sich um und sah am anderen Ende des langen Flures einen jungen Mann stehen, den er nicht kannte. Er musste hinter Frau Brändles Wandschirm hervorgekommen sein. Alexander konnte sich nicht erklären, wieso er ihn nicht gesehen hatte, als er selbst nach Frau Brändle suchte. Vielleicht hatte er in einer Türnische in der Nähe des Schreibtischs gestanden. Ob er sich womöglich versteckt hatte?
Alexander kehrte um. „Suchen Sie etwas?“
„Das Sekretariat.“
Der Mann war untersetzt, und sein Kopf war zu groß für die übrige Länge seines Körpers. Die abstehenden lockigen Haare verstärkten noch das Unproportionierte der Erscheinung, ebenso wie die zu große Nase, die leicht aus den Höhlen tretenden Augen und das vorspringende Kinn, welches der klägliche blonde Vollbart noch betonte. Er trug eine dreiviertellange Hose, und über den ausgetretenen Turnschuhen hatte er den linken Unterschenkel mit einem blauen Verband umwickelt. Trotz der ungewöhnlichen Erscheinung hätte er Student sein können – wenn die offensichtliche Angst nicht gewesen wäre.
Alexander musterte den Kleinwüchsigen, der ihm nicht einmal bis zur Schulter reichte. Wie ein Hase, dachte er, wie der Hase, den Corinna für ein paar Wochen versorgt hatte. Genauso hatte der ihn angesehen, wenn er aus seinem Käfig entkommen war und dann, in einer Zimmerecke in die Enge getrieben, seinem Häscher ins Auge sah. Alexander stand jetzt so dicht vor dem jungen Mann, dass er, wenn er den Hasen vor sich gehabt hätte, zugegriffen hätte.
„Und worum geht es bitte?“
Der Kleine mit dem zu großen Kopf kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen, dann die Lippen. Er machte ein Gesicht, als wäre die Frage ein unsittliches Angebot. Oder eine Ohrfeige.
„Worum geht es?“, fragte Alexander noch einmal, ohne das „bitte“ zu wiederholen.
Der Mann sah ihn nicht an. Sein Blick tastete sich den Flur entlang, als suche er etwas. Eine Möglichkeit zur Flucht vielleicht. Alexander stellte sich ihm in den Weg. Jetzt hätte der ihn zur Seite stoßen müssen, um zu entkommen.
„Ich bin mit Frau Brändle verabredet.“
„Hier ist das Sekretariat, aber wie Sie sehen, ist Frau Brändle nicht anwesend.“
Der junge Mann trat einen Schritt zur Seite. „Wann kommt sie wieder?“
Alexander trat zur selben Seite. „Ich weiß es nicht.“ Er hatte endlich aus diesem Folterinstitut verschwinden wollen, aber jetzt nagelte ihn der Eindringling fest.
„Ich werde hier warten“, teilte der Mann mit.
Alexander schüttelte den Kopf. Natürlich würde er den Kerl nicht hier warten lassen. Es gab keinen Raum, wo er ihn sicher hätte abstellen können. Den nicht! Wenn sich einer schon so duckte und dabei die Augen zusammenkniff! Und dieser Mensch, der sich eben noch im Schutz des Wandschirms verborgen hatte, gab vor, eine Verabredung mit Frau Brändle zu haben! Man muss zuversichtlich aussehen, wenn man etwas erreichen will, dachte er, außerdem arglos, mit großen Kinderaugen, dann bekommt man, was man möchte.
„Tut mir leid“, sagte er, „aber hier können Sie nicht warten.“
Doch der junge Mann blieb einfach stehen. So leicht würde Alexander den offenbar nicht loswerden.
„Haben Sie ein Handy?“, fragte er.
„Wieso?“
„Also haben Sie eins.“
Der junge Mann nickte. Alexander verbuchte dies als ersten kleinen Erfolg.
„Ich lege meiner Sekretärin einen Zettel mit Ihrer Nummer hin. Sie soll Sie anrufen, sobald sie hierher zurückkehrt.“
Jetzt suchte er etwas zum Schreiben – und fand es auch. Da lagen sie tatsächlich schon, die sorgfältig geschnittenen Zettel, zu denen Frau Brändle seit Jahren das Altpapier verarbeitete – und das am zweiten Tag nach dem Brand.
„Wie heißen Sie bitte?“
Der junge Mann sah ihn unsicher an. Als hätte er seinen Namen vergessen.
„Jeff“, sagte er.
Alexander wartete, ob er noch mehr sagen würde. Er tat es nicht.
„Und Ihre Handynummer?“
Der Mann zögerte. „Vergessen Sie es“, sagte er dann.
Schneller, als sich Alexander vom Schreibtisch lösen konnte, war der Mann fort. Sein Abgang war eine Flucht. Alexander sah ihm nach, ohne etwas zu unternehmen, und durchaus erleichtert. Was hätte er auch mit ihm anstellen sollen, wenn er ihn festgehalten hätte? Der Polizei übergeben? Weil er einen Termin bei Frau Brändle hatte?
Sein Blick fiel auf den Bildschirm. Jetzt flogen keine Toaste mehr, stattdessen sah er die Startseite des CommuniGate-Systems der Universität mit der Aufforderung, ein Passwort einzugeben. Der Mann musste sich am Computer zu schaffen gemacht haben. Das Mindeste war eine Bewegung mit der Maus, durch die der Toaster verschwunden war. Wenn der Kleinwüchsige mehr versucht hatte, so war er an der Eingabe des Passwortes gescheitert. Alexander versuchte die Schreibtischschubladen zu öffnen: Alle waren verschlossen. Die Schreibtischplatte war leer bis auf das Telefon, die Tastatur und den Bildschirm.
Was auch immer der Mann hier gewollt hatte, erfolgreich war er nicht gewesen. Sahen so die militanten Tierschützer aus? Alexander hatte sie als Teil der autonomen Szene vermutet, aber wie sahen deren Mitglieder aus, wenn sie sich nicht für eine Demo dunkel kleideten und sich mit Halstüchern vermummten? Man müsste jemanden in die Szene der radikalen Tierschützer einschleusen, dachte er. Nur wie und vor allem wen? Ina, die nur zähneknirschend den Hasen von Corinnas Freundin für ein paar Wochen in ihrer Wohnung geduldet hatte, schied von vornherein aus. Ihre Abneigung gegen alles, was Haare verlor, untergrub jedes Engagement für den Tierschutz.
Vielleicht käme ja Frau Brändle infrage? Er beschloss, auf sie zu warten, um sie wenigstens nach der Verabredung mit dem jungen Mann zu fragen.
Seine Sekretärin erschien nach fünf Minuten. Sie kam von der Toilette mit rotem Gesicht, verschwollenen Augen und verräterischen Puderflöckchen auf der Nase, auf diese Weise nur notdürftig nach einem Tränenausbruch wiederhergerichtet. Hatte sie etwa wegen der verlorenen Liste geweint? Sie blieb mit einem heftigen Ruck neben dem Wandschirm stehen. Ihn hatte sie offenbar nicht hier erwartet, wahrscheinlich hatte sie niemanden erwartet.
„Ein junger Mann hat nach Ihnen gefragt. Er hat gesagt, er sei mit Ihnen verabredet.“
Frau Brändles Gesicht wurde ein einziges Fragezeichen.
„Er hat gesagt, er heiße Jeff.“
Ihr Gesicht wurde noch ratloser.
„Großer Kopf, offener Mund“, ergänzte er.
Immer noch keine Antwort.
„Vielleicht hat er den Namen in diesem Augenblick erfunden“, sagte Alexander.
Das Gesicht seiner Sekretärin entspannte sich ein wenig. „Wie sah er aus?“
Er beschrieb den jungen Mann, eine Verwechslung wäre kaum möglich gewesen.
Frau Brändles Augen verharrten nun in einem leblosen Tunnelblick, den er nicht deuten konnte. „Kommt er wieder?“
„Ich weiß nicht. ›Vergessen Sie es‹, hat er gesagt, als ich ihn nach seiner Handynummer gefragt habe.“
„Vergessen Sie es“, wiederholte sie. Ihr Gesicht zeigte wieder die Leidensmiene, mit der sie von der Toilette gekommen war.
„Man müsste eine Zwischenwand einziehen lassen“, sagte er. Irgendetwas musste er jetzt gegen dieses leidende Gesicht tun.
„Eine Zwischenwand?“ Sie putzte sich geräuschlos die Nase, wie es ihre Art war. Keine Puderflöckchen mehr.
„Ja, damit das Sekretariat hinter einer verschließbaren Tür liegt. Vielleicht würde schon die Attrappe einer Wand reichen.“
Sie sah wieder ganz ratlos aus.
„Eine Wand aus Pappe, mit einer Tür, die sich öffnen und verschließen lässt.“
„Rigips“, sagte sie. Ihr Ton dabei: als plante sie ein Grabmal oder ein Mausoleum für einen unerwartet Verstorbenen.
„Ja, Rigips“, sagte er, „eine Wand aus Rigips wäre das Richtige.“
Dann fragte er doch nach der Liste.
Sie schloss umständlich ein Schubfach auf und zog eine Liste heraus, deren erste Spalte die Namen der Schlüsselbesitzer enthielt. Der Platz daneben für die Daten von Schlüsselausgabe und -rückgabe war leer.
„Ist sie vollständig?“
„Es müssten noch mehr Namen sein“, gab sie zerknirscht zu.
„Sie sind sicher, dass Sie die alte Liste nicht doch gespeichert haben?“
Die Frage war ihr sichtlich unangenehm. „Leider bin ich sicher. Es gibt nur diese neue.“
Restlos unzufrieden mit sich selbst und so langsam wie möglich ging Alexander am Abend heim, dem Fernseher entgegen. Für eine sinnvolle Tätigkeit war er zu niedergeschlagen. Das Glücksgefühl über seine Tüchtigkeit am heutigen Vormittag war unwiderruflich dahin. Frau Brändles verheultes Gesicht hatte ihm den Rest gegeben, egal ob ihr schöner Inder oder die Ereignisse im Institut schuld daran waren.
Zu Hause blätterte er im Programmheft, ohne eine lohnende Sendung zu finden, da konnte er sich gleich seinem Schreibtisch zuwenden, dessen Tischplatte schon vor seiner Fahrt nach Dresden unter unerledigten Aufgaben verschwunden war. Jetzt türmte sich das Papier meterhoch, zumindest gefühlt.
Eine Viertelstunde später – er hatte gerade damit beginnen wollen, die unbezahlten Rechnungen abzuarbeiten – klingelte es an der Wohnungstür. Wie gut, dass hin und wieder die Klingel eine langweilige Tätigkeit unterbricht, dachte er und ging zur Tür.
Er gehörte nicht zu den Menschen, die vor dem Öffnen der Tür das Auge an den Spion pressen, um draußen einen Wasserkopfmenschen mit Miniaturbeinchen zu sehen. Wer sollte schon klingeln? Schlimmstenfalls jemand, der ihm einen Staubsauger oder das ewige Leben aufschwatzen wollte. Oder vielleicht die Rattenüberbringerin mit den blonden Haaren? Oder doch etwas Schlimmeres? Brandstifter? Mörder?
Er öffnete. Wieder einmal trat nicht die schlimmste Möglichkeit ein, sondern eine ganz andere Katastrophe. Vor der Tür standen Ina und Corinna. Ina hatte den Schlüssel zu seiner Wohnung vergessen und er, dass er heute zum ersten Mal in seinem Leben Pfannkuchen backen wollte. Er hatte sie Corinna zum achten Geburtstag versprochen, und der lag inzwischen schon Monate zurück.
Bevor er in der vergangenen Woche nach Dresden geflogen war, hatte er sich schon stundenlang mit den Pfannkuchen beschäftigt. Nicht, dass er selbst gerührt und gebacken hätte, nein, allein der Gedanke an Mehl, Eier, Milch und was er sonst noch brauchen würde, hatte ihn zeitweilig mehr beschäftigt als jede andere Frage. Mehl, Eier, Milch: allein daraus konnte man wohl kaum ein genießbares Essen zubereiten und schon gar keines, was Corinnas kritischem Urteil standhalten konnte – oder doch? Richtig, auch Salz würde er brauchen. Und vielleicht Zucker? Butter?
Bei Google hätte er sofort nachlesen können, was er wissen musste. Hatte er aber nicht gewollt. Wer schon eine solche Lappalie ergoogelt, denkt über gar nichts mehr nach. Die Menschheit hatte sich seit Jahrtausenden ohne Internet fortentwickelt. Durch Versuch und Irrtum hatte sie ihre größten Entdeckungen gemacht, nicht durch Nachlesen. Er war davon überzeugt, dass sich daran auch nicht so bald etwas ändern würde. Aber die Pfannkuchen?
Er hatte das Nachdenken ohne überzeugendes Ergebnis beendet und sein Geburtstagsgeschenk für Corinna wieder einmal vergessen. Und nun stand sie mit ihrer Mutter vor der Tür, um das Versprochene zu verspeisen.
Er schickte die beiden ins Wohnzimmer, die Pfannkuchen seien sofort fertig. Jetzt war keine Zeit mehr, sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, was er sich zu dem Thema schon überlegt hatte. Er würde das Problem auch so lösen. Immerhin konnte er Spiegeleier braten, und Pfannkuchen waren nichts anderes als mit Mehl und Milch verrührte Spiegeleier. Er stellte bereit, was er brauchen würde – er hatte sogar sechs Eier im Kühlschrank –, erhitzte etwas Margarine und schlug vier Eier in die Pfanne. Er fügte Milch hinzu, die zu seiner Überraschung im heißen Fett sofort schäumend kochte – und gleich darauf verschwunden war. Jetzt musste es schnell gehen. Er schüttete Mehl in die Pfanne, ohne es abzumessen. Dann rührte er – mit einem Holzlöffel, um das Teflon nicht zu zerkratzen, das hatte er schon vor Jahren gelernt. Seither hatte sich die Lebensdauer seiner Pfannen deutlich verlängert.
Das Ergebnis seines Rührens war niederschmetternd. Breiige Klumpen, groß wie Walnüsse. Mindestens. Da nützte alle Anstrengung nichts. Er änderte die Strategie und begann, die Klumpen in der Pfanne platt zu drücken. Tatsächlich entstand auf diese Weise etwas, was eine entfernte Ähnlichkeit mit einem Pfannkuchen hatte. Corinna steckte den Kopf durch die Tür. „Es riecht angebrannt.“
„So riechen Pfannkuchen immer.“
Er rettete die Pfanne und das, was nie und nimmer ein Pfannkuchen werden konnte, von der heißen Kochplatte.
Corinna kam näher und zog verächtlich die Oberlippe hoch. „Das soll ein Pfannkuchen sein?“ Sie schnupperte mit angewidertem Gesichtsausdruck.
„Kannst du bitte im Wohnzimmer warten?“ Sein Ton war barscher, als er es beabsichtigt hatte.
Corinna schüttelte den Kopf, dass ihre dunklen Locken flogen.
„Bitte!“, wiederholte er.
„Ich habe Hunger.“
„Deswegen lass mich jetzt allein.“
Corinna verzog sich.
Und nun? Was da schwarzbraun an der Pfanne klebte, konnte er wirklich niemandem anbieten. Er sank auf den Küchenschemel und haderte mit seinem Schicksal. Frauen hatten keine Ahnung von den Schwierigkeiten, mit denen Männer wie er, die man jahrzehntelang aus der Küche ferngehalten hatte, bei einer solchen Aufgabe zu kämpfen hatten. Frauen wurden schon im zarten Kindesalter auf derlei Tätigkeiten vorbereitet. Vielleicht hatten sie sogar einen angeborenen Vorteil, der dem Mann mit seiner angestammten Rolle als Jäger abging.
Er dachte eine Weile angestrengt nach, dann stand er auf und nahm eine Rührschüssel und die alte Pfanne aus dem Schrank, die er nur noch für Notfälle wie diesen aufbewahrte. Zwei Eier hatte er nur noch, und auch das Mehl ging zur Neige. Der Teig in der Rührschüssel war dünnflüssig, und Klumpen gab es reichlich, allerdings nur kleine. Er müsse das mit den Mengen nicht so wörtlich nehmen, hatte Ina einmal gesagt, als er den Zucker zum Süßen von Erdbeeren genau abgemessen hatte. Also bitte! Nach fünf Minuten sah der Teig beinahe so aus, wie er auszusehen hatte. Nur der Geschmack stimmte noch nicht. Richtig. Er hatte wie auch beim ersten Versuch das Salz vergessen. Eine Prise, hatte er in Erinnerung. Eine Prise, das hatte er von Ina gelernt, sei das, was man zwischen Daumen und Zeigefinger greifen könne, das Wort komme vom französischen „prendre“. Eine Prise reichte nicht. Der Teig schmeckte immer noch fade. Er nahm eine zweite, eine dritte. Dann war er zufrieden. Jetzt brauchte er den Pfannkuchen nur noch zu backen. Also wieder Fett erhitzen und jetzt den fertigen Teig dazu.
Das Zeug klebte in der alten Pfanne. Jeder Versuch, das an der Oberfläche flüssige Gebilde als Ganzes zu wenden, scheiterte. Der Pfannkuchen verwandelte sich in Fetzen. Egal, dachte er. Dann wurde aus dem Pfannkuchen eben Kratzete. Wahrscheinlich hatten die badischen Hausfrauen die Kratzete erfunden, um missglückte Pfannkuchen doch noch als gelungenes Werk ihrer Kochkunst auf den Tisch zu bringen. Als er endlich neben einer mäßig zufriedenen Corinna und einer still lächelnden Ina am Tisch saß, schmerzte sein Rücken.
Es war neun Uhr, als Corinna und Ina seine Wohnung verließen. Corinna lief sofort zu Inas Auto. Bibi Blocksberg oder irgendeine andere CD konnte keine Sekunde länger warten. Ina zog plötzlich an seinem Ärmel. Es war dieses besondere Ziehen, das ihn ohne Worte auf irgendetwas aufmerksam machen sollte. Meist begriff er nicht, was sie wollte. Dieses Mal aber doch, denn in der Richtung, in die ihn das Ziehen drehte, sah er etwas, was dort nicht hingehörte. Im Vorgarten, wenige Meter vom weit offenen Gartentor entfernt, stand das Mädchen. Einen Augenblick später war es auf die Straße entkommen.
„Wer war das?“, fragte Ina.
Alexander zögerte, was in Ina offenbar die wildesten Spekulationen auslöste. Er sah es an der steilen Falte auf ihrer Stirn.
„Habe ich dir noch nicht von ihr erzählt?“
Inas Augenbrauen schoben sich zusammen. Neben der einen Falte entstanden zwei neue. „Wer ist das?“
„Nein, nicht, was du jetzt denkst.“
„Sondern?“
„Das Mädchen mit der Ratte.“
Ina verstand kein Wort. Konnte sie auch nicht. Tatsächlich hatte er bislang kein Wort darüber verloren. Weil er sie nicht mit einer neuen erschreckenden Geschichte ängstigen wollte? Weil sich keine günstige Gelegenheit zum Erzählen ergeben hatte? Vielleicht war es beides gewesen.
Jetzt erzählte er von der toten Ratte und seinem Verdacht, der sich gegen das Mädchen richtete. Für einen Moment sah Ina recht zufrieden aus, dann kroch Angst in ihren Blick: die Angst vor dem, was dahinterstecken mochte.
Er begleitete die beiden noch bis zur Straße, dann kehrte er zu seiner Wohnung zurück. Mit den Spuren des Pfannkuchengemetzels hatten ihn seine beiden Damen bedauerlicherweise alleingelassen: zwei schmutzige Pfannen, eine große Rührschüssel, die nicht in die Spülmaschine passte, ein Herd mit angebrannten Fettspritzern und Pfannkuchenresten, so viel sah er auf den ersten Blick. Beim zweiten sah er noch mehr: platt getretenen Teig auf dem Fußboden, Fettspritzer auch dort. Und ausgerechnet jetzt war die Putzfrau krank.
Als Erstes nahm er den Abwasch in Angriff. Die Spüle stand direkt unter dem Fenster, aber anstatt das Elend in seiner Küche zu sehen, blickte nach draußen, wo im orangefarbenen Licht der Straßenlaterne gerade diese seltsame Frau auf der kleinen Treppe erschien, die von seiner Eingangstür zur Straße führte. Noch ein paar Schritte, dann musste die Frau direkt vor seiner Haustür stehen. Er ließ Abwaschbürste und Pfanne ins Spülwasser fallen und stürzte zur Tür. Was dieses Rattenmädchen schon wieder hier zu suchen hatte, war ihm schleierhaft. Bis er die Straße erreichte, war es irgendwo im Schatten der wild wuchernden Sträucher neben der schmalen Straße verschwunden. Er konnte sich nicht entschließen, sich noch weiter von der offen stehenden Wohnungstür zu entfernen, und kehrte zu seiner Pfanne zurück.
Plötzlich störte es ihn, dass man ihn von draußen sehen konnte. War das Mädchen hier gewesen, um ihn zu beobachten? Kannten sie sich womöglich? Sein Gedächtnis für Gesichter war eine Katastrophe, die nur noch von seinem Namensgedächtnis übertroffen wurde. Trotzdem war er sich sicher, dass immer wieder dieselbe Frau hier auftauchte. Nicht am Gesicht hatte er sie erkannt, sondern an der Kleidung: dem weiten langen Rock, den langen glatten Haaren und dem Schultertuch.
Wenn er sie wiederfinden wollte, dann jetzt. Zum zweiten Mal versenkte er die Pfanne im Abwaschwasser. Er griff seinen Schlüssel und lief hinaus in den warmen Sommerabend.
Im Stadtgarten war es laut. Die Begeisterungsstürme für etwas, was sich Improtheater nannte, hörte er nun schon den dritten Abend auf seiner Terrasse. Er hielt auf den Musikpavillon zu, von dem er heute nur das spitzwinklige Dach wie das aufgerissene Maul eines gefräßigen Ungeheuers sehen konnte. Mindestens hundert Leute und fast ebenso viele Fahrräder verdeckten die Sicht auf das, was im Inneren des Maules geboten wurde. Den dabei entstehenden Lärm verdeckte gar nichts. Wenn er auf eine Errungenschaft der modernen Zeit verzichten konnte, dann waren das akustische Verstärker und Mikrofone. Ohne die müsste er den Ansager dieser Truppe nicht bis in seinen Garten hören und das Keyboard auch nicht.
Die Truppe, das waren zwei Mannschaften von jungen Schauspielern. „Im Hamsterkäfig“ tönte die Aufforderung aus dem Publikum. Also sollte der Mensch auf der Bühne wohl ein Hamster sein, der wie ein Hase dort herumhüpfte und alberne Geschichten erzählte. Eine Maus kam hinzu, und der angebliche Hamsterkäfig wurde nun zum Frankensteinlabor einer Pharmafirma, wo Hamster und Mäuse in Schwefelsäure versenkt werden sollten. Sekunden später steckte der böse Chemiker selbst in der Säure, aber statt in der Freiheit fanden sich die entwischten Tierchen in den Fängen eines tierverachtenden Zirkusdirektors wieder. Trotzdem Happy End mit der Aussicht auf viele kleine Hamsterkinder aus der Mischehe von Hamster und Maus. Aus irgendwelchen Gründen brüllte das Publikum Sprechchöre, die er nicht verstand.
Alexander hielt Ausschau nach der jungen Frau von seiner Haustür. Er war schließlich nicht hier, um die wunderbare Rettung eines Hamsters und einer Maus vor der Schwefelsäure zu feiern. Schließlich entdeckte er sie ein paar Meter von ihm entfernt, wo sie still und angespannt neben einer Laterne stand. Sie beteiligte sich nicht am kollektiven Gebrüll. Alexander zog sein Handy aus der Tasche und schaltete die Kamera ein. Er näherte sich dem Mädchen schräg von hinten, dann, als sie den Kopf in seine Richtung drehte, schoss er ein Foto. Sie sah eine Weile in seine Richtung, aber er war sich nicht sicher, ob sie ihn erkannt oder das Fotografieren bemerkt hatte. Zum ersten Mal sah er sie deutlicher. Sie hatte ein schmales, blasses Kindergesicht.
„Jetzt geht’s los!“, oder so ähnlich brüllte es aus dem Publikum. Für einen Moment ließ er die junge Frau aus den Augen.
Als er wieder in ihre Richtung sah, war sie verschwunden. Er entdeckte sie in dem Augenblick wieder, als sie auf ein Fahrrad stieg, um davonzufahren. Mit ein paar schnellen Schritten war er bei ihr und hielt das Rad am Gepäckträger fest. Sie stutzte, sah ihn an, und erst jetzt erschrak sie. Offenbar hatte sie ihn erkannt.
„Lassen Sie mein Fahrrad los, oder ich schreie“, sagte sie, doch sie sah ängstlich aus, zu ängstlich, um in die Menschenmenge zu brüllen.
„Tun Sie das, aber bitte so lange, bis die Polizei kommt.“ Er sprach leise, er wollte keine Aufmerksamkeit. „Und dann erzählen Sie, warum Sie die Ratte vor meiner Haustür abgelegt haben und durch meinen Garten gelaufen sind.“
Plötzlich hatte sie eine gewisse Ähnlichkeit mit Frau Brändle: dasselbe Fragezeichengesicht wie sie, als er sie nach einem Jeff gefragt hatte. Hatte er sich doch geirrt? War es gar nicht diese Frau gewesen, die er eben vor seiner Haustür gesehen hatte? Und wenn doch, dann wusste sie vielleicht trotzdem nichts von der Ratte? Die Sache begann peinlich zu werden.
„Also, was ist? Lassen Sie mich los, oder soll ich schreien?“
Jetzt schrie das Publikum.
„Wenn Sie mir Ihren Ausweis zeigen, lasse ich Sie sofort los.“
Sie antwortete nicht und zog an ihrem Fahrrad. Natürlich war er stärker. Keinen Zentimeter ließ er sie gehen. Und wenn sie jetzt schreien würde? Diese Vorstellung war äußerst unangenehm. Ein hundertköpfiges jugendliches Publikum auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein alter Lüstling, der sich an einer jungen Frau vergriff – genau so würde es aussehen.
„Ihren Namen!“
Dann ging alles sehr schnell. Er wusste hinterher nicht einmal, wer ihm den Stoß versetzt hatte, der ihn vornüberfallen ließ. Jedenfalls war das Mädchen weg, als er wieder auf den Füßen stand.
Eine halbe Stunde nachdem er die Pfanne zum zweiten Mal ins Spülbecken hatte fallen lassen, war er wieder zu Hause. Die Pfannkuchenschlacht war noch immer nicht siegreich beendet, aber das war bei Weitem nicht das Schlimmste an diesem Tag. Dieses Mädchen! Natürlich hatte sie die Ratte vor seiner Haustür abgelegt, und der Stoß, der ihn zu Boden befördert hatte, sprach dafür, dass sie nicht allein handelte. Und er hatte sie entkommen lassen. Immerhin hatte er sie fotografiert.
Er griff zum Telefon, wählte einmal mehr Jörgs Nummer und lauschte auf das Tuten. Zehnmal, dann änderte sich der Ton. Entweder würde er jetzt auf einem Handy oder auf einem Anrufbeantworter landen. Er war sich nicht sicher, was ihm lieber war.
„Gessler hier, ja, bitte.“
„Grüß dich, Jörg. Schön, dass ich dich gleich erreiche! Ich habe …“
„Reingefallen!“, unterbrach ihn Jörgs Stimme. „Hier spricht nur der Anrufbeantworter, aber Sie können mir gern nach dem Signalton eine Nachricht …“
Alexander legte auf. Er ärgerte sich, dass er nun schon zum dritten Mal auf die Stimme vom Anrufbeantworter hereingefallen war. Und neulich war Jörg doch selbst am Apparat gewesen, als er gleich wieder aufgelegt hatte. Solche Witze waren unanständig! Niemals würde er seinen Mitmenschen so etwas antun.
Eine halbe Minute später klingelte das Telefon.
„Du hast gerade bei mir angerufen?“ Jörgs Stimme klang nach Handy.
Alexander schilderte die Ereignisse der letzten Stunde, Jörg antwortete nicht. Alexander redete weiter – und sein Freund sprach genau im selben Augenblick. Dann war wieder Pause. Schon wieder so eine unmögliche Verbindung, bei der die Worte mit Verzögerung aus dem Hörer krochen.
„Du hast das Foto?“, hörte er Gessler fragen. Seine eigene Antwort ging unter, weil der andere noch gar nicht mit seinem Satz am Ende war. Offenbar wollte er das Foto haben.
„Als MMS?“, fragte Jörg.
„Als MMS?“, fragte Alexander im selben Augenblick. Er hoffte auf ein Nein. Eine MMS hatte er noch nie verschickt. „Wo bist du denn?“
„Dreimal darfst du raten.“
Beim dritten Mal riet Alexander richtig. Jörg war an seinem neuen Lieblingsplatz am Alten Wiehrebahnhof.
Er entdeckte den Kommissar an einem etwas abseits stehenden Tisch vor dem kleinen gelb gestrichenen Bahnhofsgebäude aus dem vorletzten Jahrhundert. Gleise gab es hier schon lange nicht mehr, dafür aber ein kleines Café. Es war eines der wenigen, die bis in die späten Abendstunden geöffnet hatten. Jörg saß allein an einem der runden Metalltischchen und schaute ein paar alten Männern beim Boulespielen zu. Seinen Freund sah er kaum an, als der zwei volle Gläser mit Weizenbier vor ihn auf den Tisch stellte.
„Willst du es sehen?“, fragte Alexander.
Gesslers zufriedenes Sommerabendgesicht zeigte keine Regung. Eine warme Nacht unter Kastanienbäumen, Stimmengewirr, hin und wieder das helle Lachen einer Frau und dazu der dumpfe Aufprall der Boulekugeln und das Klicken, wenn sie zusammenstießen: Er sah nicht aus, als wolle er seine Aufmerksamkeit auf irgendwelche Handyfotos lenken. Alexander nahm sein volles Bierglas und prostete immer noch stehend Jörg zu.
„Da bist du ja schon“, sagte der, als würde er seinen Freund erst jetzt bemerken.
„Willst du das Foto sehen?“, wiederholte Alexander seine Frage.
Offenbar wollte Gessler nicht. Alexander schaltete trotzdem sein Handy ein, suchte das Foto und hielt es seinem Freund unter die Nase.
„Willst du dich nicht erst einmal setzen, ehe du zur Sache kommst?“
Alexander zog einen Stuhl näher heran und ließ sich nieder.
„Hübsch“, sagte Jörg nach einem flüchtigen Blick auf das Handy, aber Alexander wusste, dass sein Freund ohne Lesebrille so wenig darauf erkennen konnte wie er selbst: fast nichts.
Er steckte das Handy wieder ein, als wäre das Thema für ihn erledigt. Fünf Minuten, dachte er, höchstens zehn, dann würde die Neugierde ohnehin Jörgs Widerspenstigkeit besiegen. Den Blick auf die junge Frau auf dem Handy würde er nicht versäumen wollen.
Zwei Minuten waren vergangen.
„Zeig doch noch mal.“ Jörg zückte die Lesebrille. Jetzt ließ sich Alexander Zeit, bis er das Handy weiterreichte.
Sein Freund musterte das Bild lange. Neben einem Mann mit blonden Haaren und blondem Bart war das Gesicht des Mädchens kaum zu erkennen. „Könnte durchaus zur alternativen Szene und zu militanten Tierschützern passen“, stellte Jörg fest. „Nur operieren die normalerweise nicht in ihren Wohnorten, sondern überregional. Es dürfte schwierig sein, die Dame wiederzufinden. Vielleicht lebt sie nicht einmal in Deutschland.“
„Als Fremde würde sie sich doch nicht im Stadtgarten das Improtheater ansehen!“, widersprach Alexander heftig.
Jörg wiegte den Kopf hin und her, was bei ihm bedeutete, dass er völlig anderer Meinung war. „Immerhin kommt sie fast zwangsläufig durch den Stadtgarten, wenn sie von deiner Wohnung zur Innenstadt oder zum Bahnhof will.“
„Aber das Fahrrad!“
Gessler gab achselzuckend das Handy wieder zurück. „Besagt gar nichts!“
Alexander hätte am liebsten mit dem Fuß aufgestampft, wie Corinna, wenn sie beleidigt war. „Dann gehe ich eben selbst zum Tierschutzverein und zeige das Foto. Die Dame ist dort bestimmt bekannt.“
„Wenn du meinst. Unsinnigkeit war ja für dich noch nie ein Gegenargument. Aber vergiss nicht, uns das Foto zu schicken – für den Fall, dass du bei den offiziellen Tierschützern nicht erfolgreich sein solltest.“
Nun schwiegen sie beide. Vom neuen Wiehrebahnhof, nicht weit von ihnen entfernt, hörte er die Bremsen der Regionalbahn, hinter sich die Geräusche der Boulekugeln, dazwischen Gläserklirren, Stimmengewirr. Eine vertraute, sorglose Welt, zu der er nur zu gern wieder gehört hätte.
Nach einer Weile griff Jörg nach Alexanders Handy, das noch immer auf dem Tisch lag, und musterte das Foto. „Dieser Blonde mit dem Bart neben dem Mädchen – könnte das der Typ sein, der dich zu Boden gestoßen hat?“
Alexander sah das Foto an, zuckte mit den Schultern. „Wie soll ich das wissen? Jeder kann es gewesen sein.“ Er betrachtete die nicht einmal briefmarkengroßen unscharfen Gesichter auf dem Display, blickte um sich. Am Nebentisch saß zwischen anderen jungen Leuten ein blonder junger Mann mit Bart. Er könnte es sein, dachte er. Und das Mädchen einen Tisch weiter, das konnte doch die von seiner Haustür sein. „Du hast recht“, sagte er. „Es wird schwierig sein, sie wiederzufinden.“ Solche Mädchen gab es öfter in Freiburg. Eine Weile starrte er trübsinnig geradeaus, dann nahm er sein Glas und leerte es in einem Zug. „Ich fahre dann mal.“
„Wohin? Zum Tierschutzverein?“
„Auch, aber nicht jetzt.“
Der Türgriff klebte widerlich, als Alexander zu Hause die Tür aufstieß, seine ganze Hand war schmutzig geworden. Irgendetwas Dunkles war an den Türgriff geschmiert worden, was er jetzt an seiner Hand hatte. Blut? Er hielt die Finger an die Nase. Die dunkle, klebrige Flüssigkeit, die aussah wie Blut, roch auch so. Das war Blut. Ekelhaft! Bestimmt das Werk des Hippiemädchens!
Hatte er das Blut nicht bemerkt, als er ihr in den Stadtgarten gefolgt war? Undenkbar, er hatte die Tür doch an ebendiesem Griff zugezogen, und nichts hatte an seiner Hand geklebt. Also musste sie, während er nach ihr suchte oder als er vor dem Alten Wiehrebahnhof saß, noch einmal hier gewesen sein.
Und woher hatte sie das Blut? Von einer toten Ratte? War es ihr eigenes? Hatte sie sich dafür verletzt?
Als er sich im Bad die Hände wusch, merkte er, dass sie viel ruhiger waren als in dem Augenblick, als er von Ingrids verwüstetem Grab erfahren hatte. Begann er sich schon an solche Anschläge zu gewöhnen? Der Mensch gewöhnte sich an so vieles.
Er rief Jörg an. Der saß noch immer vor dem Bahnhof. „Das Hippiemädchen hat wieder zugeschlagen.“
„Die nächste tote Ratte?“
„Dieses Mal klebte Blut am Türgriff.“
„Einfach nur Blut? Keine Tierschutzslogans, keine tote Ratte?“
„Nichts. Die Kleine scheint davon auszugehen, dass ich weiß, was das Blut zu bedeuten hat.“
„Und? Weißt du es?“
Alexander antwortete nicht. Was die Wahrheit war, ahnte er allenfalls.
„Lass alles, wie es ist. Wir müssen untersuchen, ob das Blut von einem Menschen oder einem Tier stammt.“
Er schien auf einen Kommentar von Alexander zu warten, doch der schwieg.
„Übrigens“, fuhr Gessler nach einer Weile fort, „ich habe vorhin noch etwas vergessen. Elfriede hatte die Idee, den Slogan von Ingrids Grab mit Schmierereien von militanten Tierschützern vergleichen zu lassen, die sich gegen Mitarbeiter von Pharmafirmen in Basel richten.“
„Elfriede?“
„Deine spezielle Freundin Frau Funkel. Die Schmiererei auf Ingrids Grab stammt eindeutig nicht von derselben Hand wie die Slogans in Basel. Die richten sich gezielt gegen die Zusammenarbeit mit dem Tierlabor Huntingdon Life Sciences und lauten ›Stop Huntingdon animal cruelty‹ oder ›Drop HLS now‹.“
„Jörg, die Vermutung ist doch absurd, dass ich in die Schusslinie von Menschen geraten sein soll, die es sonst auf ein Labor abgesehen haben, in dem Hunderttausende von Tieren zu Versuchszwecken gequält und getötet werden.“
„Die sehen das vielleicht nicht so eng. Nicht nur auf die Firma selbst werden Anschläge verübt, sondern schlichtweg auf alle, die mit HLS in irgendeiner Weise zu tun haben. Die haben sogar Kleinaktionäre ausfindig gemacht und bedroht.“
„Unglaublich.“
„Doch. Nach englischem Recht müssen die Aktiengesellschaften Namen und Adressen ihrer Aktienbesitzer offenlegen.“
„Ich habe keine Aktien und auch sonst nicht das Geringste mit HLS zu tun.“
„Nicht gerade mit HLS. Ich habe gelesen, dass ein Drittel aller Tierversuche für Grundlagenforschung durchgeführt wird, also von Leuten wie dir. Einige Dutzend niedliche Mäuse dürftest du auch auf dem Gewissen haben.“
„Ohne die Versuche mit den Mäusen wären wir damals nicht weitergekommen“, verteidigte sich Alexander. „Es gab zu diesem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit, die Funktion von Genen bei Wirbeltieren aufzuklären.“
„Schon gut. Sicher gehörst du nicht zu den ganz Großen, was Tierversuche betrifft, aber die Kombination mit Gentechnik ist schon eine besondere Provokation. Denn auch wenn es nicht dieselbe Person war, die die Schmierereien in Karlsruhe und die in Basel ausgeführt hat, so liegen die Parallelen zwischen den Anschlägen doch auf der Hand. Das Grab der Mutter von Daniel Vasella, dem Chef der Pharmafirma Novartis, wurde in ähnlicher Weise geschändet wie das von Ingrid, und das Jagdhaus von Vasella in Tirol wurde mit Benzin in Brand gesetzt genau wie dein Institut.“
Alexander schwieg betroffen. Der beschmierte Grabstein, Benzin als Brandbeschleuniger – konnte dieses Zusammentreffen ein Zufall sein? Natürlich.
„Und was passiert jetzt?“
„Ich schicke dir morgen früh jemanden wegen des Blutes vorbei. Du brauchst dich nicht um die Herrschaften zu kümmern.“
Es war jetzt kurz vor Mitternacht. Noch einmal ließ Alexander frisches Wasser ins Spülbecken, fest entschlossen, sich nicht wieder von seiner Arbeit abbringen zu lassen. Er scheiterte am Klingeln des Telefons. Es war Jörg.
„Du wolltest mir doch das Foto zuschicken!“
Natürlich hatte er nicht mehr an die MMS gedacht. Eher dankbar als verärgert über den neuerlichen Aufschub der Küchenarbeit drückte er auf den Tasten seines Handys herum. Nach weniger als fünf Minuten erschien die Meldung „Nachricht versendet“. Viel zu schnell, dachte er und machte sich wieder über den Abwasch her. In der Ferne hörte er dumpfe Glockenschläge. Vom Münsterturm schlug es Mitternacht.
Als endlich die Küche so ordentlich und sauber war, wie es ohne Putzfrau möglich war, schmerzte wieder sein Rücken. Jedes Mal, wenn er länger als ein paar Minuten in der Küche arbeitete, bekam er Rückenschmerzen. Wann würden sich endlich die Männer zusammentun und um ihre Emanzipation kämpfen? Um männergerechte Küchen zum Beispiel. Parkplätze speziell für Frauen, warum nicht Küchen für Männer? Arbeitsplatten in einem Meter Höhe, statt der zwergenhaften sechsundachtzig Zentimeter, die seine Küche hatte. Kleine Frauen konnten sich ja auf eine Fußbank stellen, wenn ihnen die Höhe von Herd und Spüle nicht behagte.
Er hätte sich gern bis zum Einschlafen mit Problemen wie der männergerechten Höhe von Arbeitsplatten beschäftigt, aber als er im Bett lag, stand da wieder das Mädchen mit einer toten Ratte vor seinen geschlossenen Augen, und an der Klinke klebte Blut. Vielleicht sollte er eine Spende an den Tierschutzverein überweisen, dachte er, als könne er sich damit freikaufen von einer Schuld, die er nicht einsah.









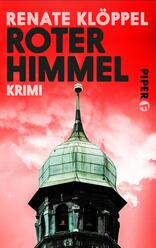



DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.