
Mit einem Propellerflugzeug in 80 Tagen um die Welt
„Es ist ein sehr packend geschildertes Abenteuer von zwei mutigen Hobbypiloten, die mit ihrer Reise das geschafft haben, wovon viele nur träumen können.“ - Dingolfinger Anzeiger
Mit einem Propellerflugzeug in 80 Tagen um die Welt — Inhalt
Vom ewigen Eis des Polarmeers in die Millionenstadt Tokio, von der Einsamkeit des Outback zum Lichterfest in Mandalay: Der Hobbypilot Johannes Burges erfüllt sich seinen Lebenstraum. Zusammen mit einem Freund reist er in einer winzigen Propellermaschine um die Erde. Und zwischen heftigen Stürmen sowie waghalsigen Manövern bleibt den beiden „Earthrounders“ Zeit, um bei einem Rundflug über Manhattan, einem Tauchgang auf den Gewürzinseln und einer rasanten Tuk-Tuk-Fahrt in Chittagong die berauschende Vielfalt unseres Planeten zu entdecken. 55 000 aufregende Kilometer durch zwanzig Länder – so mitreißend erzählt, dass man auch ohne Flugschein abheben kann.
Leseprobe zu „Mit einem Propellerflugzeug in 80 Tagen um die Welt“
Bis ans Ende der Welt – und noch etwas weiter
Ganz allein stehe ich auf der Landebahn, in meinem dicken, orangefarbenen Überlebensanzug. Es ist kurz nach Sonnenaufgang. Um mich herum befindet sich im Umkreis von gut 300 Kilometern keine Menschenseele: kein Dorf, keine Stadt. Nur das Meer, das Rauschen des Pazifiks. Nur die unbewohnten Ausläufer der Aleuten, einer schmalen Inselkette, die sich von Alaska aus in einem weiten Bogen westwärts in den Pazifik erstreckt.
Ich stehe regungslos da und blicke ins Nichts. Ich habe Angst, gewaltige Angst vor einem [...]
Bis ans Ende der Welt – und noch etwas weiter
Ganz allein stehe ich auf der Landebahn, in meinem dicken, orangefarbenen Überlebensanzug. Es ist kurz nach Sonnenaufgang. Um mich herum befindet sich im Umkreis von gut 300 Kilometern keine Menschenseele: kein Dorf, keine Stadt. Nur das Meer, das Rauschen des Pazifiks. Nur die unbewohnten Ausläufer der Aleuten, einer schmalen Inselkette, die sich von Alaska aus in einem weiten Bogen westwärts in den Pazifik erstreckt.
Ich stehe regungslos da und blicke ins Nichts. Ich habe Angst, gewaltige Angst vor einem Flug, wie ich ihn noch nie gemacht habe: über den nördlichen Pazifik hinweg, über eine Gegend, in der kaum jemand unterwegs ist, weil das Wetter meist so schlecht und der Seegang so hoch ist. Ein halber Tag übers offene, wilde Meer.
Links und rechts von mir erheben sich die steilen, knapp 900 Meter hohen Berge von Attu. Eine verlassene Insel, schroffe Felsen im Morgenlicht. Wenn es irgendwo ein Ende der Welt gibt, dann liegt Attu noch ein gutes Stück dahinter: ein weit abgelegener Felsen inmitten des unwirtlichen Pazifiks. Umtost von den Wellen, zerzaust vom Sturm, einsam und wild. Kein Strauch wächst auf den Hängen, nur Moos und Gras.
Von der Kulisse nehme ich in diesem Moment allerdings kaum etwas wahr, stattdessen rasen die Fragen durch meinen Kopf: Warum um Himmels willen habe ich mir das angetan? Warum wollte ich unbedingt nach Attu?
Attu – das ist der westlichste Punkt der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Insel liegt zehn Flugstunden westlich von Anchorage, mitten in der Barentsee. Von Attu aus ist es näher nach Russland als auf das Festland von Alaska. Russische Pelzjäger kamen im 18. Jahrhundert her, um Seeotter zu jagen. Einer der Jäger musste sieben Jahre auf der Insel ausharren, ehe ein Schiff ihn abholen kam. Und jetzt – kommt kein Schiff mehr nach Attu.
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner die Insel sich selbst überlassen. Im August 2010 ist als Letztes auch die US-Küstenwache abgezogen, hat diesen äußersten Außenposten der Vereinigten Staaten aufgegeben. Das Flughafengebäude und die Baracken der Coast Guard sind verlassen. Der Wind schlägt den eisigen Regen gegen die Bretter, mit denen die Fenster zugenagelt wurden.
Eine Geisterinsel.
Es gibt einen Tower, den niemand mehr bedient. Es gibt eine Landebahn, die niemand mehr pflegt. Seit Jahren landen hier keine Flugzeuge mehr. Wieso auch? Wer will schon nach Attu?
Und nun sind wir hier und wollen ausgerechnet von dieser Geisterinsel, von diesem Geisterflughafen aus starten. Verrückt? Ja, völlig verrückt. Zehn, elf Stunden wird unser Flug nach Japan dauern – wenn der Wind günstig steht und alles gut geht. 2800 Kilometer liegen vor uns, über das offene Meer bis nach Sapporo. Auf dieser Strecke gibt es keine einzige Insel, auf der wir notlanden könnten. Und wenn der Wind nicht von hinten kommt, sondern uns von vorn entgegenblasen sollte, wenn unser winziges Flugzeug also gegen die Gewalten der Natur ankämpfen muss – dann können es auch zwölf, dreizehn Stunden werden. Vielleicht sogar vierzehn oder fünfzehn. Dann könnte es knapp werden mit dem Sprit. Und leider bläst der Wind über dem nördlichen Pazifik meist aus Westen. Also tatsächlich von vorn.
„Maggie“, schaffst du das? Können wir dir vertrauen?
„Maggie“ steht vor mir auf der Landebahn: ein winziges Flugzeug. Eine Mooney M20T, Baujahr 1997, eine einmotorige Sportmaschine mit Kolbenmotor. Menschen, die selbst nicht fliegen, würden sie vermutlich für eine Cessna halten, weil sie genauso klein ist.
Während ich auf der Landebahn stehe, schießen mir die wildesten Gedanken durch den Kopf. Ich denke an meine Familie in München, an meine Frau Heike und meine zehnjährige Tochter Marie. Werde ich sie wiedersehen? Werde ich den Flug über den Pazifik heil überstehen? Mein Frau hat immer gesagt: Erfüll dir deinen Traum! Flieg einmal um die Welt! Aber sie wusste nicht, was es heißt, von Attu nach Sapporo zu fliegen. Ich habe Todesangst …
Und in diesem Augenblick mache ich etwas, was ich sonst nie tue: Ich bete zu Gott. Eigentlich bin ich kein religiöser Mensch, es ist Ewigkeiten her, dass ich zum letzten Mal in der Kirche gewesen bin. Aber nun halte ich Zwiesprache mit dem Mann da oben im Himmel. Die Grenzerfahrung, vor der ich stehe, dieses Spiel mit Leben und Tod, lässt ihn mir plötzlich ganz naherücken. Ich bitte den lieben Gott um Hilfe bei dem, was ich vorhabe.
Seit einem halben Jahr habe ich jeden Tag an Attu gedacht. Habe mir überlegt, wie es wohl sein wird auf dieser Insel. Habe von Attu geträumt und mir einen Film aus dem Internet heruntergeladen über dieses spezielle Eiland und seinen gottverlassenen Flughafen. Ich habe Albträume gehabt, obwohl ich mir doch eigentlich etwas Schönes erfüllen wollte.
Mein Traum: Ich will um die Welt fliegen – nicht in einer Linienmaschine, nicht mit einem dieser „Round the World“- Tickets, die es im Reisebüro zu kaufen gibt. Nein, ich will das ganz große Abenteuer. Deshalb sitze ich selbst am Steuer meiner kleinen Sportmaschine. Solche Propellerflugzeuge, angetrieben von einem Kolbenmotor, sind eigentlich nur dafür gebaut, ein paar Hundert Kilometer zurückzulegen. Von München nach Kiel. Von München nach Mallorca. Das alles habe ich in den letzten zwölf Jahren gemacht, seit ich meinen Pilotenschein erworben habe. Einmal bin ich sogar von München bis nach Spitzbergen geflogen. Habe mich da schon mutig gefühlt, wie ein richtiger Abenteurer.
Aber einmal um die Welt? In einer Mooney? In so einer kleinen Kiste? Wahnsinn, sagen alle, denen ich in den Monaten zuvor davon erzählt habe. Freunde, die selbst nicht fliegen, aber auch erfahrene Piloten haben mir abgeraten. Mach das nicht! Das Flugzeug ist zu klein, haben sie gesagt, die Maschine zu schwach, das Risiko zu groß.
Ich mache es trotzdem. Denn ich bin davon überzeugt, dass ich meine Grenzen überwinden kann. Auch die Grenze der Angst. Ich will es mir beweisen, ja, vor allem mir selbst. Aber ich will es auch denen beweisen, die zweifeln, die dieses Abenteuer, meinen Flug um die Welt, für allzu verwegen halten.
Zu zweit machen wir diese Reise, zu zweit werden wir »Maggie« steuern. Pilot und Co-Pilot: Mal ist es der eine, mal der andere. Mal Wolf Schroen, mal ich. Wir werden uns abwechseln, wir ergänzen uns gut. Ich bin der Draufgänger, Wolf ist der Bedächtige. Ich bin der Ungeduldige, Wolf ist der Gelassene. Ich drängele mich in einer Schlange gern vor, wenn ich es eilig habe, Wolf stellt sich immer hinten an (wirklich immer). Ich werde schon mal unwirsch, wenn mir etwas nicht passt, Wolf bleibt selbst in Stresssituationen immer die Ruhe selbst (na ja, fast immer). Er, der Deutsch-Amerikaner, geboren in Dallas, ist der große Weltenbummler, und ich, der gebürtige Bayer, seit jeher in und um München zu Hause, ich bin der Bodenständige.
So unterschiedlich wir sind, so gut verstehen wir uns. Ich kenne Wolf erst seit einem Jahr, nicht sehr gut also. Wir sind keine alten Freunde, sondern zwei, die sich durch Zufall gefunden haben. Aber uns verbindet etwas Entscheidendes: Wolf ist genauso flugverrückt wie ich, vielleicht sogar noch ein bisschen verrückter. Auch er will seit Jahren einmal um die Welt fliegen und sucht schon lange jemanden, der mit ihm dieses Abenteuer wagt. Genauso wie ich jemanden gesucht habe, der es mit mir wagen würde. Nun wagen wir es gemeinsam.
Was wir vorhaben, das ist bislang erst wenigen Menschen gelungen. Seit 1924 sind gerade mal 194 einmotorige Kleinflugzeuge um die Welt geflogen, die meisten in östlicher Richtung, mit Rückenwind. Nur 44 Maschinen haben es in westlicher Richtung geschafft, die letzte vor zwei Jahren.
„Earthrounders“ heißen diese Piloten, die die Welt mit einem Flugzeug umrundet haben. Es gibt einen gleichnamigen Club, der über alle erfolgreichen oder gerade aktuellen Umrundungsflüge Buch führt. Die ersten „Earthrounders“ waren zwei Soldaten der US-Luftwaffe, die am 6. April 1924 mit ihren Doppeldeckern, genannt „Chicago“ und „New Orleans“, von Seattle aus gestartet sind. Nach 175 Tagen waren sie wieder zurück. Zwei andere Maschinen schafften es nicht: Die „Seattle“ zerschellte an einem Berg in Alaska, die „Boston“ musste nahe Grönland notwassern; die Piloten überlebten in beiden Fällen.
Auf ihrer Reise um die Welt sind die ersten „Earthrounders“ am 9. Mai 1924 auch auf Attu gelandet. Eine Metalltafel, die wir unweit der Landebahn entdeckt haben, erinnert an den „First World Flight“ und an Lieutenant Erik H. Nelson, den Piloten der „New Orleans“, dem die erste Erdumrundung gelungen ist. Sechs Tage später sind die beiden Piloten weiter gen Japan geflogen – westwärts, genau wie wir.
Fast sieben Jahrzehnte danach ist ein Flug um die Welt, zumal in einem so kleinen Flugzeug wie unserer Mooney, immer noch ein Abenteuer. Eines mit Risiken. Eines aber auch, das unvergleichliche Erlebnisse verspricht. 80 Tage, so der Plan, soll unsere Reise dauern – 80 Tage, in denen wir in 20 Ländern Station machen und unterschiedlichste Kulturen erleben werden. Wir werden viel Zeit in der Luft verbringen, aber noch viel mehr Zeit am Boden.
Was die Philosophie unserer Reise anbelangt, sind Wolf und ich uns einig: Wir wollen nicht im Schweinsgalopp um die Welt fliegen, sondern Land und Leute so gut wie möglich kennenlernen. Auch wenn wir nicht gemächlich mit dem Rucksack reisen oder mit dem Fahrrad um die Welt radeln, so wollen wir doch überall dort, wo wir mit „Maggie“ landen, möglichst tief in die Kultur vor Ort eintauchen.
Der Reiz unserer Erdumrundung besteht dabei aus den extremen Gegensätzen, die wir innerhalb kürzester Zeit erleben werden: Mal stecken wir im ewigen Eis des Polarmeeres – und nur drei Tage später laufen wir durch die Straßenschluchten von Manhattan. Mal landen wir in der völligen Einsamkeit Alaskas – und nur eine Woche später in Tokio, der Mega-Metropole mit ihren 20 Millionen Einwohnern. Mal genehmigen wir uns einen Drink in einem Luxushotel in Singapur – und nur wenige Tage später laufen wir durch die Armenviertel von Chittagong, der zweitgrößten Stadt in Bangladesch. Mal empfangen uns korrupte Zöllner und feindselige Soldaten – oft aber werden wir Menschen erleben, die uns mit großer Herzlichkeit und Offenheit begrüßen und staunen über „the two crazy Germans“, die mit ihrem Mini-Flugzeug um die Welt fliegen.
20 Länder in elfeinhalb Wochen: Das soll uns einen faszinierenden Blick auf unsere Welt ermöglichen, auf wuchernde Metropolen und einsame Landstriche, auf traumhafte Strände und schneebedeckte Himalaja-Gipfel, auf coole Kneipen in Australien und lärmende Straßenhändler in Myanmar. Und es soll uns helfen, die Geschichte unserer Welt besser zu verstehen: die Geschichte der Ureinwohner und Eroberer, der Kolonialmächte und Weltmächte, die Geschichte von Reichtum und Armut, von Aufstieg und Fall, von Mensch und Natur.
Und dann, plötzlich, sind wir schon drei Wochen unterwegs: Von Straubing, eine Autostunde nordöstlich von München, sind wir nach Bremen geflogen, von dort über Schottland, Island und Grönland ins eisige Kanada. Anschließend ging’s nach New York und weiter nach Dallas. Es folgte der Südwesten der USA: Las Vegas samt Grand Canyon und Bryce Canyon, Kalifornien samt Los Angeles und San Francisco. Von dort hoch nach Norden, entlang der Pazifikküste nach Anchorage. Und schließlich über die Aleuten bis nach Attu.
Vor uns liegt nun die gefährlichste Herausforderung unserer Erdumrundung: der Flug über den Pazifik. Hier zeigt sich, ob wir den notwendigen Mut haben – oder nicht. Hier zeigt sich, ob unser Flugzeug ausreichend Kraft hat für diese Reise – oder nicht. Es geht, so dramatisch das auch klingen mag, um Leben und Tod.
Am Tag zuvor sind wir auf Attu gelandet. Wir kamen von Adak, einer anderen, unwirtlichen Aleuteninsel. Als wir uns am frühen Nachmittag Attu näherten, schien die Sonne. Allein das ist schon bemerkenswert. Denn normalerweise hängen an über 355 Tagen im Jahr dichte Wolken über der Insel. Nur an acht bis zehn Tagen regnet es nicht, nur an acht bis zehn Tagen herrscht Sonnenschein – und in der Nacht kann man die Sterne sehen. Und wir erwischen einen dieser Tage! Was für ein Glück!
Attu sieht beeindruckend aus, wie es so daliegt: eine 56 Kilometer lange und 31 Kilometer breite Insel mit vielen schmalen Buchten, unendlich vielen Tälern und Hügelkämmen. Dennoch geben wir nicht der Versuchung nach, eine Runde um die zerklüftete Insel zu fliegen – wir müssen Sprit sparen für den Flug am nächsten Tag. Und so steuern wir schnurstracks auf die Landebahn zu, vorbei an einem Flugzeugwrack, das dort in den Bergen liegt. Am 30. Juli 1982, einem jener vielen nebligen Tage, zerschellte hier eine Transportmaschine der US Coast Guard, eine Hercules. Die Piloten waren sofort tot. Die Trümmer wurden in dem unwegsamen Gelände bis heute nicht geborgen. Eine beklemmende Erinnerung daran, wie gefährlich die Landung auf dieser Insel sein kann.
Nach der Landung suchen wir uns als Erstes einen Schlafplatz und finden ihn in einer windgeschützten Ecke hinter dem alten Flughafengebäude. Nicht weit von zwei großen Satellitenschüsseln entfernt schlagen wir das grüne Drei-Mann-Zelt auf, das wir in Anchorage, Alaska, gekauft haben. Neben dem Flughafengebäude erhebt sich ein Gerippe aus Stahl, der ehemalige Funkmast, über den seit drei Jahren niemand mehr funkt. Auch unsere Handys funktionieren nicht. Selbst das Satellitentelefon, über das wir bislang überall telefonieren konnten, meldet: Kein Empfang! Wenn nicht unten auf dem Vorfeld „Maggie“ stünde, käme ich mir fast wie Robinson Crusoe vor, gestrandet im Nirgendwo, fernab von allem Menschenleben. Stattdessen beschleicht mich ein zwiespältiges Gefühl. Einerseits fühle ich mich ungeheuer frei, weil ich die Zivilisation hinter mir gelassen habe – weiter als jemals zuvor in meinem Leben. Andererseits empfinde ich eine leise Beklemmung, weil wir ganz auf uns allein gestellt sind und uns niemand helfen kann.
Die Relikte des Zweiten Weltkriegs, die auf Attu überall zu besichtigen sind, steigern dieses Gefühl der Beklemmung noch. Aus Deutschland kenne ich das nicht: Fast sieben Jahrzehnte nach Kriegsende sind Ruinen und Schutt, Minen und Bomben längst beseitigt. Nur ab und zu flackert beim Fund einer Fliegerbombe die Erinnerung an die mörderische Epoche kurz auf, ehe sie ebenso schnell wieder verblasst.
Auf Attu dagegen habe ich das Gefühl, als sei der Zweite Weltkrieg noch gar nicht lange vorüber. Auf einer Anhöhe oberhalb des Flugplatzes thront eine Flugabwehr-Kanone, etwas weiter liegt ein verrosteter Flugzeugpropeller im Gras. Als wir hinunterlaufen zum Meer, über einen anfangs geteerten Weg, der später in einen Schotterpfad mündet, stehen links und rechts Schilder, die vor Sprengsätzen warnen: „Caution! Unexploded Ordnance Present on Island“ – Vorsicht! Nicht explodiertes Kriegsgerät auf der Insel. Wir wagen es deshalb nicht, den Weg zu verlassen und in die Hügel zu stapfen – so verlockend es wäre, von dort den Blick über die Insel schweifen zu lassen.
Attu war im Zweiten Weltkrieg eine umkämpfte Insel. Am 7. Juni 1942 sind in der Bucht, in der Wolf und ich heute unser Zelt aufschlagen, die Japaner gelandet. Es ging ihnen um die Seeherrschaft im nördlichen Pazifik. Fast ein Jahr hielten die Japaner sich auf Attu. Am 29. Mai 1943 gelang es den Amerikanern jedoch, die Insel nach einer blutigen Schlacht zurückzuerobern. 580 amerikanische Soldaten und 2351 japanische Soldaten starben. Nur 28 Japaner überlebten, die meisten anderen sprengten sich, als die Niederlage absehbar war, mit ihren Handgranaten in die Luft.
Als wir unten am Wasser sitzen, jeder eine Flasche „Alaskan Beer“ in der Hand, die wir aus Adak mitgebracht haben, versuche ich mir vorzustellen, wie das vor sieben Jahrzehnten wohl gewesen ist, als um diese Insel so erbittert gefochten wurde. Hinter uns erhebt sich der dunkle Kastenbau einer rostigen Halle, daneben stehen Telefonmasten, die keine Leitungen mehr tragen. Vor uns das Meer. Die Reste eines hölzernen Piers. Schiffe haben hier angelegt, um die 47 Menschen zu versorgen, die auf Attu bis zur Invasion der Japaner gelebt haben. Seither verrotten die Pfähle, die Querbalken des Piers sind verschwunden. Genau hier sind auch die Amerikaner gelandet, um Attu zurückzuerobern. Ausgehend von der „Massacre Bay“, wie sie bis heute in manchen Karten heißt, sind sie mit ihrer Übermacht von 15000 Soldaten ins Innere der Insel vorgedrungen und haben die Japaner binnen weniger Tage bezwungen.
Als die Sonne untergeht, stiefeln wir zurück zu unserem Schlafplatz und machen uns auf einem Holztisch, der neben dem Flughafengebäude steht, ein Abendessen. Der Blick ist spektakulär. Wir schauen auf die schroffen Berge von Attu. Die Strahlen der Sonne tauchen die Wolken erst in ein sattes Gelb, dann in ein Orange. Später, nach Sonnenuntergang, leuchten die Berge und das Meer in einem tiefen, satten Blau.
Unser Abendessen ist nicht sehr opulent, aber wir zelebrieren es, als säßen wir in einem guten Restaurant. Wir decken den Holztisch mit dem ein, was wir am Tag zuvor in Adak zusammengeklaubt haben: Teller aus Styropor, Plastikbesteck, Plastikbecher, Papierservietten. Wir richten das Brot und die Ritz-Kekse auf einem der Teller an, schneiden den Cheddar-Käse auf und drapieren die Scheiben liebevoll auf einem weiteren Teller. Als Getränke haben wir Milch und Kakao in Flaschen dabei, außerdem einen großen Wasserkanister. Doch vor allem trinken wir jeder eine ganze Flasche kalifornischen Rotwein, einen Cabernet Sauvignon. Wir saufen an gegen die Angst.
„Ich hab Schiss“, sage ich zu Wolf.
„Ich auch“, entgegnet er knapp.
Wolf hat die halbe Welt gesehen, hat über 50 Länder bereist. Asien. Arabien. Europa. Südamerika. Er hat neben einer einsamen Straße in Weißrussland gezeltet, war in Syrien unterwegs oder ist auf den Kilimandscharo gestiegen. Eigentlich ist er ein gelassener, fröhlicher Typ, aber nun packt auch ihn die Furcht.
Um uns abzulenken, planen wir akribisch den nächsten Tag. Gehen noch einmal Schritt für Schritt alles durch. Überlegen, wann wir aufstehen. Wann wir starten. Wie schnell und wie hoch wir fliegen sollen. Wir berechnen noch einmal, ob unser Sprit für den langen Flug über den Pazifik reichen wird. Wie oft haben wir das in den letzten Wochen gemacht? Achtmal? Zehnmal? „Ja, der Sprit wird reichen, bestimmt“, sagt Wolf in seinem texanisch gefärbten Deutsch.
Er ist ein drahtiger Kerl, groß, schlank. Seine Augen blitzen unentwegt, und in diesem Moment kann ich in ihnen nicht bloß die Angst, sondern auch die Vorfreude auf das sehen, was uns am nächsten Tag bevorsteht. Der Wein löst unsere Zungen, er vertreibt unsere Anspannung. Und so reden wir schon bald nicht mehr übers Fliegen, sondern über die Dinge, die wirklich unser Herz bewegen. Ich erzähle von Heike und Marie, die ich beide so sehr liebe, von unserem wunderbaren Leben zu dritt in Pullach. Und Wolf erzählt von Caroline, seiner Freundin, die in San Francisco lebt, weit weg von Berlin, in Deutschland, wo er seit Jahren zu Hause ist.
In ein paar Monaten, erzählt Wolf begeistert, werde er zu Caroline ziehen. Kalifornien statt Deutschland. Pazifik statt Spree. Und dann werde er mit ihr zusammen mit einem VW-Bus hinunter bis nach Südamerika fahren. So ist Wolf: Er denkt schon an das nächste Abenteuer, ehe er dieses hinter sich gebracht hat. Ein ewiger Weltenbummler.
Als wir uns genug Mut angetrunken haben und es dunkel wird, gehen wir zum Zelt und schlüpfen in unsere Schlafsäcke. Es ist kalt, nur knapp über null Grad. Über meine Jeans und meinen Pulli streife ich das wattierte Innenelement des Überlebensanzugs, außerdem ziehe ich meine Winterjacke an und setze eine Mütze auf.
Ich schlafe tief und fest, als Wolf mich mitten in der Nacht wecken kommt.
„Johannes, schau dir die Sterne an, das ist unglaublich“, sagt er.
„Ach, lass mich schlafen“, knurre ich und drehe mich um.
Sterne? Gibt es überall. Habe ich schon gesehen.
Aber von wegen. Zwei, drei Stunden später muss ich pinkeln. Schlaftrunken taumele ich aus dem Zelt, in der einen Hand eine Taschenlampe. Die Nacht ist tiefschwarz; als ich jedoch nach oben schaue, kann ich es kaum fassen: Über mir erstreckt sich ein Himmel, wie er phantastischer nicht sein könnte. Im Umkreis von mehreren Hundert Kilometern gibt es hier keine einzige Lichtquelle – die Sterne glitzern und funkeln in einer Pracht, die ich aus Europa nicht kenne, nicht einmal aus Regionen, die fernab der Großstädte liegen.
Und dann erhebt sich mit lautem Flügelschlagen und Geschnatter ein Schwarm Wildgänse in den Himmel, aufgeschreckt von mir, dem seltsamen Besuch auf der Insel. Es ist wie in einem Film. Wie in einem Geisterfilm. Und ich bin mittendrin. Lange bleibe ich vor dem Zelt stehen. Blicke hoch zum Himmel, zu den Sternen, zur leuchtenden Milchstraße.
Am nächsten Morgen sind wir vor Sonnenaufgang auf den Beinen. Wir reden nicht viel, sind in uns gekehrt vor dem langen Flug. Wir wissen genau, was wir zu tun haben. Wolf ist der Penible von uns beiden, deshalb läuft er vor dem Frühstück die Landebahn ab. Liegen dort vielleicht Steine herum? Gibt es Schlaglöcher? Schon bei der Landung haben wir nichts dergleichen gefunden, aber sicher ist sicher. Nach dem Frühstück laufe auch ich noch einmal die Piste ab.
Danach ziehen wir „Maggie“ vorsichtig aufs Vorfeld. Wir wollen auf keinen Fall, dass der Propeller auf den Asphalt schlägt und beschädigt wird, so wie ein paar Wochen zuvor bei einer missglückten Landung in Deutschland. Wir sind wegen des Schadens, den „Maggie“ dort genommen hat, noch immer leicht paranoid, immerhin haben wir den Abflug für unsere Erdumrundung deswegen verschieben müssen und die ersten beiden Tage mit Warten verbracht. Wenn dem Flugzeug hier das Gleiche passiert, können wir nicht fliegen und müssen hoffen, dass jemand nach uns sucht. Denn Hilfe rufen können wir nicht. Kein Empfang.
Wir packen unser Gepäck in die Maschine. Das Zelt. Die Rucksäcke und Taschen. Selbst auf dieser menschenleeren Insel habe ich meine Kamera, meinen Laptop und mein iPad nachts nicht im Flugzeug gelassen, sondern mit ins Zelt genommen. Aus Gewohnheit – damit nichts gestohlen wird. Hinter den beiden Pilotensitzen erhebt sich unser schwarzer Zusatztank, die „Big Bertha“, prall gefüllt bis obenhin.
Die Sonne ist mittlerweile aufgegangen. Am Himmel ziehen Schäfchenwolken vorbei. Wir haben tatsächlich bestes Flugwetter. Wolf wartet etwas entfernt, am Rande des Vorfelds. Ich stehe auf der Rollbahn und bete.
Lieber Gott, geleite mich sicher über den Pazifik.
Lieber Gott, sorge dafür, dass ich wieder heimkomme nach München, zu Heike und Marie.
Wenn über dem Pazifik der Motor aussetzt, wenn wir im Meer notwassern müssen, sind die Aussichten, dass wir überleben, nicht gut. Schon bei der Landung kann es die Mooney zerreißen. Wenn wir es auf unsere Rettungsinsel schaffen, haben wir vielleicht eine Chance. GPS-Sender, Leuchtraketen, Notrationen – haben wir alles dabei. Irgendwer wird uns dann finden. Ein Flugzeug. Ein Schiff. Möglicherweise.
Und wenn wir es nicht auf die Rettungsinsel schaffen? Dann könnten wir mit unseren Überlebensanzügen in den Pazifik springen. Aber viel länger als 45 Minuten würden wir in dem eisigen Wasser nicht überleben.
Vier, fünf Minuten stehe ich so da und bete.
Schließlich sagt Wolf: „Los geht’s!“
„Ja“, sage ich, „los geht’s!“
Vorsicht, Kolbenfresser!
Dunkel ist es, verdammt dunkel. Ein Gewitter tobt in der Nacht. Nur ab und zu, wenn ein Blitz zuckt, kann ich etwas erkennen. Wie, frage ich mich verzweifelt, soll ich es bei diesem Seegang in die Rettungsinsel schaffen? Das orangefarbene Ding hüpft vor mir auf den Wellen. Zwei Meter sind die Brecher hoch, vielleicht auch etwas höher. Die Gischt schlägt gegen das Cockpit, ich hänge in der Tür, die schon halb unter Wasser ist, und arbeite mich Stück für Stück heraus. Mir ist schummerig, im Magen habe ich ein flaues Gefühl. Dann springe ich ins Wasser, schwimme rüber zur Rettungsinsel. Ich bin drin!
So ist es also, wenn man mit einem Flugzeug im Meer notwassern muss. Ein beängstigendes Gefühl. Zum Glück ist das hier nur ein Training. Fünf Monate vor dem Start unserer Weltreise übe ich im Maritimen Trainingszentrum Wesermarsch in Elsfleth, eine halbe Autostunde nordwestlich von Bremen, wie ich nach einer Notlandung im Meer überleben kann.
Die Vorhänge der Halle in Elsfleth sind zugezogen, die Rotoren der Windmaschine erzeugen einen heftigen Sturm, die Wellenmaschine wühlt das Wasser in dem fünf Meter tiefen Trainingsbecken auf. Die Blitze werden von einer Stroboskop-Anlage erzeugt, wie ich sie aus dem P1 in München kenne, dem bekanntesten Club der Stadt, wo ich in meinen wilden Jahren mal als Türsteher gearbeitet habe.
Natürlich kann ich in Elsfleth nicht alles üben. Wie wir im Ernstfall mit unserem Flugzeug auf dem Wasser landen? Das müssen wir irgendwie hinbekommen: sanft auf den Wellen aufsetzen, Fahrwerk drinnen lassen – und beten, dass alles gut geht.
Es ist Mitte März. Die Zeit der Vorbereitung hat begonnen. Bisher allerdings haben wir nicht einmal ein Flugzeug. Unser Vorhaben fühlt sich ein wenig irreal an, obwohl wir bereits im August starten wollen. Dann plötzlich, es ist noch im März, schickt Wolf mir eine Mail. Aufgeregt schreibt er vom Kauf eines Flugzeugs: „Ich habe es gekauft. Wow. Was habe ich gemacht?!?!“ Wochenlang hat er sich informiert, welches gebrauchte Kleinflugzeug für uns das Beste wäre, hat sich umgeschaut, anfangs in Deutschland, später in den USA. Nach Minnesota und Florida ist er gereist und hat die Mooney schließlich in Borne in Texas ausfindig gemacht.
Texas – das ist sein Heimatstaat. Wolf wurde in Dallas geboren, er ist Deutsch-Amerikaner, hat einen amerikanischen Pass. Sein Vater stammt, so wie ich, aus München und ist vor 50 Jahren in die USA ausgewandert. Wolfs Mutter wurde in den Niederlanden geboren, auch sie hat vor Jahrzehnten Europa verlassen. Allerdings besitzen seine Eltern nach wie vor eine Wohnung im Lehel, einem hübschen Münchner Stadtviertel, wo sie regelmäßig zu Besuch sind.
Auch Wolf hat es im Jahr 2000 nach Deutschland gezogen. In München hat er als Guide bei einem Unternehmen gearbeitet, das Sightseeing-Touren mit dem Fahrrad anbietet. Vier Jahre später hat er sich mit der gleichen Idee selbstständig gemacht und in Berlin, direkt am Alexanderplatz, ein eigenes Unternehmen für Fahrradtouren gegründet. Vor allem Rucksacktouristen aus aller Welt, Amerikaner, Australier, Briten, Israelis, Neuseeländer, sind Kunden von „Fat Tire Bike Tours“. Mittlerweile gibt es Ableger in Barcelona, London und Paris. Ein Geschäft wie gemacht für Wolf, den Vielreisenden, der sich auf der ganzen Welt zu Hause fühlt.
In seiner Mail schreibt Wolf, die Mooney sei „ein sehr schönes Flugzeug für unsere Reise“. Ich selbst bin bisher meist mit einer Cessna 182 RG geflogen, die ich mir regelmäßig auf einem kleinen Flugplatz in Jeesenwang ausleihe, was eine halbe Autostunde westlich von München liegt. Die Cessna ist ein Traktor der Lüfte: Sie ist gutmütig und verzeiht auch gröbere Fehler.
Doch selbst wenn wir Zusatztanks einbauen würden, könnte eine Cessna mit Kolbenmotor höchstens acht oder neun Stunden ohne Pause fliegen. Uns stehen aber weitaus längere Flüge bevor – oder Strecken mit mehreren Etappen, auf denen es für uns keine Möglichkeit geben wird, das Flugzeug zu betanken. Also entscheidet sich Wolf für die Mooney. Die ist schneller, spritziger, und mit ihr können wir auch deutlich höher fliegen als mit einer Cessna, bis auf 24000 Fuß, also auf umgerechnet 8000 Meter. Allerdings ist die Mooney auch wesentlich sensibler. „Maggie“, wie Wolf sie nennt, erwartet, dass man liebevoll und fürsorglich mit ihr umgeht. Sie ist eine echte Dame.
„Maggie“, die Mooney – das ist eine Alliteration ohne tieferen Sinn, aber mit einem schönen Klang. Der Name stammt von Caroline, die Wolf nach dem Flugzeugkauf noch in San Francisco besucht hat.
„Maggie“, die Mooney – sie soll uns um die Welt tragen. Wolf und mich. 80 Tage werden wir unterwegs sein. Diese Zahl hat sich bei uns eher zufällig ergeben, aber es war, als wir die Dauer unserer Reise ein paar Wochen vor dem Start erstmals überschlugen, ein schöner Zufall. 80 Tage – so lange war auch Phileas Fogg unterwegs, der britische Gentleman aus dem berühmten Roman von Jules Vernes. In meiner Jugend habe ich das Buch „In 80 Tagen um die Welt“ regelrecht verschlungen. In den Wochen vor unserer Erdumrundung denke ich immer wieder daran. Fogg ist damals ohne jede Vorbereitung aufgebrochen. Er hat sich einfach auf den Weg gemacht. Mit den Mitgliedern seines Londoner Herren-Clubs hatte er um 20000 Pfund Sterling gewettet, dass er in 80 Tagen die Welt umrunden werde. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das ein schier unglaubliches Vorhaben. Das Flugzeug war noch nicht erfunden, das Auto auch nicht; es gab nur Schiffe, Kutschen und die Eisenbahn. Seine Reise führte über den Suezkanal, Bombay, Kalkutta, Hongkong nach Japan, weiter über den Pazifik nach San Francisco, danach nach New York und von dort nach Irland und zurück nach London. Nach seiner Rückkehr dachte Fogg zunächst, dass er seine Wette um wenige Minuten verloren habe. Doch dann stellte er fest, dass er unterwegs einen Tag gewonnen hatte, weil er die Datumsgrenze in östlicher Richtung überquert hatte.
Wir dagegen reisen westwärts.
Und das bedeutet, dass wir meist gegen den Wind fliegen müssen, ein Nachteil. Westwärts: Das bedeutet aber auch, dass wir Zeit gewinnen, weil wir der untergehenden Sonne entgegenfliegen, ein Vorteil. Auf den Flügen, die durch mehrere Zeitzonen führen, können wir ein, zwei Stunden länger in der Luft bleiben, ehe uns die Dunkelheit zur Landung zwingt.
Aber wird das gut gehen? Werde ich mit Wolf klarkommen? Und er mit mir? Wir haben zwar den gleichen Traum, den wir beide mit der gleichen Zähigkeit, mit dem gleichen Elan verfolgen, aber wir sind noch nie miteinander geflogen, haben niemals länger Zeit miteinander verbracht. Kennengelernt habe ich Wolf erst vor wenigen Monaten, bei einem Pilotentreffen im September 2012 im hessischen Egelsbach. Angestoßen durch einen Aufruf in der Fachzeitschrift „Pilot und Flugzeug“ kamen damals rund 80 Piloten zusammen, die sich alle mit dem Gedanken trugen, um die Welt zu fliegen, und sich anhören wollten, was es an Vorbereitungen und Voraussetzungen bedarf, um eine solche Reise anzutreten. Die meisten entschieden sich am Ende dagegen.
Wie es der Zufall wollte, waren Wolf und ich die beiden Ersten, die damals am Flughafen Egelsbach ankamen. Ich stand ein wenig unruhig vor den noch verschlossenen Türen des Flughafen-Restaurants und wusste nicht, was mich in Egelsbach erwarten würde. Die Erdumrundung war für mich zu diesem Zeitpunkt nur ein vager Traum, von dem ich nicht wusste, wie ich ihn realisieren sollte. Ich hatte kein geeignetes Flugzeug, keinen Partner, nur diese fixe Idee im Kopf. Und dann stand plötzlich Wolf neben mir, und während des gemeinsamen Wartens merkten wir schnell, dass uns vieles verband: die Lust zum Abenteuer, die Liebe zum Fliegen – und auch die Liebe zu Autos. Wolf hatte auf dem Parkplatz gesehen, dass ich mit einem Mercedes SL nach Egelsbach gekommen war. Genau denselben Wagen fährt er in den USA. Nach dem Wirbelsturm Kathrina, der im August 2005 die Gegend um New Orleans zu weiten Teilen unter Wasser gesetzt hatte, war Wolf in den Besitz des völlig beschädigten Wagens gekommen. Sein Bruder, ein Hobby-Automechaniker, hatte den Mercedes anschließend restauriert.
In Egelsbach saßen Wolf und ich später an einem Tisch, redeten viel miteinander, fanden gleich einen Draht zueinander, und als ich erklärte, dass ich jemanden suchte, der mit mir um die Welt fliegen würde, sagte Wolf, er sei der richtige Mann. Und ich hatte das Gefühl: Ja, das ist er. Der richtige Partner für die Erdumrundung. Ein Flugzeug hatte ich noch immer nicht, aber Wolf sagte, er werde eines für uns finden, er wolle sich ohnehin eine Maschine kaufen. Ich war vollkommen perplex. Aus meinem großen Lebenstraum, dem Flug um die Erde, war plötzlich ein gemeinsamer Lebenstraum geworden: der Traum von Wolf und mir.
Aber manchmal trifft man ja Menschen im Leben, mit denen man sich sofort perfekt versteht – und bei Wolf und mir stimmte von Anfang an einfach alles. Jeder von uns war froh über die Stärken des anderen. Ich wusste: Wolf ist der erfahrenere Pilot, mit viel mehr Flugstunden. Ohne einen so erfahrenen Partner wäre ich – mit meinen gerade mal 250 Flugstunden – das Risiko dieser Reise niemals eingegangen. Wolfs Englisch ist – da er nun einmal in den Staaten aufgewachsen ist – viel besser als meines, weshalb er auch als Funker besser geeignet ist als ich. All das Knistern und Rauschen zwischen den oftmals nur schwer verständlichen Ansagen der Flugsicherheit macht ihm überhaupt nichts. Ich dagegen verstehe mich darauf, noch in der aussichtslosesten Situation jemanden aufzutreiben, der uns hilft. Ich knüpfe schnell Kontakte. Und lasse mich auch dann nicht unterkriegen, wenn ich irgendwo abgewiesen werde. Ein perfektes Team also, das sich bestens ergänzt.
Doch so gut wir zueinander passen, so sehr müssen wir uns auf unserem ersten gemeinsamen Flug, der Überführung von „Maggie“ nach Deutschland, zunächst aneinander gewöhnen. Zwei Monate vor dem Start unserer Erdumrundung holen wir das Flugzeug in den USA ab. Per Linie fliege ich nach New York und fahre dann nach Farmingdale auf Long Island, eine gute Autostunde östlich von New York, wo die amerikanische Luftfahrtbehörde eines ihrer Büros betreibt. Von Deutschland aus habe ich mir einen Termin geben lassen, um meinen Flugschein für die USA umschreiben zu lassen – andernfalls dürfte ich „Maggie“ in den USA nicht steuern. Auch ein paar Flugstunden zur Einweisung in eine Mooney musste ich in Deutschland nehmen.
In Farmingdale treffe ich Wolf. Ich bin ein wenig aufgeregt. Wie wird es wohl sein, mit Wolf zu fliegen? Wie wird es sein, mit ihm stundenlang in einer engen Kanzel zu hocken und gemeinsam über den Atlantik zu fliegen? Wolf kommt mit „Maggie“ aus der Nähe von Washington angeflogen, wo er seine Schwester besucht hat. Die Überführung von „Maggie“ nach Deutschland ist für uns beide nun die Gelegenheit, uns vor dem Start der Weltreise noch etwas besser kennenzulernen. Doch als ich das erste Mal das Steuer von „Maggie“ übernehme, wirkt Wolf ein wenig nervös – schließlich ist es seine Maschine. Er hat sie bezahlt.
Und erst recht wird Wolf unruhig, als ich in Westfield Barnes im Bundesstaat Maine eine hundsmiserable Landung hinlege. Das wiederum macht mich nervös, weshalb mir nach dem Flug über Kanada, Grönland, Island und Schottland die Landung in Berlin-Schönefeld nicht viel besser gelingt: „Maggie“ berührt den Boden, springt in die Luft, berührt mit den Reifen wieder die Landebahn, springt nochmals in die Luft, ehe ich sie endgültig aufsetzen kann. Mich ärgern diese beiden Patzer. Und ich weiß: Wenn ich vor Wolf als Pilot bestehen will (und wir gemeinsam unsere Weltreise ohne größere Spannungen hinbekommen wollen), muss ich besser werden, sicherer, ich werde pfleglicher mit „Maggie“ umgehen müssen.
Als mich Wolf etwa drei Wochen später anruft, höre ich einen vorwurfsvollen Ton in seiner Stimme: „Der Propeller ist kaputt.“ Offenbar haben die Propellerspitzen bei einer der Landungen den Boden berührt und einen Schlag abbekommen. Zwei, drei Zentimeter des Metalls sind abgeschabt worden, der Propeller hat sich zudem verzogen. Natürlich liegt der Verdacht nahe, dass ich den Schaden verursacht habe – bei meiner holprigen Landung in Berlin. Ich mache mir Vorwürfe, denn das Malheur gefährdet nun unsere gesamte Reise, es gefährdet auch mein Verhältnis zu Wolf. Aber es hilft nichts: Wir müssen den Propeller austauschen und zudem den Motor überprüfen lassen. Denn wenn der Propeller einen Schlag bekommt, kann das auch die Kurbelwelle beschädigen.
Als wir uns ein paar Tage später die Fotos anschauen, die wir nach meiner miesen Landung in Berlin aufgenommen haben, zeigt sich allerdings, dass der Propeller da noch heil war. Der Schaden muss also später entstanden sein. Nur wann? Vielleicht als Wolf die Maschine nach Straubing geflogen hat. Vielleicht auch auf andere Weise. Keine drei Wochen vor dem Start unserer Erdumrundung interessiert uns allerdings nur eines: dass „Maggie“ so schnell wie möglich repariert wird.
Also fahre ich mit meinem alten VW-Bus von Pullach am südlichen Stadtrand von München, wo ich wohne, eine Stunde raus nach Straubing, wo „Maggie“ steht, packe den Motor, den die Techniker dort ausgebaut haben, in den Laderaum und fahre zurück. Denn in einem Ort südlich von Pullach, in Baierbrunn, gibt es einen Mann, der uns aus der Patsche helfen kann: Heinz Dachsel, Eigentümer von „Flugmotoren Dachsel“.
Dachsel ist ein Bayer, wie er im Buche steht: gemütlich und gelassen, mit breiten Schultern und kräftigen Armen, mit buschigen Augenbrauen und einem schwarzen Wuschelkopf. Nichts, rein gar nichts bringt den 72-Jährigen aus der Ruhe. Er redet gemächlich, mit einem oberbayerischen Idiom, das unter seinem breiten Schnauzer hervorklingt. Seit über 20 Jahren betreibt er einen Reparaturbetrieb für Flugmotoren – und was für einen!
Dachsel und seine Mechaniker reparieren ausschließlich Kolbenmotoren. Die Kunden kommen aus aller Welt, da niemand sonst in Europa einen Prüfstand besitzt, auf dem auch große Kolbenmotoren problemlos getestet werden können. Die meisten Motoren, die zu „Flugmotoren Dachsel“ gebracht werden, sind viele Jahrzehnte alt, manche mehr als 70 oder 80 Jahre. Den Prüfstand haben sich die Mechaniker in Baierbrunn vor einigen Jahrzehnten selbst gebaut: In einer riesigen Halle steht der Turm eines U-Boots aus den 1930er-Jahren, und an diesen werden die großen Kolbenmotoren mit ihren bis zu vier Meter langen Propellern dann anmontiert, um sie nach der Reparatur viele Stunden lang zur Probe laufen zu lassen.
Fast 100 Mitarbeiter, zehnmal so viele wie heute, waren früher in der Werkstatt tätig und haben Zehntausende von Motoren repariert. Dann wurden die Kolbenmotoren nach und nach ausgemustert: bei der Bundeswehr ebenso wie in den Sportflugzeugen. Schnelle Turboprop-Maschinen kamen in Mode. Wir mit unserer Mooney gehören zu den Sonderlingen, die immer noch mit diesem altmodischen Motorentyp fliegen.
Aber Dachsel erweist sich noch aus einem anderen Grund als der richtige Mann. Vor vielen Jahren hat er selbst einmal versucht, die Welt in einem Flugzeug zu umrunden: in einer JU-52. Mit seiner „Tante Ju“, hergestellt in den 1930er-Jahren, ist er von München aus ostwärts geflogen. Leider war für ihn damals in Pakistan Schluss, da es unmöglich war, eine Genehmigung für den Weiterflug über Russland zu bekommen.
Schon ein paar Tage befindet sich unser Motor in Baierbrunn, als Dachsel mich anruft. „Kommen Sie mal her!“, sagt er knapp. Seine Stimme verheißt nichts Gutes. Ich setze mich sofort in mein Auto, fahre von Pullach nach Baierbrunn und stehe keine 20 Minuten später in der Werkhalle. „Schauen Sie sich bitte den Kolben an“, sagt Dachsel.
Vor mir liegt der Traum unserer Weltreise: fein säuberlich in einige Hundert Einzelteile zerlegt, ausgebreitet auf einem großen Servierwagen mit drei Ebenen. Die Techniker haben unseren Motor komplett auseinandergenommen. Ich muss nicht lange schauen, das Problem ist offensichtlich. Der fünfte Kolben in dem sechszylindrigen Motor ist kaputt, die Reibung im Zylinder hat ganze Teile der Außenwand weggefressen. Auch die andern fünf Kolben sind in einem desolaten Zustand.
„Ihr wärt damit wahrscheinlich nicht einmal über den Atlantik gekommen“, sagt Dachsel.
Puh! Nicht einmal über den Atlantik. Das heißt, wir hätten wohl recht bald nach dem Start einen kompletten Kolbenfresser gekriegt: Die Kolben hätten im Zylinder festgesessen, der Motor wäre zum Stillstand gekommen.
In diesem Moment habe ich alles wieder vor Augen. Die Notwasserung. Die Rettungsinsel. Den Ernstfall, den ich nie erleben will. Aber kurz darauf denke ich: Was für ein Glück im Unglück! Denn ohne den kaputten Propeller stünde ich jetzt nicht in der Werkstatt. Ohne den sichtbaren Schaden hätten wir den unsichtbaren Schaden an den Kolben niemals bemerkt. Wir wären mit einem Motor losgeflogen, der irgendwann seinen Geist aufgegeben hätte. Vielleicht mitten über dem Atlantik.
Dann denke ich an unseren Zeitplan. An den Abflugtermin in zwei Wochen. Ist der Motor bis dahin repariert? Kann Dachsel die notwendigen Ersatzteile so schnell beschaffen und alles wieder zusammenbauen? Oder müssen wir unsere Reise absagen? Denn in einigen Ländern wie Myanmar oder Indien haben wir uns vorher Visa besorgen müssen, und die sind zeitlich begrenzt; falls wir später losfliegen, wäre unser Zeitplan nicht mehr zu halten.
Ähnlich wäre es in Papua-Neuguinea. Um dort landen zu dürfen, habe ich immer wieder mit der Botschaft des Landes in Brüssel telefoniert. Habe meinen Pass samt Bargeld für die Visumgebühren dorthin geschickt, ohne ihn zurückzubekommen. Man teilte mir schließlich mit, ich müsse erst eine Landegenehmigung der Luftfahrtbehörde in Papua-Neuguinea herbeischaffen. Also habe ich mehrmals mit der Behörde in Port Moresby telefoniert, der Hauptstadt von Papua-Neuguinea, was schwierig war, weil meist niemand an den Apparat ging. Ich habe der freundlichen Dame, die ich nach allerlei Versuchen erreicht habe, dann den Antrag für eine Landegenehmigung gemailt, und zwar an ihre private Mailadresse, weil das Internet in der papua-neuguineischen Luftfahrtbehörde nicht so gut funktioniert. Den genehmigten Antrag habe ich dann nach Brüssel geschickt. Und von dort habe ich nach vielen Wochen dann mein Visum zurückerhalten.
Und das soll alles umsonst gewesen sein?
„Arbeiten Sie so schnell wie möglich!“, sage ich zu Heinz Dachsel. „Wir dürfen auf keinen Fall das Abflugdatum verpassen!“
„Wir schaffen das“, verspricht er.
Unsere gesamte Reise liegt nun in seinen Händen.
„Es ist ein sehr packend geschildertes Abenteuer von zwei mutigen Hobbypiloten, die mit ihrer Reise das geschafft haben, wovon viele nur träumen können.“
„Viel mehr Abenteuer geht wohl nicht. Einmal um die Welt in 80 Tagen mit einer einmotorigen Sportmaschine mit Kolbenmotor.“
„Ein riskantes Abenteuer, dessen Strapazen sich durch atemberaubende Eindrücke mehr als gelohnt haben.“


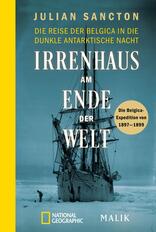

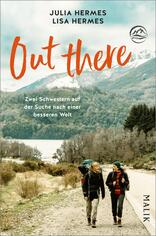








Sehr geehrter Herr Burges, ja ich bin ein Glückspilz, habe ich doch ein von Ihnen signiertes Exemplar o.g. Buches von "Fortuna" erhalten. Es war für mich sehr interessant ein so emotionales und ausführliches "Abenteuer" literarisch nachzulesen. Ich, Jahrgang 1938, bin mit 16 einige Jahre auf Handelschiffen zur See gefahren, mit einem 970 Tonner z.B. 1 1/2 Jahre "wilde Fahrt" 11 Mann Besatzung und habe in vieler Hinsicht Lebenserfahrungen gemacht. Kameradschaft, Demut vor der Natur und Respekt vor Menschen aus anderen Kulturen. Ich danke Ihnen für das vorliegende Buch, welches ich mit nur wenigen Unterbrechungen, durchgelesen habe. Ganz herzliche Grüße, auch an Ihre Familie Ihr Udo Kruse
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.