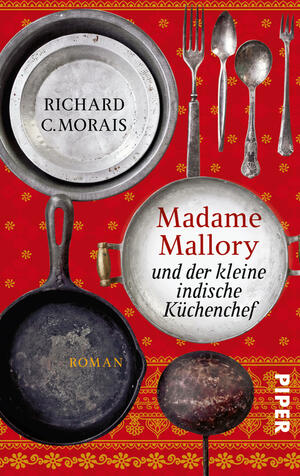
Madame Mallory und der kleine indische Küchenchef
Roman
„Ein Einstieg in die unbekannte Welt indischer Aufsteiger.“ - Basler Zeitung
Madame Mallory und der kleine indische Küchenchef — Inhalt
Seine früheste Erinnerung ist der Duft von scharfem Curry. Als Hassan Haji über einem turbulenten Imbissladen in Bombay das Licht der Welt erblickt, ahnt niemand, welch großes Talent in ihm schlummert. Erst Tausende Kilometer entfernt, in einem verschlafenen französischen Dorf, entdeckt der Junge seine Leidenschaft für die hohe Kunst des Kochens – und gerät mitten hinein in eine handfeste Restaurant-Fehde: Seiner indischen Großfamilie und ihrem lebhaften Lokal schlägt die offene Verachtung der alteingesessenen Madame Mallory entgegen, die genau gegenüber einen sternedekorierten Gourmettempel führt. Bis sie Hassans Gabe erkennt und anbietet, ihn in die Geheimnisse der gehobenen Küche einzuführen. Doch nur wenn der Lehrling die Straßenseite wechselt und bei ihr einzieht – in die Höhle der Löwin…
Leseprobe zu „Madame Mallory und der kleine indische Küchenchef“
Für Katy und Susan
Bombay
Kapitel
Eins
Ich heiße Hassan Haji und wurde als zweites von sechs Kindern über dem Restaurant meines Großvaters in der Napean Sea Road geboren, in einer Gegend, die sich damals West Bombay nannte, lange bevor die Megacity ihren alten Namen Mumbai zurückerhielt. Vermutlich wurde mein Schicksal in jenem ersten Moment besiegelt, denn meine früheste Sinneswahrnehmung war der Duft von Machli ka Salan, eines scharfen Fischcurrys, der durch die Ritzen zwischen den Dielenbrettern vom Restaurant zu meinem Kinderbettchen im Zimmer meiner [...]
Für Katy und Susan
Bombay
Kapitel
Eins
Ich heiße Hassan Haji und wurde als zweites von sechs Kindern über dem Restaurant meines Großvaters in der Napean Sea Road geboren, in einer Gegend, die sich damals West Bombay nannte, lange bevor die Megacity ihren alten Namen Mumbai zurückerhielt. Vermutlich wurde mein Schicksal in jenem ersten Moment besiegelt, denn meine früheste Sinneswahrnehmung war der Duft von Machli ka Salan, eines scharfen Fischcurrys, der durch die Ritzen zwischen den Dielenbrettern vom Restaurant zu meinem Kinderbettchen im Zimmer meiner Eltern aufstieg. Noch heute meine ich die kühlen Gitterstäbe des Bettchens auf meinem Babygesicht zu spüren, wie damals, als ich die Nase zwischen den Stäben hinausreckte, um dieses aromatische Duftbündel aus Kardamom, Fischköpfen und Palmöl zu erschnuppern, das mich trotz meines zarten Alters gleichsam erahnen ließ, welch unergründlicher Erfahrungsschatz in der freien Welt jenseits meiner Stäbe darauf wartete, entdeckt oder besser gesagt gekostet zu werden.
Doch ich will von vorn beginnen. 1934 kehrte mein Großvater als junger Mann der Provinz Gujarat den Rücken und gelangte auf einem Waggondach der Dampfeisenbahn nach Bombay. Heutzutage entdecken in Indien zahlreiche aufstrebende Familien auf wundersame Weise edle Wurzeln, zum Beispiel Verwandte, die seinerzeit Seite an Seite mit dem jungen Mahatma Gandhi in Südafrika gearbeitet haben, doch mit derlei vornehmen Vorfahren kann ich nicht aufwarten. Wir waren arme Muslime, Kleinbauern aus dem staubigen Distrikt Bhavnagar, wo 1917 eine schlimme Braunfäule die Baumwollfelder zerstörte und meinem siebzehnjährigen Großvater keine andere Wahl ließ, als nach Bombay abzuwandern, in diese quirlige Metropole – seit jeher Anziehungspunkt für die kleinen Leute, die sich dort ein neues, besseres Leben erhofften.
Kurz und gut, die Weichen für mein späteres Berufsleben wurden also schon lange vor meiner Geburt mit der Hungersnot meines Großvaters gestellt. Und seine dreitägige Reise auf dem Dach der Dampfeisenbahn, an das er sich unter Lebensgefahr festklammerte, während die Dampflok unter der glühenden Sonne durch die indische Ebene tuckerte, war der nicht eben verheißungsvolle Beginn der langen Reise meiner Familie. Großvater sprach nie gern von seiner ersten Zeit in Bombay, doch ich weiß von Ammi, meiner Großmutter, dass er mehrere Jahre lang auf der Straße lebte und seinen kärglichen Lebensunterhalt durch das Ausliefern von Lunchpaketen an indische Angestellte verdiente, die damals in den Hinterzimmern der Verwaltung des Britischen Empire arbeiteten.
Um sich ein Bild von dem Bombay zu machen, das meine Geburtswiege war, sollte man sich während der Rushhour zum Victoria Terminus in Mumbai begeben. Dieser verkehrsreichste Bahnhof der Stadt spiegelt wie kein anderer Ort das Wesen indischen Lebens wider. Es gibt getrennte Abteile für Frauen und Männer, und Trauben von Pendlern hängen aus den Fenstern und Türen der Waggons, während die Züge ratternd auf den Gleisen in die Victoria und Churchgate Station einfahren. Die Waggons sind so überfüllt, dass nicht einmal mehr die Lunchpakete Platz finden, die dann in separaten Zügen außerhalb der Hauptverkehrszeit geliefert werden. Diese Lunchboxes – mehr als eine Million zerbeulte Blechdosen mit Deckel, die einen Geruch nach Daal, mit Ingwer gewürztem Kohl und Reis mit schwarzem Pfeffer verströmen und von treu sorgenden Ehefrauen auf den Weg gebracht wurden – finden, nachdem sie sortiert und auf Handkarren gestapelt wurden, mit äußerster Zuverlässigkeit ihren Weg zu sämtlichen Versicherungsangestellten und Bankkassierern in ganz Bombay.
Und genau das war die Aufgabe meines Großvaters. Er lieferte Lunchboxes aus.
Er war ein dabba-wallah. Nicht mehr. Und nicht weniger.
Großvater war ein ziemlich verdrießlicher Geselle. Wir nannten ihn Bapaji, und ich erinnere mich, wie er während des Ramadan kurz vor Sonnenuntergang auf der Straße vor dem Haus auf den Fersen kauerte, das Gesicht blass vor Hunger und Wut, und eine Bidi paffte, eine dieser indischen Zigaretten. Noch immer sehe ich ihn mit seiner dünnen Nase und den drahtigen Augenbrauen, seinem Käppi und seiner Kurta, beides fleckig, und seinem dünnen weißen Bart vor mir.
Nun, mürrisch hin oder her, er war für seine Familie ein verlässlicher Versorger. Mit dreiundzwanzig lieferte er täglich an die tausend Lunchboxes aus. Inzwischen arbeiteten vierzehn Boten für ihn, die – die wieselflinken Beine in einen Lungi gehüllt, den Männerrock armer Inder – mit ihren Karren durch die verstopften Straßen Bombays zuckelten und die Blechdosen zu den Verwaltungsgebäuden der Scottish Amicable und Eagle Star brachten, oder wie die Versicherungen und Banken alle hießen.
Es war 1938, wenn ich mich nicht irre, als er endlich Ammi nachkommen ließ. Die beiden waren schon mit vierzehn verheiratet worden, und so traf sie nach all den Jahren – eine winzige Kleinbäuerin mit öliger dunkler Haut und klimpernden, billigen Armreifen – mit dem Zug aus Gujarat ein. Auf den von einer Dampfwolke eingehüllten Gleisen kauerten die Gassenjungen rasch nieder, um ihr Geschäft zu verrichten, die Wasserträger priesen lauthals ihre Ware an und ein Strom müder Passagiere und Gepäckträger ergoss sich auf den Bahnsteig. Und ganz hinten, aus einem Waggon der dritten Klasse, stieg meine Ammi mit ihrem armseligen Bündel aus.
Großvater rief schroff ihren Namen und dann trotteten sie aus dem Bahnhofsgebäude hinaus, die brave Ehefrau vom Land in gebührendem Abstand zu ihrem Ehemann aus Bombay.
Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs bauten meine Großeltern im Slum hinter der Napean Sea Road ein kleines Schindelhaus. Bombay war das Hinterzimmer der Alliierten bei ihren Kriegsaktivitäten in Asien, und bald strömten Millionen von Soldaten aus aller Welt durch die Pforten der Stadt. Für viele Soldaten waren es die letzten friedlichen Tage, ehe sie sich in die heiß umkämpften Kriegsgebiete Burmas und der Philippinen begeben mussten. Ausgelassen tummelten sich die jungen Männer auf den Küstenstraßen Bombays, eine Zigarette im Mundwinkel, und beäugten neugierig die Prostituierten am Chowpatty-Strand.
Die Idee, den Männern kleine Mahlzeiten zu verkaufen, kam von meiner Großmutter Ammi, und mein Großvater willigte schließlich ein, neben dem Lunchbox-Lieferservice ein zweites Standbein zu errichten, eine mobile Imbiss-Kette in Form mehrerer Essensstände auf Fahrrädern. Und so hetzten diese Garküchenräder vom Juhu-Strand, wo sie die badenden Soldaten mit Snacks versorgt hatten, zur Churchgate Station, um sich dort in das allabendliche Gedränge zu mischen. Im Angebot hatten sie Zuckerwerk aus Honig und Nüssen, milchigen Tee und vor allem Bhelpuri, ein Gericht aus Puffreis, Chutney, Kartoffeln, Zwiebeln, Tomaten, Minze und Koriander, das in einer Zeitungstüte gereicht und üppig mit Gewürzen bestreut wurde.
Mmh, ein Gedicht, kann ich euch sagen, und es ist nicht weiter verwunderlich, dass diese Imbissstände auf Rädern ein kommerzieller Volltreffer wurden. Angespornt durch ihren Erfolg, rodeten meine Großeltern ein verlassenes Grundstück an der Napean Sea Road und eröffneten dort ein primitives Straßenrestaurant. Die Küche war mit einem US-Army-Zelt überdacht und bestand aus drei Tandori-Öfen und einer Reihe von Holzfeuern, über denen in eisernen Kadais Lamm-Masala schmorte. Im Schatten von Banyan-Bäumen stellten meine Großeltern Tische aus grob behauenem Holz auf und spannten ein paar Hängematten zwischen die Bäume. Großmutter engagierte Bappu, einen Koch aus einem Dorf in Kerala, und erweiterte so ihr nordindisches Repertoire durch Gerichte wie Zwiebel-Theal und scharfe, gegrillte Garnelen.
Soldaten, Seeleute und Flieger wuschen sich mit englischer Seife die Hände, in einem mit Wasser gefüllten Ölfass, und trockneten sie mit einem Handtuch ab, das man ihnen reichte, ehe sie es sich in einer Hängematte im Schatten eines Baumes bequem machten. Inzwischen waren einige Verwandte meiner Großeltern aus Gujarat zu den beiden gestoßen und verdingten sich als Kellner. Sie legten Holzbretter als behelfsmäßige Tische quer über die Hängematten und bestückten sie flink mit Schüsseln voller Hühnchenspieße, Basmatireis und Süßspeisen aus Butter und Honig. Wenn gerade mal wenig Betrieb herrschte, zeigte sich meine Großmutter in langem Hemd und Hose, der traditionellen Kleidung, die wir salwar kamiz nennen, und schlenderte zwischen den Hängematten umher, um mit den heimwehgeplagten Soldaten zu plaudern, die sich nach ihren Leibspeisen sehnten.
„Worauf haben Sie Lust?“, fragte sie. „Welches Gericht essen Sie am liebsten bei sich zu Hause?“
Die britischen Soldaten nannten die von ihnen so heißgeliebten Steaks mit Nierenpastete und schwärmten von dem heißen Dampf, der von der klumpigen Füllung aufstieg, sobald man die Teigkruste mit dem Messer zerteilte. Die Soldaten versuchten, einander in ihren Schwärmereien zu überbieten, und bald konnte man unter dem Zeltdach viele Ahs und Ohs vernehmen. Die Amerikaner, die den Briten in nichts nachstehen wollten, mühten sich redlich, die angemessenen Worte für ein Grillsteak zu finden, das von Rindern stammte, die auf den Sumpfweiden Floridas gegrast hatten.
Ausgerüstet mit diesem neuen Wissen, das sie auf ihren Rundgängen durch die Reihen der Gäste aufgeschnappt hatte, zog sich Ammi in die Küche zurück, um in ihren Tandori-Öfen Nachbildungen jener Gerichte zu kreieren, Interpretationen dessen, was sie vernommen hatte. Zum Beispiel ihre indische Variante eines Breadand-Butter-Puddings, den sie mit frisch geriebener Muskatnuss bestäubte und der sich zum Schlager unter den britischen Soldaten mauserte. Die Amerikaner hingegen, fand sie heraus, waren sehr angetan von einer in ein Naan-Brot eingeschlagenen Füllung aus Erdnusssauce und Mango Chutney. Und so dauerte es nicht lang und die Kunde von unserem Restaurant verbreitete sich von den Gurkhas bis zu den britischen Soldaten und von den Kasernen bis zu den Kriegsschiffen. Den ganzen Tag lang hielten Jeeps vor dem Zelt an der Napean Sea Road.
Ammi war eine bemerkenswerte Person, und mein Werdegang ist zum großen Teil ihr Verdienst. Es gibt nichts Exquisiteres als ihren Pearlspot, einen einheimischen Fisch, den sie in einer Sweet-Chili-Gewürzmischung wendete, in ein Bananenblatt einschlug und mit einem Tropfen Kokosnussöl in einer Tawa-Pfanne briet. O ja, dieses im Grunde deftige, aber zugleich raffinierte Gericht ist für mich der Gipfel indischer Kultur und Kochkunst, und alles, was ich im Laufe meiner Karriere gekocht habe, musste sich an der Leibspeise meiner Großmutter messen lassen.
Auch besaß sie die erstaunliche Fähigkeit, über die jeder gute Chefkoch verfügen muss – sich gleichzeitig mehreren Aufgaben widmen zu können. Meine Kindheit verbrachte ich zum Gutteil damit zuzuschauen, wie dieses zarte Persönchen barfuß über den irdenen Küchenfußboden hin und her flitzte, schnell ein paar Auberginenscheiben in Kichererbsenmehl wendete und sie dann im Kadai briet, einer kleinen wokähnlichen Pfanne, während sie gleichzeitig einen Koch in die Seite knuffte, mir eine Mandelwaffel reichte und meine Tante wegen irgendeines Missgeschicks ausschalt.
Kurz und gut, Ammis Straßenzelt entpuppte sich bald als Goldesel und bescherte meinen Großeltern ein kleines Vermögen, angehäuft durch die harte Währung, die eine Million Soldaten und Matrosen und Flieger auf ihrer Zwischenstation bei uns in Bombay daließen.
Mit dem Erfolg kamen auch die Probleme. Bapaji war ein notorischer Geizhals. Die ganze Zeit schrie er uns wegen der geringsten Kleinigkeit an, etwa, wenn man zu viel Öl auf den Tawa-Grill träufelte. Das Geld war ihm sozusagen zu Kopf gestiegen. Misstrauisch gegenüber Nachbarn und unseren Verwandten aus Gujarat, versteckte Bapaji seine Ersparnisse in Kaffeedosen und fuhr jeden Sonntag zu einem geheimen Ort auf dem Land, wo er seinen schnöden Mammon in der Erde vergrub.
Doch der eigentliche Durchbruch meiner Großeltern ereignete sich 1942, als die britische Verwaltung in ihrem Bemühen, Geldmittel für den Krieg zu beschaffen, Grundstücke in Bombay versteigerte. Die meisten befanden sich auf Salsette, der großen Insel, auf der Bombay errichtet wurde. Doch auch schmale Landstreifen und Parzellen auf der im Süden gelegenen Halbinsel Colaba kamen unter den Hammer. Und darunter: das verlassene Grundstück an der Napean Sea Road, das sich meine Familie ohne Genehmigung angeeignet hatte.
Für Bapaji – im Innersten noch immer ein einfacher Bauer – war Land wertvoller als Papiergeld. Und so grub er eines schönen Tages all die Dosen wieder aus der Erde und begab sich mit einem Nachbarn an der Seite, der des Lesens und Schreibens kundig war, zur Standard Chartered Bank. Mit der Unterstützung der Bank ersteigerte Bapaji das 1,6 Hektar große Grundstück an der Napean Sea Road. Er bezahlte 1.016 englische Pfund, zehn Shilling und acht Pence für ein Stück Land zu Füßen des Malabar Hill, heute eine der beliebtesten Gegenden der Stadt.
Dann, und erst dann, stellte sich bei meinen Großeltern der Kindersegen ein. Dank der zupackenden Hilfe mehrerer Hebammen kam am Abend der berühmten Munitionsexplosion im Hafen von Bombay mein Vater, Abbas Haji, zur Welt. Riesige Feuerbälle schossen in den Abendhimmel, gewaltige Explosionen ließen in der ganzen Stadt die Fenster erbeben, als meine Großmutter plötzlich einen markerschütternden Schrei ausstieß und mein Vater aus ihrem Schoß plumpste und mit seinem Gebrüll den Explosionslärm und die Schreie seiner Mutter noch übertönte. Wann immer Ammi uns diese Anekdote in ihrer typischen Art erzählte, mussten wir herzlich lachen, denn jeder, der meinen Vater kannte, stimmte zu, dass er keine bessere Kulisse für seine Geburt hätte wählen können. Tantchen, die zwei Jahre später geboren wurde, sollte unter wesentlich ruhigeren Umständen das Licht der Welt erblicken.
Es folgten die Unabhängigkeit und Teilung Indiens. Das genaue Schicksal meiner Familie in jenen unrühmlichen Jahren ist und bleibt wahrscheinlich für immer ein Rätsel, denn auf keine der Fragen, die wir Papa später stellten, bekamen wir eine zufriedenstellende Antwort. „Ach, wisst ihr, es waren schlimme Zeiten damals“, sagte er zum Beispiel, wenn wir ihn wieder einmal bedrängten. „Aber wir haben uns durchgeschlagen. Und nun hört endlich auf mit eurem Polizeiverhör und bringt mir meine Zeitung.“
Wir wussten nur, dass die Familie meines Vaters, wie so viele andere auch, auseinandergerissen worden war. Die meisten unserer Verwandten flohen nach Pakistan, doch Bapaji blieb in Bombay, wo er seine Familie im Keller eines Warenlagers versteckte, das einem befreundeten Geschäftsmann, einem Hindu, gehörte. Ammi erzählte mir einmal, dass sie damals tagsüber schliefen, weil sie des Nachts von den Schreien und grausamen Straßenkämpfen wach gehalten wurden, bei denen die verfeindeten Hindus und Muslime einander die Kehle aufschlitzten.
Tatsächlich war das Indien, in dem Papa aufwuchs, ein ganz anderes als das, welches sein Vater gekannt hatte. Großvater war Analphabet, Papa besuchte die örtliche Hauptschule, die freilich alles andere als elitär war, doch immerhin schaffte er es später auf die Hotelfachschule, eine polytechnische Oberschule in Ahmedabad.
Im Zuge der Schulbildung wurden althergebrachte Stammessitten über Bord geworfen, und so lernte Papa in Ahmedabad Tahira kennen, ein hellhäutiges Mädchen, das eine Buchhaltungsausbildung absolvierte – meine Mutter. Papa erzählte, er habe sich zuerst in ihren Duft verliebt. Er war in ein Buch aus der Bücherei vertieft, als ihm ein höchst berauschendes Aroma in die Nase stieg, eine Mischung aus Chapati- und Rosenwasserduft.
„Und das“, sagte er, „war deine Mutter.“
Eine meiner frühesten Erinnerungen an Papa ist, wie wir auf der Mahatma Gandhi Road standen und er fest meine Hand drückte, während er zum „Hyderabad“ starrte, einem damals äußerst beliebten Lokal. Gerade stiegen die steinreichen Banajis mit Freunden aus einem Mercedes aus, der von einem Chauffeur am Bordstein geparkt worden war. Die Frauen schnatterten mit schrillen Stimmen, gaben sich Küsschen und kommentierten gegenseitig ihre Gewichtsprobleme. Hinter ihnen stand ein Portier, ein Sikh, und riss schwungvoll die gläserne Restauranttür für die Ankommenden auf.
Das Hyderabad und sein Besitzer Uday Joshi, eine Art indischer Douglas Fairbanks junior, füllten regelmäßig die Klatschspalten der Bombay Times, und wann immer jener Name erwähnt wurde, fluchte mein Vater leise und raschelte aufgebracht mit der Zeitung. Obwohl unser eigenes Restaurant nicht in derselben Liga wie das Hyderabad spielte – unser Lokal war einfach und für jedermann, man bekam gutes Essen zu vernünftigen Preisen –, betrachtete Papa Uday Joshi als seinen größten Rivalen.
Und da stand mein Vater nun und sah zu, wie diese schicke Gesellschaft aus der Oberschicht in das Restaurant hineinschneite, um ein Mehndi zu zelebrieren, ein vorhochzeitliches Ritual, bei dem die Braut mit ihren Freundinnen auf Kissen thront und sich Hände und Füße kunstvoll mit Henna bemalen lässt. Bei dieser Gelegenheit gab es feines Essen, Live-Musik und reichlich gewürzten Tratsch. Und garantiert noch mehr Schlagzeilen für Joshi.
„Schau“, sagte Papa, „Gopan Kalam.“
Er kaute auf einer Schnurrbartspitze und knetete mit seiner feuchten Pranke meine Hand. Seinen Gesichtsausdruck werde ich nie vergessen. Es war, als hätten sich plötzlich die Wolken geteilt und als wäre ihm Allah persönlich erschienen. „Er ist Milliardär“, flüsterte Papa. „Sein Vermögen hat er mit Petrochemie und Telekommunikation gemacht. Da, sieh dir nur die Smaragde an, mit denen diese Frau behängt ist. Mein lieber Mann, sind das Klunker!“
Im selben Moment trat Uday Joshi durch die Glastür und mischte sich wie selbstverständlich unter die eleganten pfirsichfarbenen Saris und seidenen Nehru-Anzüge. Augenblicklich begannen die vier, fünf Zeitungsfotografen um seine Aufmerksamkeit zu buhlen, und von allen Seiten wurde er aufgefordert, hierhin und dorthin zu schauen. Joshi liebte bekanntermaßen alles Westliche, und so warf er sich in seinem schwarzen Pierre-Cardin-Anzug selbstbewusst vor den klickenden Kameras in Pose und ließ seine weißen Porzellankronen im Sonnenlicht aufblitzen.
Trotz meines zarten Alters zog mich der berühmte Gastronom in seinen Bann, als wäre er ein gefeierter Bollywood-Leinwanddarsteller. Ganz genau erinnere ich mich noch an das gelbe Seidenplastron, das er um den Hals trug, und seine luftig nach hinten toupierte silbrige Schmalzlocke, die zu fixieren wohl Unmengen von Haarspray gekostet hatte. Nie zuvor hatte ich eine elegantere Erscheinung gesehen.
„Schau ihn dir an“, zischte mir Papa zu, „nun schau dir bloß diesen kleinen aufgeplusterten Gockel an.“
Schließlich beschloss er, Joshis Anblick nicht eine Sekunde länger ertragen zu können. Er wandte sich abrupt um und zerrte mich hinter sich her, in Richtung des Suryodhaya-Supermarkts, um das Sonderangebot des Tages, ein Fünfzig-Liter-Fass mit Sonnenblumenöl, zu ergattern. Mit meinen acht Jahren hatte ich Mühe, mit seinem raschen Gang Schritt zu halten, während ihm die Kurta um die Beine flatterte.
„Hör mir gut zu“, brüllte er gegen den Verkehrslärm an. „Eines Tages wird der Name Haji in aller Munde sein und kein Hahn wird mehr nach diesem aufgeblasenen Schnösel krähen. Du wirst schon sehen. Frag dann die Leute, ob sie einen Uday Johsi kennen. ›Wer ist das?‹, werden sie antworten. ›Ich kenne nur die Hajis. Die Hajis‹, werden sie sagen, ›die sind eine vornehme, bedeutende Familie.‹“
„Der Roman beschreibt die Magie des Essens.“
„Ein Einstieg in die unbekannte Welt indischer Aufsteiger.“
„Köstlicher Lesegenuss, witzig und sensibel geschrieben.“
„Ein köstlicher Lesegenuss.“
„Wie dieser Guru der Aromen seinen Weg vom Lehrling zum Sternekoch beschreitet, das ist humorvoll erzählt, und die ein wenig chaotische indische Familie würzt mit ihren starken Charakteren diesen Roman zusätzlich.“
„Richard C. Morais schickt den Leser mit auf eine köstliche Reise durch Indien und Frankreich, bei der jedem das Wasser im Mund zusammenläuft.“







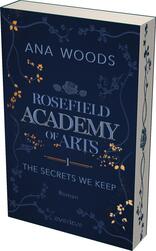






Hallo, zunächst einmal finde ich den roten Einband des Buches sehr ansprechend, so dass ich das Buch direkt kaufen musste! Mir gefallen auch die Verzierungen auf den Einleitungsseiten zu den Kapiteln sehr. Dieses sehr schöne Buch beschreibt die Lebensgeschichte von Hassan auf seinem Weg zum 3-Sterne-Koch auf sehr angenehme und absolut fesselnde Weise. Und auch meine Hungergefühle wurden während des Lesens geweckt, da die Beschreibungen der Gerüche und Gerichte in den verschiedenen Küchen sehr detailliert und ansprechend gestaltet war. Tolles Buch, ich empfehle es auf jeden Fall weiter! Viele Grüße, Olivia Plep
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.