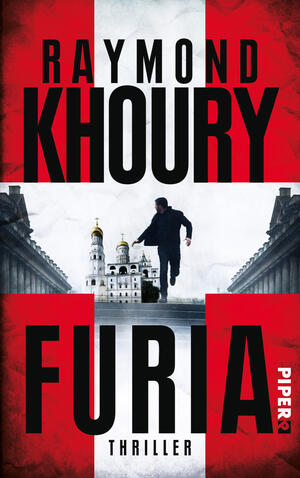
Furia (Sean Reilly)
Thriller
„Khoury mixt eine spannende Story mit viel Tempo, einer ordentlichen Zahl an Toten und Verletzten sowie einer Portion Romantik: große Leinwand für das Kino im Kopf!“ - Tiroler Tageszeitung
Furia (Sean Reilly) — Inhalt
Ein Angestellter des russischen Konsulats wird in New York aus einem Fenster gestoßen und stirbt. Was wollte er in der Wohnung des pensionierten Physiklehrers? Dieser scheint wie vom Erdboden verschluckt. Gemeinsam mit einer russischen Geheimdienstmitarbeiterin macht sich FBI-Agent Sean Reilly auf die Suche nach Leo Sokolov. Bald findet er heraus: Der Wissenschaftler ist ein anderer, als er jahrelang vorgab. Die mysteriöse Waffe in seinem Besitz ist unsichtbar und tödlich. In den falschen Händen wäre ihr Schaden unaufhaltbar. Doch Reilly ist nicht der Einzige auf Sokolovs Spur …
Leseprobe zu „Furia (Sean Reilly)“
Prolog
Ural, Russisches Reich, 1916
Als der schrille Schrei von den Wänden der Kupfermine widerhallte, spürte Maxim Nikolajew ein seltsames Kneifen im Kopf.
Der große Mann stellte seine Spitzhacke ab und wischte sich die Stirn. Langsam ließ der Schmerz wieder nach. Er holte tief Luft und füllte dabei seine bereits geschädigten Lungen mit noch mehr giftigem Staub. Doch das merkte er längst nicht mehr, es kümmerte ihn auch nicht. Im Moment dachte er nur an die Mittagspause, denn sein Arbeitstag hatte bereits um fünf begonnen.
Als die letzten Echos der Pfeife [...]
Prolog
Ural, Russisches Reich, 1916
Als der schrille Schrei von den Wänden der Kupfermine widerhallte, spürte Maxim Nikolajew ein seltsames Kneifen im Kopf.
Der große Mann stellte seine Spitzhacke ab und wischte sich die Stirn. Langsam ließ der Schmerz wieder nach. Er holte tief Luft und füllte dabei seine bereits geschädigten Lungen mit noch mehr giftigem Staub. Doch das merkte er längst nicht mehr, es kümmerte ihn auch nicht. Im Moment dachte er nur an die Mittagspause, denn sein Arbeitstag hatte bereits um fünf begonnen.
Als die letzten Echos der Pfeife nicht mehr zu hören und die Schar der Spitzhacken zur Ruhe gekommen waren, vernahm Maxim in der Ferne das Rauschen des Flusses Miass, draußen vor dem Eingang der offenen Mine. Es erinnerte ihn an seine Kindheit, als er noch ein kleiner Junge war und sein Onkel ihn zum Schwimmen an jenen abgeschiedenen Platz draußen vor Osiorsk mitnahm, weit weg vom dicken, fauligen Rauch, der Tag und Nacht aus den Schornsteinen der Schmelzhütte quoll.
Er dachte an den Duft der Kiefern, die so hoch waren, dass es aussah, als berührten sie den Himmel. Er vermisste die Ruhe dieses Ortes.
Den offenen Himmel und die reine Luft vermisste er noch mehr.
Eine Stimme hallte von etwas weiter weg durch den Tunnel: „Hey, Mamo, schaff deinen Hintern hier rüber. Wir spielen um einen Fick mit Pjotrs Tochter.“
Maxim hätte gern die Augen über Wassily verdreht, über den Spitznamen, den er hasste, und die allgemeine Dummheit des Mannes, aber der drahtige Kerl fühlte sich schon bei der leichtesten Provokation angegriffen, also lächelte Maxim stattdessen die Männer in der Gruppe an, legte sich die Spitzhacke über die breite, muskulöse Schulter und schlenderte zum Sitzplatz, an dem schon die drei anderen mudaks ihre gewohnten Plätze eingenommen hatten.
Er setzte sich neben den unglückseligen Pjotr und lehnte sein Werkzeug neben sich an die Wand. Maxim hatte die Tochter des Mannes nur einmal gesehen und fand sie in der Tat beeindruckend schön, aber er zweifelte nicht daran, dass sie jederzeit etwas Besseres bekommen könnte als jeden dieser armseligen Verlierer um ihn herum, die sich hier für einen mehr als mageren Lohn in den Tiefen der Erde abrackerten.
Maxim fischte einen Flachmann aus der Tasche – bei Strafe verboten – und nahm einen langen Schluck, dann wischte er sich den Mund mit einem schmierigen Ärmel ab. „Also los dann“, sagte er zu Wassily. Wenn es sowieso nicht zu ändern war, konnte er genauso gut versuchen, dem anzüglich grinsenden Idioten ein bisschen Geld abzuluchsen.
Stanislaw, der Erbärmlichste des Quartetts, fing an, gefolgt von Pjotr, dann Maxim. Dann kam Wassily an die Reihe. Er knallte die Faust auf eine eben umgedrehte Herzdame, erschütterte den wackeligen Holztisch, an dem die vier Männer saßen, und lehnte sich dann mit einem durchtriebenen Grinsen zurück.
Maxim zuckte nicht zusammen. Seine Gedanken schweiften bereits ab. Er spürte wieder ein seltsames Kribbeln im Kopf, wie ein leichtes Kitzeln ganz tief im Gehirn. Aus irgendeinem Grund dachte er, dass er Ochko nicht leiden konnte. Alle taten so, als ginge es dabei ums Können, wo man doch in Wirklichkeit bloß Glück brauchte. Durak spielte er viel lieber, ein Spiel, bei dem man scheinbar Glück brauchte, bei dem es aber in Wirklichkeit ums Können ging. In den siebenundzwanzig Jahren, die er dieses Spiel spielte, war er noch nie derjenige gewesen, der am Ende mit Karten in der Hand dagesessen hatte. Wahrscheinlich weigerte sich dieser Blutsauger Wassily deshalb, dieses Spiel mit ihm zu spielen.
Wassilys krächzende Stimme drang durch seine wirren Gedanken. „Komm schon, Mamo, zieh eine Karte, bevor wir hier alle verschimmeln.“
Maxim schaute nach unten und merkte, dass er seine ersten beiden Karten aufgedeckt hatte, ohne auch nur daraufzusehen.
Stanislaw deckte eine Kreuzsieben auf, die ihn wenig überraschend schon nach drei Karten aus dem Spiel warf, Pjotr hatte eine Pikzwei, was ihm neunzehn Punkte einbrachte. Nervös sah er zu Wassily, dessen Miene unverändert blieb. Der Mistkerl hatte mit achtzehn Punkten geführt. Dazu war er ein sehr schlechter Verlierer. Wassily bedeutete Maxim, er solle sich beeilen und ausspielen, wahrscheinlich, damit er dann eine Drei umdrehen und den kleinen Stapel Münzen in der Mitte des Tisches einstreichen konnte.
Maxim hatte wirklich keine Lust, ihn gewinnen zu lassen. Nicht heute. Nicht hier, und sonst auch nicht. Und als er gerade seine Karte aufdecken wollte, spürte er, wie sich ein stechendes Gefühl durch den hinteren Teil seines Schädels bohrte. Es dauerte kaum einen Atemzug an. Er schüttelte den Kopf, schloss kurz die Augen und schlug sie gleich wieder auf. Was immer es gewesen war, es war weg.
Er lugte auf seine Karte, dann blickte er Wassily an. Das sehnige Ekelpaket grinste schon wieder, und in dem Augenblick wusste Maxim, dass der Mann ein Betrüger war. Er wusste nicht, warum, aber er war todsicher.
Und nicht nur das, er sah ihn auch an, als hasste er ihn. Es war mehr als Hass. Abscheu. Verachtung.
Als wollte er ihn am liebsten umbringen.
Und da wurde Maxim klar, dass er Wassily sogar noch mehr verabscheute. Das Blut in seinen Adern hämmerte gegen seinen Schädel, aber er schaffte es noch, die Karte umzudrehen. Er beobachtete, wie Wassily den Blick senkte, um zu sehen, was es war. Eine Karofünf. Maxim war auch aus dem Spiel. Wassily grinste ihn spöttisch an und deckte seine eigene Karte auf. Herzvier. Zu viel. Er hatte gewonnen.
„Wie wir, moi ljubimyi“, sagte Wassily fies grinsend und streckte die Hand aus, um seinen Gewinn einzustreichen. „Vier Herzen, die wie eines schlagen.“
Maxims Hand schoss vor, um Wassily aufzuhalten, aber im selben Augenblick drehte sich Stanislaw würgend vom Tisch weg und übergab sich auf die Stiefel des Betrügers.
„Baaah! Stanislaw, du Hurensohn!“ Wassily sprang auf und machte einen Satz nach hinten, weg von dem würgenden Mann, dann zog ein gepeinigter Ausdruck über sein Gesicht. Er stolperte über die Kiste, auf der er gesessen hatte, und ging zu Boden, wobei er sich den Kopf anschlug, den Tisch umwarf und die Karten durch die Luft wirbeln ließ.
Pjotr schoss ebenfalls hoch, kochend vor Wut. „Vier? Welche Vier? Ich seh hier keine Vier. Du dreckiger Betrüger.“
Maxim sah wieder zu Stanislaw hinüber, dessen Augen inzwischen blutunterlaufen waren, als hätte das Würgen alle Blutgefäße in seinem Gesicht zum Platzen gebracht, und Maxim wusste, wusste ganz sicher, dass Stanislaw genauso falschgespielt hatte. Hatten sie alle, die Schweine. Sie wollten ihn abzocken – und dann wollten sie ihm wehtun.
Wie zur Bestätigung brach Wassily in Lachen aus. Nicht einfach nur ein Lachen, nein, es war ein dämonisches, aus der Tiefe aufsteigendes Lachen voll Verachtung und Spott und – da war sich Maxim sicher – Hass.
Maxim starrte ihn an, ohne sich vom Fleck rühren zu können, spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach, wusste nicht, was er tun sollte …
Er sah, wie Wassily einen Schritt auf ihn zu machte – er sah wirklich ganz und gar nicht gut aus –, dann verdrehten sich die Augen des Mannes, und er blieb wie angewurzelt stehen.
Pjotr hatte Maxims Spitzhacke in Wassilys Hinterkopf versenkt.
Maxim taumelte zurück, während Wassily ihm vor die Füße kippte und sich ein Schwall Blut aus seinem Schädel ergoss. Der Schmerz in seinem Hinterkopf kehrte zurück, schärfer als zuvor. Eine durchdringende Angst ergriff ihn. Er würde der Nächste sein. Das wusste er ganz bestimmt.
Sie würden ihn umbringen, wenn er sie nicht zuvor umbrachte.
Noch nie in seinem ganzen Leben hatte er etwas so sicher gewusst.
Während auch in den anderen Abschnitten der Mine wütende Schreie ausbrachen, stürzte er sich auf Pjotr, wehrte seinen Arm ab, griff nach der Spitzhacke und fing an, mit dem mörderischen Betrüger darum zu ringen. Im schummerigen Licht der einzelnen, schmuddeligen Laterne sah er aus dem Augenwinkel Stanislaw, der wieder auf den Beinen war und ebenfalls nach seiner Hacke griff. Alles verschwamm in einem Wirbel aus Klauen und Hieben und Schreien und Schlägen, bis Maxim etwas Warmes zwischen seinen Händen spürte, etwas, das er unter allen Umständen zerquetschen musste, bis sie sich in der Mitte trafen, und als sein Blick sich klärte, sah er, wie das augenlose, blutige Gesicht des armen Pjotr sich tief violett verfärbte, bevor er dem Kerl das Genick brach.
Um ihn herum war die Luft plötzlich erfüllt mit Schreien und dem Geräusch von Stahl, der in Fleisch und Knochen hackte.
Maxim lächelte und schöpfte ganz tief Atem. Noch nie hatte er etwas so Schönes gehört – da blitzte am Rand seines Gesichtsfeldes etwas auf.
Er wich nach hinten aus, während die Axt auf seinen Hals zuschwang, und fühlte den Luftzug auf dem Gesicht. Dann rammte er seinem Angreifer eine Faust in die Rippen und gleich danach die nächste. Etwas zerbrach. Er trat hinter den stöhnenden Mann und legte ihm den Arm um die Kehle – es war Popow, der Schichtleiter, der die ganze Zeit, in der Maxim hier arbeitete, nicht ein Mal die Stimme erhoben hatte – und begann, ihm die Luft abzudrücken.
Popow fiel zu Boden wie ein Sack Rote Bete.
Maxim schnappte sich die Axt aus der Hand des Toten und grub sie ohne Zögern in Stanislaws Gesicht, der jedoch bereits die Hacke, die er in Händen hielt, halb erhoben hatte, um sie gegen Maxims Brust zu schwingen. Maxim versuchte noch, ihr auszuweichen, doch die Hacke traf ihn und riss ihm ein großes Stück Fleisch aus der Seite.
Stanislaw taumelte rückwärts und stürzte, die Axt ins Gesicht gegraben.
Maxim sackte auf die Knie und fiel dann vornüber, griff mit beiden Händen in sein zerfetztes Fleisch und versuchte, die klaffenden Ränder der Wunde zusammenzudrücken.
Da lag er, wand sich auf dem Boden, während der Schmerz durch ihn hindurchschoss, die Hände in seinem eigenen Blut gebadet, und erhaschte einen flüchtigen Blick in den Schacht. In dem trüben Licht konnte er kaum die Umrisse der anderen mudaks überall in den Tunneln ausmachen, die wild aufeinander einhackten.
Er sah auf die Wunde in seiner Seite herunter. Sein Blut rann ihm durch die Finger und ergoss sich pulsierend auf den Dreck des Minenbodens. Während um ihn herum die Todesschreie hallten und die Minuten verstrichen, starrte er weiter darauf, wie betäubt, seine Gedanken wirbelten in einem Mahlstrom der Verwirrung davon – da durchbrach eine mächtige Explosion die Luft hinter ihm.
Die Wände erbebten, und Staub und Felsbrocken regneten auf ihn hinab.
Drei weitere Explosionen folgten, schleuderten alle Laternen aus ihren Halterungen und tauchten die sowieso schon düsteren Tunnel in absolute Schwärze.
Ganz kurz herrschte tödliche Stille – dann folgten ein kalter Luftzug und ein drängendes Rauschen.
Ein Rauschen, das zu einem Brüllen wurde.
Maxim starrte in die Dunkelheit. Er sah die Wasserwand nicht mehr, die mit ungeheurer Gewalt auf ihn traf und ihn mit sich riss. Doch in jenen letzten Sekunden des Bewusstseins, jenen letzten Momenten, bevor das Wasser in seine Lungen drang und die Wucht der Flut ihn gegen die Tunnelwand schleuderte, dachte Maxim Nikolajew an seine Kindheit und wie friedlich es sein würde, wenn er an den Fluss seiner Jugend zurückkehrte.
Am Sprengkasten neben dem Eingang des Schachtes stand der Forscher und lauschte, bis die Stille in den Berg zurückgekehrt war. Er zitterte sichtlich, wenn auch nicht vor Kälte. Sein Begleiter hingegen war unnatürlich ruhig und heiter, was den Wissenschaftler noch stärker schaudern ließ.
Sie hatten diese lange Reise zusammen unternommen, aus der fernen Abgeschiedenheit eines sibirischen Klosters an diesen ebenso verlassenen Ort. Eine Reise, die vor vielen Jahren mit großartigen Versprechungen begonnen hatte, die sie seither jedoch auf wildes, verbrecherisches Territorium geführt hatte. Der Gelehrte konnte es nicht genau sagen, wie sie an diesen Punkt ohne Wiederkehr geraten waren, wie es letztendlich zu diesem Massenmord gekommen war. Und während er seinen Begleiter anstarrte, überkam ihn die Furcht, dass dies hier erst der Anfang war.
„Was haben wir getan?“, murmelte er, und er verspürte Angst, während die Worte sich über seine Lippen stahlen.
Sein Begleiter wandte sich ihm zu. Für einen Mann von so viel Macht und Einfluss, einen Mann, der ein intimer Freund und Vertrauter des Zaren und der Zarin war, war er ungewöhnlich gekleidet. Eine alte, speckige Jacke mit abgewetzten Aufschlägen. Weite Hose mit tief hängendem Schritt, wie bei den Pluderhosen der Türken. Die geölten Stiefel eines Bauern. Dann waren da der ungepflegte, verfilzte Bart und das fettige Haar, mit einem Mittelscheitel wie bei einem Kneipenkellner. Der Wissenschaftler wusste, dass all dies nicht echt war, sondern zu einem wohlkalkulierten Erscheinungsbild gehörte. Einem Erscheinungsbild, das listig entworfen war, um einem größeren Plan zu dienen, einem Plan, den der Forscher möglich gemacht hatte und dessen Komplize er geworden war. Ein Kostüm, das die Demut und Bescheidenheit eines wahren Gottesmannes vermitteln sollte. Eine so schlichte Tracht, dass sie unmöglich in irgendeiner Weise von dem hypnotischen graublauen Blick ihres Trägers ablenken konnte.
Dem Blick eines Dämonen.
„Was wir getan haben?“, echote sein Begleiter in seiner seltsam schlichten, beinahe urtümlichen Art zu sprechen. „Ich werde dir sagen, was wir getan haben, mein Freund. Du und ich … wir haben gerade die Rettung unseres Volkes gesichert.“
Wie immer in Gesellschaft des anderen spürte der Wissenschaftler, wie ihn eine dumpfe Schwäche überkam. Er konnte nur noch dastehen und nicken. Doch als er anfing zu begreifen, was er eben getan hatte, senkte sich erstickende Düsternis auf ihn herab, und er fragte sich, was für entsetzliche Dinge noch vor ihm liegen mochten, Schrecken, die er sich damals in jenem abgeschiedenen Kloster im Traum nicht hätte ausmalen können, wo er zum ersten Mal dem rätselhaften Landmann begegnet war. Wo der Mann ihn vom Äußersten zurückgeholt hatte, ihm die Wunder seiner Gabe gezeigt und ihm von seinen Wanderungen zu tief in den Wäldern verborgenen Klostern erzählt und von den Überzeugungen berichtet hatte, zu denen er dort gekommen war. Wo der Mystiker mit dem stechenden Blick ihm zum ersten Mal von der Ankunft des „wahren Zaren“ erzählt hatte, eines gerechten Regenten, eines Erlösers des einfachen Volkes. Eines Retters des Heiligen Russland.
Einen Wimpernschlag lang fragte sich der Forscher, ob er wohl jemals in der Lage sein würde, sich dem Griff seines Mentors zu entziehen und den Irrsinn zu verhindern, der mit Sicherheit bevorstand. Doch so schnell, wie der Gedanke an die Oberfläche seines Bewusstseins gedrungen war, so schnell war er auch wieder fort, erstickt, bevor er auch nur Gestalt annehmen konnte.
Er hatte noch nie erlebt, dass irgendjemand Grigori Rasputin irgendetwas verweigert hätte.
Und er wusste, mit schmerzlicher Gewissheit, dass seine Willenskraft bei Weitem nicht ausreichte, um der Erste zu sein, dem dies gelang.
Queens, New York City
Gegenwart
Der Wodka schmeckte nicht besonders, nicht mehr, und dieser letzte Schluck hatte in seiner Kehle wie Säure gebrannt, was ihn allerdings nicht daran hinderte, nach mehr zu verlangen.
Es war ein schlechter Tag für Leo Sokolow.
Ein schlechter Tag in einer ganzen Reihe schlechter Tage.
Er riss den Blick von dem an der Wand montierten Fernseher los und gab dem Barmann ein Zeichen zum Nachschenken, dann schaute er wieder zu der Livesendung aus Moskau hin. Bitterkeit wühlte ihn auf, als die Kamera auf den Sarg zoomte, der in die Erde hinabgelassen wurde.
Der Letzte von uns, klagte er in zornigem Schweigen. Der Letzte … und der Beste.
Der Letzte aus der Familie, die ich ausgelöscht habe.
Das Bild teilte sich, um noch eine weitere Übertragung zu zeigen, vom Manegenplatz, wo Tausende von Demonstranten vor den Mauern und Türmchen des Kremls wütend protestierten. Direkt unter den Nasen derjenigen, die diesen mutigen, anständigen … diesen großartigen Mann ermordet hatten.
Ihr könnt so viel schreien und brüllen, wie ihr wollt, dachte er wütend. Was kümmert die das? Was sie ihm angetan haben, würden sie jederzeit wieder tun, und sie werden es auch jedes Mal wieder tun, wenn jemand es wagt, das Wort gegen sie zu erheben. Denen ist es doch egal, wie viele sie töten. Für die sind wir doch alle nur … Er erinnerte sich an die mitreißenden Worte des Mannes.
Wir sind alle nur Vieh.
Eine tiefe Traurigkeit durchflutete ihn, als die Kamera zu einer Nahaufnahme einer trauernden Mutter schwenkte, ganz in Schwarz, die mit aller Kraft versuchte, sich würdig und stolz zu zeigen, obwohl sie genau wusste, da war sich Sokolow sicher, dass ihr jeder Anflug von Protest erbarmungslos ausgetrieben werden würde.
Seine Finger klammerten sich fester um das Glas.
Im Unterschied zu anderen Oppositionsführern war der Mann, der da begraben wurde, weder ein machtgieriger Egomane gewesen noch ein gelangweilter Oligarch, der seinem noch prunkvollen Leben eine weitere Trophäe hinzufügen wollte. Ilja Schislenko war kein nostalgischer Kommunist, kein sendungsbewusster Umweltschützer oder wilder Linksradikaler gewesen. Er war einfach ein ganz normaler, besorgter Bürger, ein Anwalt, der fest entschlossen versucht hatte, die Dinge in Ordnung zu bringen. Und wenn schon nicht, ganz in Ordnung zu bringen, so doch, sie zumindest besser zu machen. Der gegen die Mächtigen kämpfte, die, die er öffentlich als die Partei der Lügner und Diebe gebrandmarkt hatte – ein Etikett, das sich mittlerweile fest in den Geist derjenigen eingebrannt hatte, die gegen die Regierung arbeiteten. Der gegen die ungezügelte Korruption und Veruntreuung kämpfte, um diejenigen loszuwerden, die jene entmachtet hatten, die das Land über Jahrzehnte versklavt hatten, jene, die jetzt mit einer vergoldeten Klinge statt mit eiserner Faust regierten, jene, die den unermesslichen Reichtum des Landes geplündert und ihre Milliarden in London und Zürich gebunkert hatten. Der sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte, um seinen Mitbürgern etwas von der Würde und der Freiheit zu schenken, die viele ihrer Nachbarn in Europa und überall auf der Welt genossen.
Wie stolz Sokolow gewesen war, als er zum ersten Mal von ihm gelesen hatte. Es hatte seiner matten, dreiundsechzig Jahre alten Lunge frisches Leben eingehaucht, diesen charismatischen jungen Mann in den Nachrichten zu sehen, die begeisterten Reportagen über ihn in der New York Times zu lesen, seine mitreißenden Reden auf YouTube zu hören, zuzusehen, wie die Protestbewegung, die er anführte, wuchs und wuchs, bis das Unerhörte geschah und Zehntausende zorniger Russen aller Altersgruppen und Schichten es wagten, sich bei eisigen Temperaturen und der Miliz zum Trotz auf dem Bolotnajaplatz und überall in der Stadt zu versammeln, um seine Worte zu hören und ihre Zustimmung herauszuschreien und zu zeigen, dass sie genug davon hatten, wie hirnlose Leibeigene behandelt zu werden.
Und als wäre es noch nicht begeisternd genug gewesen, seine Worte zu hören, als hätte, diese Menschenmengen zu sehen, sein Herz nicht schon höher schlagen lassen, so machte die Tatsache, dass dieser inspirierende Anführer, dieser außergewöhnliche und mutige Mann, dieser Retter der Retter, niemand anderes als der Sohn von Leos eigenem Bruder war, das alles noch atemberaubender. Sein Neffe, und abgesehen davon das letzte überlebende Mitglied seiner Familie.
Der Familie, die er selbst ausgelöscht hatte.
Die Fernsehbilder zeigten jetzt eine Rückschau auf die letzte Rede seines Neffen, ein Bericht, den Sokolow plötzlich kaum noch mitansehen konnte. Wenn er die selbstsicheren Züge des jungen Mannes und die unwiderstehliche Energie, die er ausstrahlte, sah, konnte Sokolow nicht anders, als sich vorzustellen, wie sich das geändert haben musste, nachdem er festgenommen worden war. Er konnte die Schrecken nicht ausblenden, die über den Mann gekommen sein mussten. Wie so oft, seit die Nachricht von seinem Tod über ihn hereingebrochen war, konnte er nicht aufhören, sich seinen Neffen vorzustellen – dieses wunderschöne, strahlende Leuchtfeuer von einem Mann –, wie er in irgendein dunkles Loch im Lefortowo-Gefängnis geworfen worden war, jenem nichtssagenden, senfgelben Block unweit des Moskauer Zentrums, in dem seit den Tagen des Zaren Staatsfeinde eingekerkert wurden. Er wusste alles über die schmutzige Vergangenheit des Gebäudes, darüber, wie Dissidenten hier durch Nasensonden zwangsernährt worden waren, um sie gefügiger zu machen. Er wusste von seinen Folterkellern und den „psychologischen Zellen“ mit ihren schwarzen Wänden, der einzelnen 25-Watt-Birne, die rund um die Uhr eingeschaltet von der Decke hing, und den ständigen, irremachenden Erschütterungen, die vom benachbarten Institut für Hydrodynamik herüberdrangen, sodass man kaum einen Becher auf dem Tisch abstellen konnte, ohne dass er früher oder später herunterrutschte. Er wusste auch von dem überdimensionierten Fleischwolf, in dem die Leichen seiner Opfer zerkleinert wurden, bevor man sie in die städtischen Abwasserkanäle spülte. Alexander Solschenizyn war hier eingekerkert gewesen, ebenso wie der ehemalige KGB-Agent Litwinenko, dem man einen kettenrauchenden Informanten als Zellengenossen zugewiesen hatte – eine kleine Aufmerksamkeit seines früheren Arbeitgebers, der wusste, wie sehr er Zigarettenrauch verabscheute –, bevor man ihn durch mit Polonium verseuchten Tee ermordete, nachdem er nach seiner Entlassung in London Zuflucht gefunden hatte.
Die Ermordung seines Neffen war nicht annähernd so ausgeklügelt gewesen. Dennoch, das wusste Sokolow, zweifellos wesentlich schmerzhafter.
„Khoury mixt eine spannende Story mit viel Tempo, einer ordentlichen Zahl an Toten und Verletzten sowie einer Portion Romantik: große Leinwand für das Kino im Kopf!“
„Als Leser taucht man schon nach kurzer Zeit hinein in die Geschichte und kann von dem spannenden Fall nicht genug bekommen. Interessant aufgebaut und wie immer hervorragend erzählt.“
„Der Roman erreicht zuweilen eine Intensität, für die man selbst einen mit allen Wassern gewaschenen Profi wie Raymond Khoury gesondert loben muss!“
„Starke Nerven sind notwendig und eine Gänsehaut garantiert.“


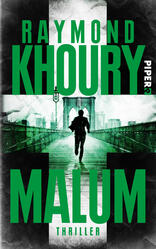
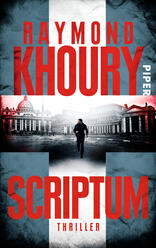




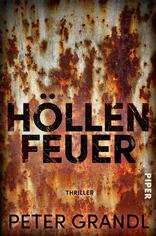



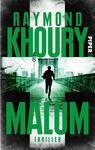


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.