
Ein Grab in den Wellen
Roman
„Das Debüt der US-amerikanischen Autorin Abby Geni entführt uns in Gefilde, die schon von den Indianern ›Insel der Toten‹ genannt wurden. Wobei die alten Spukgeschichten, die Geni in ›Ein Grab in den Wellen‹ erzählt, nur der Auftakt sind für das Grauen, das sich im Kampf mit den Naturgewalten offenbart.“ - Brigitte
Ein Grab in den Wellen — Inhalt
Ein psychologischer Spannungsroman voll suggestiver Kraft
Ein Jahr lang will die junge Naturfotografin Miranda auf den Farallon-Inseln verbringen, ein abgelegener, unbewohnter Archipel vor der kalifornischen Küste. Ihre einzigen Gefährten sind ein paar Wissenschaftler, die in dieser Wildnis Fauna und Flora untersuchen. Sie beobachten die Wale und Robben, die extrem aggressiven Haie, die in diesen Gewässern jagen, sowie die überwältigende Vogelpopulation. In dieser unwirtlichen Umgebung scheint es nicht verwunderlich, dass sie allesamt Eigenbrötler sind. Doch mit der Zeit mehren sich mysteriöse Unfälle, eines Tages wird sogar einer der Forscher tot aufgefunden. Und Miranda fragt sich allmählich, ob die Inselgruppe, die von den Indianern seit jeher „Insel des Todes“ genannt wird, tatsächlich verflucht ist, oder ob einer von ihnen ein grausames Spiel treibt ...
Leseprobe zu „Ein Grab in den Wellen“
PROLOG
Die Vögel stoßen ihren Kampfschrei aus, und Miranda sieht, wie ein Schwarm Möwen in ihre Richtung schwenkt. Glitzernde Schnäbel. Augen voller Wahnsinn. Sie hat oft genug erlebt, wie grausam diese Tiere sein können, und erkennt ihre Absicht. Die Möwen formieren sich zum Angriff und umkreisen sie wie Jagdbomber, die ihr Ziel anvisieren.
Miranda ist auf dem Weg zur Fähre. Sie geht schneller und läuft mit großen Schritten den Hügel hinauf, wobei der Rucksack auf ihren Schultern hin- und herschwingt. Die Fähre hat Verspätung, aber das überrascht [...]
PROLOG
Die Vögel stoßen ihren Kampfschrei aus, und Miranda sieht, wie ein Schwarm Möwen in ihre Richtung schwenkt. Glitzernde Schnäbel. Augen voller Wahnsinn. Sie hat oft genug erlebt, wie grausam diese Tiere sein können, und erkennt ihre Absicht. Die Möwen formieren sich zum Angriff und umkreisen sie wie Jagdbomber, die ihr Ziel anvisieren.
Miranda ist auf dem Weg zur Fähre. Sie geht schneller und läuft mit großen Schritten den Hügel hinauf, wobei der Rucksack auf ihren Schultern hin- und herschwingt. Die Fähre hat Verspätung, aber das überrascht Miranda nicht. Sie kommt immer zu spät. Das ist eines der wenigen Dinge, auf die man sich hier auf den Inseln verlassen kann.
Sie hört das Geplätscher der Wellen. Wie so oft während der Sommermonate liegt der Archipel auch heute unter einem Nebelschleier. Auf laue Nachmittage im goldenen Licht und Gelegenheiten für ein Sonnenbad wartet man hier vergeblich. Der Horizont liegt im Verborgenen, und die Sonne ist eine schummerige Scheibe. Miranda gerät ins Rutschen und schlittert über ein Geröllfeld. Auch wenn sie nur noch weg möchte, muss sie vorsichtig gehen und darauf achten, wo sie hintritt. Nester und kleine Küken hemmen jeden Schritt. Die Möwen bedecken den Boden wie eine dichte Schneedecke und nutzen jedes Fleckchen Gras und Felsgestein. In ihrer Mitte wirkt Miranda wie ein Fremdkörper, ein einsamer Baum, der aus einem weißen Feld herausragt.
Die Vögel sind alles andere als leise. Ihre Flügel rascheln. Die Küken schreien nach Futter, und die Eltern kreischen ungehalten zurück. Hin und wieder brechen Revierstreitigkeiten aus – dann fliegen Federn und Blut spritzt. Gegen diese besitzergreifende, blindwütige Angst ist auch Miranda nicht immun. Seit sie sich aus der Sicherheit des Hauses herausgewagt hat, lassen ein paar Möwen sie nicht mehr aus den Augen. Sie werden jetzt jeden Augenblick zuschlagen. Ihre Schwingen sind ausgebreitet, ihre Augen funkeln. Gleich wird es passieren.
Aber Miranda ist darauf vorbereitet. Sie hat dicke Lederhandschuhe übergestreift, um weniger Angriffsfläche für Schnabelbisse zu bieten. An den Handgelenken und Fußknöcheln trägt sie Flohkragen, damit ihr keine Vogelläuse unter die Kleidung krabbeln können. Über Mund und Nase hat sie sich zum Schutz gegen den intensiven Ammoniakgestank des Guanos eine Atemmaske gezogen. Und auf ihrem Kopf sitzt ein zu großer Schutzhelm, unter dem sie zur zusätzlichen Polsterung eine Strickmütze trägt. Außerdem hat sie sich einen Poncho übergeworfen, auf dem bereits reichlich schleimiger Vogeldreck klebt. Die Möwen feuern einen Klecks nach dem anderen wie zielgenaue Projektile auf sie ab. Sobald die Fähre da ist, wird sie alles ausziehen. Sie wird ihre Ausrüstung ablegen wie eine Spionin, die aus ihrer Verkleidung schlüpft, sich die Perücke vom Kopf zieht, die falschen Zähne herausnimmt und ihr Pistolenholster abschnallt, bevor sie vom Einsatzort verschwindet – und schon einen Moment später in der Menge untertaucht.
In dem Rucksack stecken all ihre Habseligkeiten. Ein paar Muscheln. Die Feder eines Papageientauchers, die sie als Glücksbringer behalten hat. Ein kleiner, sägeartiger Haizahn. Es kommt ihr merkwürdig vor, nach all der Zeit mit nicht mehr als einem Rucksack von hier zu verschwinden. Aber die Dinge halten hier nicht lange. Die Jeanshosen, die sie damals mitgebracht hatte, sind völlig zerrissen. Ihre Bücher sind stockfleckig. Das ergonomische Kopfkissen ist voller Mäusekacke. Die einzigen Gegenstände, die sie – mit einiger Anstrengung, wasserdichten Behältern, all ihrer Klugheit und höchster Wachsamkeit – retten konnte, sind drei Digitalkameras, eine Großformatkamera und mehrere Boxen mit unentwickelten Filmrollen. Ihre kostbarsten Schätze.
Sie hat diesen Ort in sämtlichen Stimmungen fotografiert, an klirrend kalten Wintersonnentagen ebenso wie während der wilden Herbststürme. Er besteht aus mehr als einem Dutzend kleiner Inseln, und Miranda hat sie alle auf Bildern festgehalten. Chocolate Chip als Silhouette vor dem glitzernden Ozean. Sugarloaf, der eine Art aufgeblähter Hügel ist. Die Drunk-Uncle-Inselchen, die ihre kahlen Köpfe aus der Brandung herausstrecken. Und auch die Leute hier. Die wenigen, die noch übrig sind. Von denen hat sie ebenfalls Aufnahmen gemacht.
Der Aufprall erfolgt ohne jede Vorwarnung. Eine Möwe kracht Miranda gegen die Schläfe und wirft sie beinahe um. Sie schreit auf, während ihr der Schutzhelm über die Augen rutscht. Flügel knallen ihr gegen die Schultern. Aber auch die Möwe kommt nicht unversehrt davon. Sie trudelt zu Boden und ist sichtlich benommen. Miranda bleibt nicht stehen. Zittrig und zerzaust setzt sie ihren Weg zum Wasser fort. Hier im Freien eine Pause einzulegen wäre keine gute Idee. Keuchend erklimmt sie die Klippe und erreicht schließlich die Felsspitze.
Vierzig Fuß vor der Küste erhebt sich eine undurchdringliche Nebelwand. Über dem Meer schweben Dunstfetzen. Sie sehen aus wie Rauchkringel, die von glühenden Kohlen aufsteigen. Miranda rückt den Schutzhelm zurecht. Im Moment halten die Vögel Abstand, sie formieren sich neu und überdenken die Lage. Ihr Kreischen klingt wie Drohungen und Warnrufe. Wie gefährliche Schatten kreisen sie am Rande ihres Sichtfelds am Himmel und schießen im Sturzflug herab.
Dann hallt das Dröhnen eines Motors über das Wasser. Bei all dem Lärm, den die Möwen veranstalten, ist es kaum zu hören. Während Miranda hinsieht, schiebt sich der Bug der Fähre durch das Nebelband. Ihr Auftauchen hat etwas Kühnes, als wäre sie ein Künstler bei einer Zaubershow. Das Schiff scheint aus eigener Kraft Gestalt anzunehmen, sich aus dem Nichts zu materialisieren, aus dem Nebel, aus Träumen. Beinahe gegen ihren Willen hebt Miranda beide Arme über den Kopf und winkt verzweifelt. Die Fähre ist noch zu weit weg, und sie kann nicht erkennen, ob Captain Joe zurückwinkt. Sie beobachtet, wie das Schiff durch die Brandung pflügt. Laut zeternd wirbeln die Möwen um sie herum. Sie haben noch nicht aufgegeben und werden sie ihre Bösartigkeit bis zum bitteren Ende spüren lassen. Miranda weiß, was sie mit ihr anstellen würden, wenn sie die Gelegenheit dazu bekämen. Sie kennt die Gefahren dieser Inseln. Besser als jeder andere.
Eine halbe Stunde später befindet sie sich an Bord der Fähre. Miranda lehnt sich an die Reling und spürt, wie ihr Magen sich im Rhythmus des schlingernden Decks hebt und senkt. Sie ist bereit, von hier fortzugehen, die Inseln zum ersten Mal seit einem Jahr zu verlassen. Obwohl sie erst zwanzig Fuß vom Ufer weg ist, liegt zwischen ihr und diesem Ort bereits eine ganze Welt. Captain Joe eilt über die Fähre und vollführt eine ganze Reihe geheimnisvoller Seemannshandgriffe, entrollt hier ein Tau, legt dort einen Hebel um und prüft die Festigkeit eines Riegels. Während die Fähre stampfend vom Ufer zurücksetzt, dreht sich der Ozean um sie herum. Die Landschaft sieht aus diesem Blickwinkel völlig verändert aus: Die Inseln wirken kleiner, der Nebel bildet einen weichen Vorhang, und die Vögel scheinen so zierlich und harmlos wie Papierkraniche. Miranda hält den Atem an. Sie ist es nicht mehr gewohnt, sich sicher zu fühlen.
Flohkragen, Poncho, Schutzhelm und Atemmaske hat sie abgelegt. Aber sie ist sich unangenehm bewusst, dass ihre Kleidung nicht gerade normal aussieht: Arbeitsstiefel mit Stahlkappen, eine Strickmütze und eine Männerjacke, die sie als Andenken hat mitgehen lassen. Außerhalb der Farallon-Inseln geht dieser Aufzug gar nicht. In Kalifornien wird man sie wahrscheinlich für eine Obdachlose halten. Vielleicht bekommen ein paar Passanten sogar Mitleid und stecken ihr Kleingeld zu. Wenn die wüssten …
Die Fähre pflügt durch das Wasser, und die Heckwelle zeichnet ihren Weg vom Ufer nach. Miranda nimmt sich vor, so lange zuzusehen, wie die Inseln in der Ferne verschwinden, bis sie vom Nebel verschluckt werden. Der Archipel ist bloß ein winziger Haufen Land, ein Fleck auf der Seekarte. Er besteht aus einer Ansammlung von Miniaturinseln. Südost-Farallon ist die einzige von ihnen, auf der Menschen leben können. Sie hat einen mit Pflanzen bewachsenen Sockel, auf dem die Hütte steht. Daneben gibt es noch einen Leuchtturm, die Boote und zwei kleine Bäume, die stolz dem Wind trotzen und kameradschaftlich ihre Wipfel zusammenstecken. Auf dem Rest dieser zentralen Insel verstreut finden sich sonst nur wenig bemerkenswerte Erhebungen aus nacktem Felsgestein, die von der Brandung derart glatt gespült und außerdem so dicht von Seepocken bedeckt sind, dass auf ihnen kein pflanzliches Leben möglich ist. Während sich die Fähre immer weiter vom Ufer entfernt, beißt sich Miranda auf die Lippe. Irgendwie hofft sie, doch noch jemanden dort am Rand der Klippe stehen zu sehen, der ihr nachblickt und zum Abschied zuwinkt. Aber nach allem, was geschehen ist, sollte sie es eigentlich besser wissen. Dort ist niemand. Die Inseln wirken verlassen. Schwarz und massiv zeichnet sich der Leuchtturm vor einem Wolkenband ab. Die Hütte liegt halb verborgen hinter dem Hang des Hügels und ist kaum noch zu sehen.
Die Wellenkämme steigen immer höher und heben das Schiff weiter aus dem Wasser. Dabei schwingt die Insel Saddle Rock ins Blickfeld. Auf ihr wimmelt es von Seelöwen. Einige dösen in dicht gedrängten Haufen, andere hüpfen ulkig über den Strand. Schon bald erreicht die Fähre den Nebel. Im Inneren des Ruderhauses hört man Captain Joe singen – eine fröhliche Melodie, die der Wind davonträgt. Miranda sieht zu, wie die Inseln allmählich gestaltlos und vage werden. Der Dunst nimmt ihnen alle scharfen Konturen und lässt ihre Umrisse verschwimmen. Einen Moment lang fühlt sie sich, als wäre sie selbst ein Boot, das an seiner Ankerleine zerrt. Während der letzten zwölf Monate hat eine Kette aus eisernen Gliedern sie an den Archipel gefesselt. Die Zeit an diesem Ort hat ihr genauso zugesetzt wie einem Schiff, das im Hafen vertäut liegt und von Ebbe und Flut angenagt wird – hin und her geworfen von den Wellen, der Rumpf leckgeschlagen, verdreckt, zerkratzt und kaum noch zu erkennen. Aber jetzt spürt sie, wie die Kette sich zu spannen beginnt und ächzt, weil sie über ihre Belastungsgrenze hinaus gedehnt wird. Und plötzlich scheint sie mit einem jähen Ruck zu zerreißen. Als das Ziehen aufhört, wird Miranda beinahe ohnmächtig.
Ein Jahr lang hat sie jeden Morgen gehört, wie Galen ausgiebig ins Waschbecken spuckt. Hat kichernd mit Charlene am Herd gestanden und Pfannen voll Lummen-Rührei mit allem gewürzt, was sie in der Vorratskammer finden konnten – in dem vergeblichen Versuch, das Frühstück etwas weniger nach Fisch schmecken zu lassen. Unzählige Male ist sie mit Mick um die Insel herumspaziert. Sie hat an der Vordertür gewartet und beobachtet, wie Forest sorgfältig seine Stiefel schnürt. Er braucht dafür zehn Minuten länger als alle anderen, so als hinge das Schicksal der ganzen Welt von der Präzision seiner Schleifen ab.
Miranda kennt all ihre Eigenheiten. Galens Lachen – mit geschlossenen Lidern, unzähligen Lachfältchen und so weit aufgerissenem Mund, dass man jede Zahnfüllung sehen kann. Lucy, die stundenlang im Schlaf summt, so laut, dass es alle in der Hütte hören können. Der Geruch von Andrews Schweiß, erdig und stechend. Sie kennt die genaue Spanne von Micks weißen Händen.
Sie wird keinen von ihnen jemals wiedersehen. Und irgendwie ist sie darüber froh.
Während der langen Überfahrt nimmt Miranda die Mütze ab und versucht, die Knoten aus ihren verfilzten Haaren zu bürsten. Außerdem wagt sie sich auf die schaurige Schiffstoilette. Dann überprüft sie ihre Fotoausrüstung. Manche Menschen geben ihren Autos Namen – geliebten Objekten, die für sie eine Persönlichkeit haben. Miranda macht dasselbe mit ihren Kameras. Ihr Lieblingskind heißt Juwel. Sie ist eine Großformatkamera mit genügend Einstellungsrädchen, um sowohl Galen als auch Forest zu verwirren, die beide immer wieder an ihr herumgespielt haben, sobald sie sich von Miranda unbeobachtet fühlten. Juwel ist ein Ungeheuer und hat Hunderte von Filmrollen fabriziert, die nun darauf warten, in der Dunkelkammer entwickelt zu werden. Die zweite Kamera heißt Charles und ist ein betagter Klassiker. Morgens und abends ist er am besten, wenn der Himmel golden ist und die Luft nur aus Licht zu bestehen scheint. Charles hat seine ganz eigene Sicht auf die Welt. Die anderen beiden (Gremlin und Fischgesicht) sind digitale Spiegelreflexkameras: einfach zu bedienen, protzig und unfassbar teuer. Miranda liebt jede von ihnen aus tiefstem Herzen. Sie ist ihnen eine gute Mutter und erinnert sich an all ihre „Geburtstage“, an denen sie sie gekauft hat.
Zwei ihrer Babys haben das letzte Jahr nicht überlebt. Ihre Namen waren Kater und Schurke. Sie sind den Inseln zum Opfer gefallen und nun für immer verloren.
Miranda geht ins wettergeschützte Deckshaus und setzt sich auf eine Bank. Der Nebel vor dem Fenster ist noch immer undurchdringlich und umhüllt die Fähre wie eine Lage Baumwolle. Die Welt jenseits des Schiffes ist auf akustische Eindrücke reduziert: ein Nebelhorn, plätschernde Wellen, der Schrei einer Möwe. Von so weit weg klingt er beinahe melodisch.
Sie greift in ihre Tasche und zieht einen braunen Briefumschlag hervor. Ein ziemlich dickes, knisterndes Ding. Sie dreht ihn um, und ein wahrer Schneesturm aus Papier fällt ihr in den Schoß. Darunter sind linierte Seiten aus einem Notizbuch und Druckerpapier, das beidseitig mit Mirandas enger Handschrift bedeckt ist. Dazu Millimeterpapier, Zellstoffpapier und Wachspapier, das sie aus der Küche entwendet hat. Mirandas Schrift auf alldem sieht ungewöhnlich gedrängt aus wie in Kolonnen marschierende Ameisen. Papier, ganz gleich welcher Art, ist auf den Inseln nur schwer zu bekommen. Und so musste sie aus jedem Stück das meiste herausholen. Während der kargen Wintermonate hat sie Seiten aus Zeitschriften gerissen und die Ränder vollgekritzelt. Sie hat sich mit alten Quittungen beholfen, auf denen sie die verblasste Tinte überschrieb, und sogar Toilettenpapier verwendet. In dem Umschlag hat ein ganzes Jahr Arbeit gesteckt.
Vorsichtig breitet Miranda die Papiere auf ihrem Schoß aus. In ihnen steckt eine gewisse Ordnung, die außer ihr aber niemand erkennen könnte. Manche würden darin wohl das Gekrakel einer Verrückten vermuten. Oder die den Inseln angemessene Dichtkunst. Sie entdeckt eine Notiz, die von einem sonnigen Nachmittag im September stammt. Und da ist dieser lange, hektische Brief aus dem Herbst. Die Handschrift so aufgewühlt, dass man sie kaum noch entziffern kann. Die welligen Blätter aus der Woche um Thanksgiving herum erinnern sie an die nasskalte Luft damals. Es finden sich Notizen aus den Monaten Dezember und März, aus dem Frühling, dem Sommer.
Vielleicht wird sie in ihnen keine Antworten entdecken. Möglicherweise wird sie sich nie alles erklären können, was ihr passiert ist. Aber sie sind ihre letzte Chance, es zu begreifen. Der Schiffsantrieb wummert. In der Ferne kreischt eine Möwe. Sie klingt wie ein verzweifelter Säugling. Einen Augenblick lang sitzt Miranda noch mit gesenktem Kopf da. Dann beginnt sie zu lesen.
HAISAISON
1
Die ersten Momente meiner Ankunft werde ich nie vergessen. Die Farallon-Inseln waren vollkommen anders als erwartet. Kleiner und zugleich größer, als ich sie mir vorgestellt hatte. Ein winziger maritimer Gebirgszug. Das ganze Gebilde sah aus, als könnte es von einer einzigen mächtigen Welle ins Meer gespült werden. Ich stand auf dem Deck der Fähre. Wellen schlugen gegen den Rumpf, während Captain Joe den Anker warf. Das Schaukeln des Schiffes ließ den Horizont auf schwindelerregende Weise tanzen. Mit einer Hand beschattete ich die Augen und starrte zu meinem neuen Zuhause hinüber.
Vor langer Zeit hatte man diesen Ort „die Inseln der Toten“ genannt, und jetzt verstand ich auch, wieso. Südost-Farallon war nicht mal eine Quadratmeile groß. Die anderen kleinen Inseln waren karstig, kahl und zerklüftet. Hier gab es keine Sandstrände. An den Küsten lagen lange Streifen Seetang, die Gipfel waren schroff und scharfkantig. Die Inseln schienen der Größe nach arrangiert wie Hochzeitsgäste auf einem Schnappschuss. Sie sahen irgendwie unfertig aus. Mag sein, dass Gott die Welt geschaffen hat, aber es scheint, als hätte er seinem minderjährigen Stiefsohn billigen Lehm in die Hand gedrückt und gesagt, er solle daraus die Farallon-Inseln formen.
Neben mir schrie Captain Joe in ein Walkie-Talkie, und eine knisternde Stimme antwortete. Die letzten fünf Stunden hatte ich an Bord der Fähre verbracht. Ich fühlte mich ziemlich durchgeschaukelt und sehnte mich nach einer Dusche. Während das Schiff einen Wellenkamm hinauf- und auf der anderen Seite wieder hinunterglitt, kniff ich, vom grellen Sonnenlicht geblendet, die Augen zusammen. Wir hatten neben einer steilen Klippe festgemacht. Felsen vor einem Hintergrund aus Wolken. Über die Kante wurde etwas heruntergelassen.
Es sah wie ein in sich zusammengefallener Vogelkäfig aus, dessen Boden aus einer schweren Metallplatte bestand. Vor dem Himmel schwangen Netze und Taue hin und her. Ich wusste, dass dieses Ding Billy Pugh hieß. (Niemand kann sagen, woher dieser Name stammt. Zumindest hat es mir keiner verraten, als ich danach fragte.) Captain Joe erteilte Anweisungen. Am anderen Ende antwortete jemand, doch die Stimme aus dem Walkie-Talkie ging beinahe im statischen Rauschen unter. Der Ozean war so dunkel wie Tinte, schleimige Blasen bedeckten die Oberfläche.
Man würde mich per Kran ans Ufer transportieren. Auf den Farallon-Inseln gab es keine Docks. Keinen Hafen. Nichts so Normales. Die Fähre war zwanzig Fuß von der Klippe entfernt, und Captain Joe konnte sie nicht näher heranbringen, weil sonst die Riffs unter der Wasseroberfläche den Rumpf aufgeschlitzt hätten. Mit einigem Getöse schlug der Billy Pugh auf dem Deck auf, und Captain Joe führte mich ohne große Umschweife ins Innere der Netzkonstruktion. Dann zeigte er mir, wie ich mich auf die zerkratzte Metallplatte zu stellen hatte. Über meinem Kopf war das zusammengeraffte Netz an einem Haken festgemacht, von dem ein Stahlseil in die Höhe führte. Irgendwo da oben hing die gesamte Konstruktion an einem Kran, der sich als Schatten vor den Wolken abzeichnete.
Ich drehte mich zu Captain Joe um und fragte: „Da kann nichts passieren, oder?“
„Ich schicke Ihnen Ihr Gepäck hinterher“, erwiderte er.
Der Boden unter meinen Füßen geriet ins Schlingern. Keuchend umklammerte ich die Taue. Der Billy Pugh sah nicht aus, als könnte er mein Gewicht tragen. Jetzt ging es aufwärts, und im ersten Moment hatte ich das Gefühl, wie eine Rakete in die Höhe zu schießen. Zehn Fuß. Fünfzehn Fuß. Ich konnte das Ächzen des Drahtseils hören. Die Metallplatte unter meinen Füßen bewegte sich. Es fiel mir nicht leicht, das Gleichgewicht zu halten, während der Billy Pugh wie ein Pendel hin- und herschwang. Der Ozean blieb unter mir zurück, die Fähre sah irgendwie verzerrt aus, und Captain Joe wirkte wie eine perspektivisch verkürzte Zeichentrickfigur. In der Ferne entdeckte ich etwas, das wie eine Rückenflosse aussah. Genauer gesagt drei, die sich nebeneinanderher bewegten. Ich stand kurz davor, mich zu übergeben.
Dann gab es einen Knall. Der Billy Pugh war gelandet. Nachdem ich mich durch den Spalt in den Tauen hindurchgekämpft hatte, brach ich auf den Farallon-Inseln zusammen.
An die nächsten Augenblicke erinnere ich mich nur verschwommen. Ich lag auf dem Rücken, war stolz, meine erste Prüfung bestanden zu haben, und wartete darauf, dass die Übelkeit verging. Der Granit fühlte sich unter meiner Haut kalt an und bohrte sich in meine Wirbelsäule. Ich konnte den Kran jetzt besser erkennen – einen rostigen Speer, der über das Wasser hinausragte. Der Billy Pugh fuhr wieder in die Tiefe hinunter. Irgendjemand ganz in der Nähe musste das Ding bedienen. Ich hatte keine Ahnung, wer am anderen Ende von Captain Joes Walkie-Talkie gewesen war und mich auf die Insel gehievt hatte. Hier gibt es sechs ständige Bewohner. Sechs Biologen, die auf den Inseln der Toten in wilder Abgeschiedenheit leben.
Auf einem Hügel ganz in der Nähe stand der Antriebsmechanismus des Krans. Jemand saß darin, aber aus dieser Entfernung konnte ich keine Einzelheiten erkennen, ich sah nur eine menschliche Silhouette. Die rotierende Winde spulte das Drahtseil ab, und der Billy Pugh war schnell wieder außer Sicht gesunken. Derweil beobachtete ich einen vorbeifliegenden Meeresvogel und roch ein Gemisch aus Schimmel und Guano. Der Mief der Inseln war so beißend, dass er mir in der Lunge brannte.
Mein Gepäck nahm die gleiche gefährliche Route wie zuvor ich. Als ich mich hochgerappelt hatte, stand der Billy Pugh wieder neben mir. In seinem Innern waren meine Koffer aufgestapelt.
Die Fähre fuhr bereits wieder davon. Ihr Bug wies in Richtung Kalifornien, ihr Kielwasser war eine aufgewühlte graue Brühe. Captain Joe konnte ich nicht sehen. Da es nichts brachte, sich allzu lange in diesen Gewässern aufzuhalten, war er ins Deckshaus verschwunden, ohne sich auch nur grüßend an die Mütze getippt zu haben.
Ich blickte mich nach meinem unbekannten Helfer um. Aber die Silhouette hinter der Sichtscheibe des Krans war ebenfalls verschwunden. Wer immer die Maschine bedient hatte, hielt es wohl nicht für nötig, sich vorzustellen, mir mit dem Gepäck zu helfen oder mich auf den Inseln willkommen zu heißen. Mir steckte ein Kloß im Hals. Im Moment schien ich auf mich selbst gestellt.
Da ich keuchend und schwitzend die Koffer hinter mir herzerrte, brauchte ich eine Weile, bis ich zur Hütte kam. Es war früh am Nachmittag, und die Luft war kühl und klar. Mit einem durchdringenden Schrei glitt in einiger Entfernung ein Meeresvogel vorbei. Der Ozean donnerte. Weiße Gischt sprühte über die Klippen herauf. Vor dem milchigen Himmel hielt der Leuchtturm Wache.
Als ich auf der Veranda ankam, fühlte ich mich wie die Überlebende eines Schiffsunglücks. Die Hütte schien völlig verlassen zu sein. In den Fensterscheiben zeigten sich Risse, und die Holzdielen der Veranda bogen sich unter meinem Gewicht. Es gab keine Türglocke. Von meinem Marsch immer noch außer Atem stand ich inmitten meines Gepäcks. Ich erinnere mich, wie ich allen Mut zusammennahm, um an die Tür zu klopfen, und mich gleichzeitig um einen Wie-schön-Sie-kennenzulernen-Gesichtsausdruck bemühte.
Doch bevor ich die Hand heben oder auch nur blinzeln konnte, wurde die Tür von innen aufgerissen. Erschrocken wich ich einen Schritt zurück, als zwei Männer im Eingang auftauchten.
Einer war alt, der andere jung. Vielleicht lag es ja daran, dass mein Magen noch von der Überfahrt aufgewühlt war, aber im ersten Moment schienen mir die beiden nicht von dieser Welt zu sein. Den Älteren hätte man in einem Film den Gott Poseidon spielen lassen können, mit seinem dichten silbernen Haarschopf, dem wettergegerbten Gesicht und seiner würdevollen Ausstrahlung. Der andere Mann war so dürr wie ein junger Baum. An seinen kräftigen Händen hatte er Schwielen. Vielleicht war er ja eine geringere Gottheit. Ein Elementargeist mit eingeschränkten, aber dennoch erstaunlichen Kräften.
Inzwischen kenne ich natürlich ihre Namen. Galen (alt) und Forest (jung). Damals hatte ich jedoch noch keine Ahnung. Ich holte tief Luft, grinste und sagte: „Hallo.“
„Setz deinen Arsch in Bewegung, sonst verpassen wir die ganze Show“, sagte Forest. Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, dass er zwar in meine Richtung blickte, seine Worte jedoch dem Mann hinter ihm galten. Ich stand nur zufällig zwischen seinem erwartungsvollen Blick und dem Meer.
„Ist ja gut“, grummelte Galen und streifte sich eine Mütze über das weiße Haar.
„Hallo“, wiederholte ich. Lauter diesmal. „Ich bin vor ein paar Minuten mit der Fähre gekommen. Ich …“
Forest wirbelte herum und schlug sich an die Stirn. „Die Kamera. Ist das zu glauben? Ich habe die verdammte Kamera liegen …“
„Zu spät“, sagte Galen. „Die können wir jetzt nicht mehr holen.“
Sie stürmten auf die Veranda, und wenn ich nicht noch rechtzeitig zur Seite ausgewichen wäre, hätte Forest mich einfach umgerannt. Während er den Reißverschluss seines Mantels hochzog, suchte Galen die Küstenlinie mit einem Fernglas ab. Ich öffnete den Mund, machte ihn aber gleich darauf wieder zu. Die Nerven verließen mich, und ich schaffte es einfach nicht, sie noch ein drittes Mal auf mich aufmerksam zu machen. Stattdessen sah ich stumm zu, wie sie über meine Koffer hinwegstiegen und die Stufen hinuntereilten.
Einen Augenblick lang fragte ich mich, ob ich wohl träumte. Das Ganze hatte ja tatsächlich alle Zutaten eines Albtraums: die grauenvolle Überfahrt, die riesigen Wellen, der schreckliche Netzkäfig, die neblig-feuchte See, weit entfernte Rückenflossen, geheimnisvolle Gestalten in der Landschaft, keine Begrüßung, keine Hilfe mit dem Gepäck, keine Gewissheit, keine Sicherheit.
Ich sah den beiden Männern nach, wie sie den Pfad entlangstapften. Als sie schon beinahe den Hügelkamm erreicht hatten, drehte Forest sich um.
„Ach, natürlich, Sie müssen Melissa sein“, schrie er. „Willkommen! Wir würden ja bleiben und uns unterhalten, aber …“
Galen beendete Forests Erklärungsansatz. „… aber im West End Cove findet ein großes Fressen statt“, brüllte er. „Gehen Sie ins Haus, und bleiben Sie drin. Es ist ziemlich tückisch hier draußen.“
Ich brachte es einfach nicht über mich, zurückzuschreien, dass mein Name nicht Melissa sei. Außerdem waren sie auch schon außer Sicht – wie Kinder, die hinter einem Eiswagen herjagen.
2
Dieser Brief wird wie alle anderen auch nie mit der Post abgeschickt werden. Ich finde immer wieder neue kreative Lösungen für die Briefe, die ich dir schreibe. Ich habe sie bereits verbrannt und vergraben. Ich habe Konfetti aus ihnen gemacht. Beim Wandern in den Bergen habe ich sie zu Origamiblumen gefaltet und an Bäume gehängt. Während einer sommerlichen Raftingtour auf dem Mississippi habe ich kleine Papierschiffchen aus ihnen gemacht und in die Strömung gesetzt. Dann schaute ich zu, wie sie, Seerosen gleich, davontrieben und allmählich dunkler wurden. Als ich sie nicht mehr sah, müssen sie wohl versunken sein.
Ich schreibe dir inzwischen schon seit fast zwanzig Jahren. Aber keiner meiner Briefe hat dich je erreicht. Du hast keinen von ihnen gelesen. Schließlich habe ich den ersten in der Woche geschrieben, als du gestorben bist.
Das ist es, woran ich mich noch erinnere:
Du bist ganz plötzlich aus dieser Welt verschwunden. Du hast Dad auf die Wange geküsst, bist zur Arbeit gefahren und nie wieder nach Hause zurückgekehrt. Als der Unfall passierte, war ich in der Schule, in der achten Klasse und hatte gerade Geschichte. Ich hörte die Sirenen. Ein Krankenwagen raste an den Fenstern meines Klassenzimmers vorbei und übertönte, was uns der Lehrer in diesem Moment über europäische Handelsrouten erzählte. Nicht lange danach ging die Schulsprechanlage an, mit einem Knistern, das klang, als flösse Sand in jeden Raum des Gebäudes. Während der Rektor sich mit dem Mikrofon abmühte, knackte es ein paarmal. Ich weiß noch, wie genervt mein Lehrer dreingeblickt hat. Dann hörte ich meinen Namen. Und dann noch mal. Als ich aufstand und die Bücher in meine Schultasche steckte, spürte ich alle Blicke auf mir. Ich machte mir keine großen Sorgen. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich noch nicht, dass der Krankenwagen und mein Name etwas miteinander zu tun haben könnten.
Dein Wagen war an der Ecke 13th und G stehen geblieben. Es war ein typischer kalter Wintermorgen in D. C.: Die Luft war so klamm und schwer, dass sie wie ein nasses Tuch über allem lag. Du hattest keine Ahnung, wie man ein Auto repariert – das war Dads Aufgabe –, aber du hast trotzdem getan, was man in so einem Fall eben tut: geflucht, die Motorhaube geöffnet und verwirrt auf das Durcheinander von Maschinenteilen hinuntergeschaut. Dann hast du das Fahrzeug schließlich stehen lassen und bist den Hügel hinauf zur nächstgelegenen Werkstatt gelaufen. Die Gehwege waren nass und spiegelglatt. Die paar Handvoll blaues Salz, die die Anwohner und Ladenbesitzer gestreut hatten, genügten bei Weitem nicht, um das Eis abzutauen.
So stelle ich dich mir vor: eine schlanke Gestalt in Braun, dein Gesicht bis zu den Augen von einem deiner selbst gestrickten Schals verhüllt. Du bist an einem Fußgängerübergang stehen geblieben und hast gewartet, bis die Ampel auf Grün umspringt. Als du dann mitten auf der Straße warst, hast du gesehen, wie auf der überfrorenen Fahrbahn ein Kipplaster ins Rutschen geriet. Aber da war es bereits zu spät.
Laut Polizeibericht war es ein Unfall, an dem niemand schuld war. Du hast ganz ordnungsgemäß die Straße überquert. Und der Fahrer hatte erkannt, dass die Ampel rot wurde, und auch versucht anzuhalten. Aber wegen des eisglatten Asphalts und der Massenträgheit seiner Ladung aus dreizehn Tonnen Kies schaffte er es nicht. Jeder der Beteiligten hatte sich an Recht und Gesetz gehalten. Das verstörte mich irgendwie. Ein Unfall mit einem Schuldigen wäre mir lieber gewesen. Es fiel mir schwer zu begreifen, dass niemand für den Verlust meiner Mutter verantwortlich sein sollte – nicht mal du selbst.
Meine deutlichste Erinnerung an diesen Tag ist, wie ich vor dem Büro des Rektors saß, mit den Füßen auf den Teppich trommelte und mir überlegte, ob ich mir in der Früh wohl die Zähne geputzt hatte. Dass ich aus dem Unterricht geholt worden war, konnte ich mir nur so erklären, dass du bei deinem gut gemeinten, aber übertrieben vollgestopften Terminkalender mal wieder vergessen hattest, mich zu einem Zahnarzttermin zu bringen. Dafür warst du bei Dr. Greenbergs Angestellten geradezu berüchtigt. Ich stellte mir vor, wie dich jemand angerufen und freundlich an den Termin erinnert hatte. Und wie du dann aus der Arbeit gerast bist, mit Kaffeeflecken auf dem Ärmel – und Kleenex-Tüchern, die aus einem unverschlossenen Fach in deiner Handtasche herausgeweht wurden und hinter dir herflatterten. Es wäre nicht das erste Mal gewesen. Ich war mir sicher, dass du jeden Moment atemlos und aufgebracht in den Gang stürmen würdest.
Als die Tür aufging, kamst aber nicht du herein, sondern Tante Kim. Sie sah blass aus und benahm sich so eigenartig, dass ich sofort von meinem Sitz aufsprang. Tante Kim schien stets absolut unerschütterlich, und auch jetzt war sie nicht gerade in Tränen aufgelöst. Aber sie war blass um die Nase und hatte ihren Mantel falsch zugeknöpft. Als sie mich entdeckte, zuckte sie sichtlich zusammen. Dann ging sie auf die Schulsekretärin zu. Die beiden flüsterten miteinander und sahen zu mir herüber. Beunruhigt beobachtete ich, wie sich der Gesichtsausdruck der Sekretärin veränderte. Ihre übliche gelangweilte Miene wich plötzlich einer mitleidigen Grimasse.
In deiner Familie gab es drei Schwestern. Du warst die älteste und beste. Kim und Janine, die Zwillinge, glichen einander wie ein Ei dem anderen. Was sie noch dadurch betonten, indem sie sich beide grau kleideten, Kurzhaarfrisuren trugen, eine Vorliebe für hauchdünne Halstücher teilten und braunen Lippenstift verwendeten. Einzeln betrachtet war jede von ihnen bieder und unscheinbar, aber wann immer ich sie miteinander sah, fand ich sie ausgesprochen gruselig. Als wären sie zwei lebende Spiegelbilder oder eine optische Täuschung. Die identischen Gesten, dieselben Seitenblicke, sogar ihre Stimmen klangen gleich. Wenn ihr zu dritt wart, verstärkte sich dieser Eindruck noch. Du warst genauso gebaut wie sie: klein und schmal wie ein Vogel. Du warst zwar ein wenig größer und kecker und hast immer ein bisschen lauter gelacht, aber ihr drei hattet so viel gemeinsam: euren Hüftschwung, den leicht zur Seite geneigten Kopf, euer schroffes, heiseres Gemurmel. Echos, Parallelen und Unerklärliches.
Dein Temperament war jedoch einzigartig. Du warst immer überreizt und schienst nur aus Gefühlen zu bestehen. Für einen schönen Sonnenuntergang hättest du alles stehen und liegen gelassen. Und manchmal konntest du während einer freundlichen Diskussion auf einer Dinnerparty derart in Rage geraten, dass du mit der Faust auf die Tischplatte eingedroschen hast. Kim und Janine hatten nicht dein Feuer. Sie waren stoische und besonnene Frauen, die es für eine Schwäche hielten, wenn man seine Gefühle zur Schau stellte.
Nun nahm mich Tante Kim am Arm und führte mich hinaus. Ihre Lippen waren zu einem schmalen Strich zusammengepresst.
Im Auto wartete Tante Janine auf uns. Als ich sie sah, schrillten in meinem Kopf die Alarmglocken. Die Zwillinge nahmen ihre Jobs sehr ernst. Sie meldeten sich niemals krank und nahmen auch nie all ihre Urlaubstage. Und jetzt saßen sie mitten am Tag nicht an ihren Schreibtischen, sondern waren hier. Sie trugen ihre Arbeitskleidung, pressten die Lippen aufeinander, und ihnen zitterten die Hände. Ich verstand zwar nicht, was los war, aber es gefiel mir nicht. Auch Tante Janine erklärte mir nichts und ließ mich einfach auf dem Rücksitz Platz nehmen.
Tante Kim fuhr. Ihre Hände hielten das Lenkrad so fest umklammert, dass die Knöchel weiß hervortraten. Ich hoffte immer noch, dass all das mit meinen Zähnen zu tun hatte. Auf der Windschutzscheibe hatten sich Eisblumen gebildet, und durch das Glas sah ich den träge schimmernden Potomac River, der immer wieder zwischen den Gebäuden aufblitzte. Tante Kims Handy läutete, aber sie nahm das Gespräch nicht während der Fahrt an. Das war nicht ihre Art. Bevor sie abhob, fuhr sie erst rechts ran. Am anderen Ende erkannte ich die Stimme meines Onkels, verstand aber nicht, was er sagte.
„Ja“, sagte Tante Kim in fröhlichem Ton. „Hier im Auto. Mm-hm.“
Ich rollte mit den Augen. Ganz offensichtlich sprachen sie über mich.
„Welches?“, fragte sie. „Das in Bethesda? Okay.“
Ich starrte immer noch auf den Fluss.
„Wir sind gleich da“, sagte Tante Kim, und ihre Stimme klang noch immer bemüht heiter.
Ohne mir etwas zu sagen, wendete sie das Auto. Sie und Tante Janine wechselten einen Blick und verständigten sich mit ihrer Zwillingstelepathie. Eine verengte die Augen zu Schlitzen, die andere nickte, und dann sahen sie beide wieder geradeaus. Wir fuhren erneut an meiner Schule vorbei. Während der wenigen verstrichenen Minuten schien das Gebäude irgendwie geschrumpft zu sein. Durch das Autofenster wirkte es so merkwürdig weit weg, als würde ich es durch ein verkehrt herum gehaltenes Fernglas betrachten. Der Verkehr war wirklich schlimm an diesem Vormittag. In D. C. ist der Verkehr allerdings immer übel. Während wir fuhren, herrschte eine Stille, die durch die kalte Luft noch verstärkt zu werden schien. Ein paarmal sah ich, wie Tante Kim unbewusst zum Radio hinüberlangte. Normalerweise lief in ihrem Auto stets in voller Lautstärke das Programm von NPR. Aber jedes Mal zog sie die Finger wieder so rasch zurück, als hätte sie sich verbrannt.
Wieder klingelte ihr Handy, und sie fuhr erneut an den Straßenrand, was ihr ein wütendes Hupen vom Taxi hinter uns einbrachte. Mein Onkel war dran, aber ich konnte auch diesmal nicht verstehen, was er sagte.
„Fast da“, sagte Kim.
Aber dann wurde ihr Gesicht mit einem Schlag so ausdruckslos wie eine Tafel, die jemand mit einem Schwamm sauber gewischt hatte. Leer bis auf zwei Augen, eine Nase und einen leicht offen stehenden Mund. In diesem Augenblick sah sie dir besonders ähnlich.
Mein Onkel sprach immer noch, und ich vernahm sein gedämpftes Gebrabbel.
„Verstehe“, sagte sie.
Dann wendete sie das Auto noch einmal, und ich sah in der Ferne wieder meine Schule auftauchen. Anscheinend würden wir den ganzen Tag davor auf und ab fahren. Ich räusperte mich, aber Tante Kim sah mich nicht an. Tante Janine presste sich eine zittrige Faust an den Mund. Sie hatten immer noch kein Wort miteinander gesprochen. Es war nicht nötig.
„Wo fahren wir hin?“, fragte ich.
Es war Tante Janine, die mir schließlich antwortete: „Wir bringen dich heim.“
Die folgenden Tage sind aus meinem Gedächtnis verschwunden. Jemand anderes zog sich etwas Schwarzes an und ging zum Begräbnis. Jemand anderes ließ die gefühlsschweren Umarmungen über sich ergehen. Mir sind nur ein paar kurze und verschwommene Erinnerungsfetzen geblieben. An die eiskalte Winterluft, die durchs Haus zog. Und an Dads rote, verquollene Augen. Die Totenwache war ein schummeriges Gemisch aus weichen Teppichen und gedämpften Lichtern. Es schien, als müsste jeder Erwachsene im bekannten Universum zu mir kommen und erklären, dass Gottes Wege unerklärlich seien. Einer nach dem anderen sagte: „Mein herzliches Beileid.“ Es war, als hätten sie alle dasselbe Drehbuch bekommen. Aber einen Moment habe ich doch noch ganz deutlich vor Augen: Während ich in meinem Trauerkleid unbehaglich in der Nähe stand, zupfte eine meiner kleinen Cousinen Tante Kim am Ärmel und erkundigte sich nach dir. Mit ihrer glockenhellen Stimme fragte sie, ob du bald kommen und dich neben sie setzen würdest.
Ich war vierzehn Jahre alt, und im vorderen Teil des Raums erhob sich, halb verdeckt von Blumen, dein glänzender Sarg. Ich kannte also die Antwort auf die Frage meiner Cousine. Dennoch wartete ich mit pochendem Herzen darauf, was meine Tante Kim sagen würde.
„Frag nicht so blöd“, schnauzte sie. „Hol dir einen Keks, und sei leise.“
Ich blinzelte. Die Zeit verging, und ich stand draußen im kalten Wind auf dem Gehweg. Eine Weile lang passierte mir das ziemlich häufig. Einmal zwinkern, und eine Stunde war vergangen. Noch mal zwinkern, und ein ganzer Nachmittag war vorbeigerauscht. Es war, als schnitte jemand mit einer Schere Zeit aus meinem inneren Kalender.
Ein paar Abende später kam ich plötzlich wieder zu mir. Ich saß in meinem Kinderzimmer. Dad war unten. Auch er war in eine Art Wachkoma gefallen und schien nur noch von Footballübertragungen im Fernsehen und schwarzem Kaffee zu leben. Er hätte mich sicher gern an seiner Seite gehabt, aber ich ging ihm aus dem Weg. Ich ging allen aus dem Weg. Tante Kim hatte mir eingeschärft, sie jederzeit anzurufen. Und Tante Janine hatte unabhängig von ihr noch mal das Gleiche zu mir gesagt, in exakt demselben Tonfall.
Eine meiner Klassenkameradinnen hatte die Hausaufgaben der vergangenen Woche vorbeigebracht. Sie stapelten sich auf meinem Schreibtisch und warteten darauf, dass ich sie erledigte. Es gab tausend Dinge, die ich hätte tun können. Aber mir war, als stünde die Welt plötzlich kopf, und außer mir würde es niemand bemerken. Ich konnte kaum glauben, dass der Schulbetrieb weiterging und dass ich ab Montag wieder am Unterricht teilnehmen sollte. Wie konnte es sein, dass draußen auf der Straße immer noch Autos fuhren?
Auf meiner Matratze zusammengerollt versuchte ich, das Wort tot zu sagen. Todmüde, todsicher, zum Totlachen. Wenn man erst mal darüber nachdachte, begegnete es einem überall. Es tauchte in den alltäglichsten Unterhaltungen auf, in Augenblicken, wo es überhaupt nichts zu suchen hatte. Wie ein Warnsignal, das ich bislang bloß leichtsinnigerweise immer übersehen hatte.
Dann fiel mir das Dead Letter Office ein, die Postabteilung für unzustellbare Briefe. Ein paar Wochen zuvor – es kam mir vor, als wären seither zehn Jahre vergangen – hatte ich mit meiner Klasse das Postamt besucht. Es war furchtbar langweilig wie alle erzwungenen Ausflüge zu staatlichen Einrichtungen. Räume voller Aktenschränke. Ein verschwitzter Postbeamter in blauer Uniform, der von einem Stapel Karteikarten ablas, während er uns herumführte. Dabei bombardierte er uns unentwegt mit haarsträubenden Wortspielen. Lange Korridore. Keine Essenspausen.
Im Dead Letter Office landeten sämtliche Briefe, deren Empfänger nicht ermittelt werden konnten. Unser Führer war sehr stolz auf diese Abteilung. Sie sei etwas ganz Besonderes, sagte er. Das große Dead Letter Office in New York City sei sogar schon mal in einem Weihnachtsfilm zu sehen gewesen, weil sich in der Vorweihnachtszeit die an Santa, Nordpol adressierten Wunschlisten dort wie Schneewehen aufhäuften.
Ich ging schnell zum Schreibtisch in meinem Zimmer, wo ich ein paar Bogen Papier und einen Bleistift nahm. Ich kann mich erinnern, dass am hinteren Ende des Bleistifts statt eines Radiergummis ein kleiner Federbusch saß. Dann schrieb ich, ohne abzusetzen, zehn Blätter auf beiden Seiten voll. Über die Halskette, die Tante Kim beim Begräbnis umhatte, hättest du ganz sicher lachen müssen – sie hat einfach keinen Geschmack – wegen ihrer Hühneraugen musste Tante Janine Schuhe mit flachen Absätzen tragen – es war so merkwürdig, sie dort ohne dich zu sehen – alle aus der Familie quatschten und tranken Kaffee, gingen herum und nahmen einander in den Arm – aber die Zwillinge blieben immer wieder stehen und blickten sich um, als würden sie nach dir Ausschau halten. All das schrieb ich in einer Art Trance. Meine Hand glitt über das Papier und zog Wörter hinter sich her. Sie haben dich für das Begräbnis in ein grässliches Kleid gesteckt – ich fand, du hättest deine Jeans tragen sollen, aber Tante Kim sagte: „Auf gar keinen Fall.“ – ich habe dir ein Päckchen Kaugummi in den Sarg gesteckt – ich glaube ja nicht an den Himmel, aber du schon – vielleicht kannst du mit dem Kaugummi auf dem Weg nach da oben etwas gegen den Druck in deinen Ohren tun.
Schließlich fiel mir nichts mehr ein. Nachdem der Brief fertig geschrieben, gefaltet und in einen Umschlag gesteckt war, schlich ich nach unten, um mir eine Briefmarke zu holen. Ganz leise, um Dad nicht aufzuscheuchen. Auf den Umschlag schrieb ich nur ein einziges Wort: Mom. Dann schlüpfte ich in meinen Mantel und lief die Straße runter zum Briefkasten.
In allen Ländern, die ich je besucht habe, gibt es Briefumschläge für dich. Schließlich schreibe ich dir ja schon seit fast zwanzig Jahren. Vielleicht ist es komisch, dass ich dir immer noch so viel mitzuteilen habe. Aber mir fallen ständig neue Fragen ein, die ich dir stellen möchte. Und in meiner Vorstellung streiten wir uns auch ab und zu. Die Erinnerungen an dich, die ich mir bewahren konnte, nehme ich mir immer wieder aufs Neue vor: dein laut schallendes Lachen; der Duft deiner Haare nach Honig und Lavendel; wie du während langer Autofahrten immer vor dich hin gesummt hast; dein Faible für Leinenröcke. Die Trauer, die mich dabei auch heute noch überfällt, kann ich nur lindern, indem ich mich an den Schreibtisch setze, über ein Blatt Papier beuge und ein paar Minuten lang wild drauflosschreibe.
Dass ich permanent unterwegs bin, macht die Angelegenheit natürlich nicht einfacher. Für meine Arbeit reise ich rund um den Globus. Ein Naturfotograf darf niemals zu lange an ein und demselben Fleck bleiben. Für meinen ersten Job war ich gleich nach dem College ein paar Wochen lang kreuz und quer auf dem Horn von Afrika unterwegs, wo ich die Tiere in der Wüste fotografierte. Mich hatte, um es mit Dads Worten zu sagen, „das Reisefieber gepackt“. Seither habe ich Berge bestiegen und bin in Höhlen getaucht. In den Tropen habe ich mir die schlimmsten Sonnenbrände geholt, und ich habe auch schon in notdürftigen Iglus geschlafen. Ich bin mittlerweile auf allen Kontinenten gewesen und in fast jedem Ozean geschwommen.
Einmal habe ich einen anstrengenden Monat in Kenia verbracht, wo mir die dünne Höhenluft ständig den Atem raubte und die Hitze tief in die Knochen drang. Ein andermal war ich eine Woche am Indus und machte Aufnahmen von den blinden Flussdelfinen dort. (Jahrhunderte in dem trüben Wasser hat ihren Sehsinn überflüssig werden lassen.) Oder mein dreiwöchiger Foto-Trip durch Australien, wo ich jeden Zoll der Affenbrotbäume aus allen Blickwinkeln abgelichtet habe – mit ihren unglaublichen Silhouetten, die fett und wächsern wie Kerzen sind.
An vielen dieser Orte hat es keine Dead Letter Offices gegeben und oftmals überhaupt kein Postsystem. Ich konnte mich schlecht an den Führer wenden, der mich auf den glitzernden Indus hinausgefahren hatte, und ihm einen Umschlag in die Hand drücken, auf dem bloß Mom stand – mit der Bitte, sich für mich darum zu kümmern. Genauso wenig konnte ich meine Briefe einfach in einen Mülleimer oder in den Rinnstein werfen. So schlecht würde ich sie nie behandeln.
Stattdessen habe ich sie unter Felsen und Baumwurzeln gesteckt. Und in die Spalten von Ziegelmauern gestopft. Ich habe sie an Telefonmasten neben die Bilder von vermissten Hunden und Werbezetteln für Musikunterricht geheftet. Und sie an die Wäscheleinen wildfremder Menschen gehängt. Ich habe Drachen aus ihnen gemacht, die ich an windigen Tagen aufsteigen ließ. Sobald sie hoch genug am Himmel standen, ließ ich sie dann los und sah zu, wie der Wind sie davontrug.
„Das Debüt der US-amerikanischen Autorin Abby Geni entführt uns in Gefilde, die schon von den Indianern ›Insel der Toten‹ genannt wurden. Wobei die alten Spukgeschichten, die Geni in ›Ein Grab in den Wellen‹ erzählt, nur der Auftakt sind für das Grauen, das sich im Kampf mit den Naturgewalten offenbart.“
„Eine gut geschriebene, interessante Charakterstudie über eine junge Frau, die zum Zentrum des Verbrechens wird.“




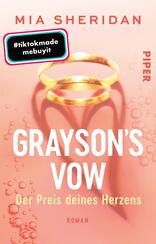





Ein toller spannender Roman - vielleicht zwar ein Krimi und doch keiner. Die Inselstimmung wird perfekt geschildert - sie fährt richtig ein. Man fühlt sich selbst dorthin versetzt. Das Reduziertsein auf die Elemente, Himmel, Erde, Meer und die riesigen Tiere: See-Elefanten, Wale und Haie plus die bedrohlichen Vögel - gewaltig!
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.